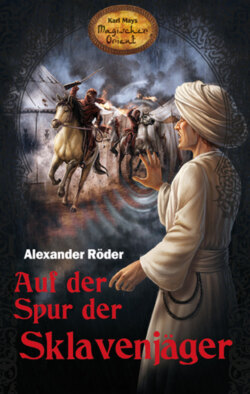Читать книгу Auf der Spur der Sklavenjäger - Alexander Röder - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fünftes Kapitel Der graue Weiher
ОглавлениеIch blickte mich um. Wir hatten auf einer kleinen Anhöhe gelagert, deren Felsen einen guten Schutz vor Wind und Entdeckung boten. Ringsum hob sich das Gelände in sanften Wellen, mit dürrem Bewuchs und steinigem, sandigem Grund. Ich konnte recht weit schauen, sah jedoch Haschim nicht. Sein Pferd stand bei den anderen, und sein Gepäck, vor allem seine Waffen, waren an ihrem Ort.
Nun, vielleicht wäre ich bei einem anderen Mitglied meiner Gruppe besorgter gewesen. Haschim war aber nun einmal ein Magier und hatte seine Eigenheiten.
Ich schaute und lauschte, aber ich konnte nichts Außergewöhnliches bemerken. Schon wollte ich mich umwenden, um die anderen zu wecken und den Tag wie die vergangenen zu beginnen, mit knapper Verköstigung und raschem Aufbruch, als mein Blick über eine Stelle am Fuß der Anhöhe streifte. Ein eigentümliches Gefühl überkam mich. Ich verengte die Augen, um im dämmrigen Licht Genaueres zu erkennen, doch der Fleck blanken Steppengrunds zwischen den verstreuten Steinen schien nicht anders als das weitere Gelände ringsum. Dann fühlte ich, wie meine Hand sich wie von selbst zu meiner Westentasche bewegte. Gewiss war ich es selbst, der sie führte, aus eigenem Willen, doch es geschah nahezu unbewusst, so wie man eine oft geübte, lang gewohnte Bewegung vollführt. In der Westentasche glitt der Musaddas zwischen meine Finger, ich hob ihn zu meinem Auge und spähte durch den Sechseckring auf die Stelle, die mich so seltsam beunruhigt hatte.
Nun sah ich es! Der Musaddas enthüllte mir die wahre Natur der Dinge. Und hier war es tatsächlich die Natur selbst, die sich mir in anderer Gestalt zeigte als mit dem bloßen Blick.
Unter mir, dort wo der sanfte Hang endete, zeigte sich mit einem Mal eine schimmernde Fläche, die den heller werdenden Himmel spiegelte, ihn jedoch zu einem dumpfen, bleiernen Grau verfärbte. Mir schien es wie ein seichtes Gewässer, und tatsächlich erblickte ich ein mattes Glitzern, wie es von einer schwachen Bewegung der flüssigen Oberfläche zu erwarten war. Je genauer ich hinschaute und zudem auch meinen Blick durch den Musaddas bewegte, erkannte ich, dass sich ein nicht kleines Areal um den Hügel herum in jenes Schwemmland verwandelt hatte, etwa einen guten Steinwurf in jede Richtung meines Blickfelds. Hätte ich nicht auf jener Anhöhe gestanden und wäre es ein heller, sonnendurchglühter Tag in der Wüste gewesen, wäre mir dies wie eine Luftspiegelung erschienen, als jenes Gaukelspiel der Natur, welches dem Dürstenden ein nahes Wasser verspricht und dennoch nur ein Bild aus der Ferne wiedergibt.
Und um mich eben davon zu überzeugen, dass es weder eine natürliche noch eine magische Spiegelung war, begann ich die Anhöhe hinunterzugehen, weiterhin durch den Musaddas schauend, auf die schimmernde Fläche zu.
Schon sah ich, wie leichter Dunst sich bildete und meine Stiefel umfloss. Ich roch salzige Feuchte wie am Ufer des Meeres, doch fehlte die Frische einer Brise, die Luft stand und der Geruch von brackigem Wasser begann stärker zu werden.
Dann schälten sich aus dem höher steigenden Dunst einige Schatten heraus, wie schmale Arme mit dünnen Fingern, die still gen Himmel griffen. Es waren die Äste und Zweige von Mangroven, die blattlos aus dem Brackwassersumpf ragten. Auch einige flache Buckel aus grauem Gras, glitzernd von Salz, erhoben sich aus dem Marschland. Im trüben Wasser spiegelte sich matt ein bleifarbener Himmel.
Eigentümlicherweise verspürte ich einen kühlen Hauch im Gesicht, als strömte durch den Ring des Musaddas wahrhaftig die klamme Luft, welche über dem Salzsumpf zu liegen schien. Auch war mir, als nähme ich die dumpfe Stille war, das tonlose Verharren jenes brackigen Halblandes, in dem sich nichts rührte. Gewiss gab es auch um mich herum keine Laute, denn obwohl die Morgendämmerung nahte, gab es in der baumlosen Gegend unseres Lagers nun einmal keine Vögel, die in ihren Nestern erwachten, um zwitschernd und singend den Tag zu begrüßen. Doch so, wie ich jene Kühle auf meiner Gesichtshaut zu spüren vermeinte, legte sich ein Druck auf meine Ohren, der von der unnatürlichen Abwesenheit von Klang und Geräusch herrühren mochte, die sich mir beim Blick durch den Musaddas mitteilte.
Ich wusste nun, dass der Musaddas denjenigen, der durch den goldenen Sechseckring blickte, die Dinge so schauen ließ, wie sie wirklich waren. Dies hatte ich bei Wesen und Menschen erlebt, auch in den fernen Bergen des Balkans, als ich den geheimen Weg erkannte, der uns zum Stahlpalast des Schut geführt hatte. Doch war jener Weg zum Teil ein wirklicher Pfad im Fels gewesen, aus dem Gestein herausgehauen und dann mittels Magie vor den Augen der Menschen verborgen. Aber dieser Salzsumpf, der nun vor mir lag – sollte ich glauben, dass hier, in den zur Zeit ausgetrockneten Schwemmgebieten des Tigris und seiner Nebenflüsse, in Wahrheit ein Marschland von Mangroven sich erstreckte, dieses jedoch unter einer zauberischen Tarnkappe versteckt worden war? Wer sollte dies getan haben und warum?
Ich setzte zu einem weiteren Schritt an, vorsichtig, mit einem knappen Blick nach unten. Nicht, dass ich befürchtete, in den Sumpf zu geraten, der genauso eine Täuschung hätte sein können, sondern um nicht etwa auf dem wahrhaftigen Erdboden über einen Stein zu stolpern und der Länge nach hinzuschlagen. Niemand soll glauben, ich vergäße die Wirklichkeit, auch wenn ich Wunder schaue!
Dann aber geschah es: Ich wollte meinen Fuß auf den Staub und das Geröll setzen, so wie ich es mit bloßem Auge erblickte, und als der Absatz meines Stiefels sich auf den Grund senkte – da trafen nicht Ledersohle und Erdreich aufeinander. Stattdessen umfing weicher Morast mich sogleich bis zum Knöchel, und eine empfindliche Kühle stach in meine Haut.
Rasch zog ich den Fuß zurück, setzte ihn einen Halbschritt nach hinten und stand tatsächlich wieder fest. Durch den Musaddas sah ich die schlierige Feuchte auf dem Stiefel.
Der Salzsumpf war also kein Trugbild, sondern wahrhaftig vorhanden. Sogleich dachte ich, dass ich die anderen warnen müsse, damit sie nicht sehenden – oder eben nicht sehenden – Auges in ihr Unheil gingen. Und ich dachte zudem an mögliche andere Reisende, die hier würden hineingeraten können. Man sollte den Sumpf mit warnenden Zeichen versehen, abstecken wie den Pfad durch ein Moor oder einfrieden wie ein Stück Treibsand. Dergleichen kannte man durchaus, auch in der Nähe der Wüstengewässer des Zweistromlands.
Und dann – ich verwünschte meine forschenden Blicke durch den Musaddas und auch meine nüchternen Gedanken zur Abwehr von Gefahren – dann endlich begriff ich!
Haschim war verschwunden – er konnte nur in diesen magisch verhüllten Salzsumpf geraten sein! In ungekanntem Jähzorn wollte ich beinahe den Musaddas fortschleudern, als Zeichen meiner Verachtung für Zauber und Magie! Hätte ich am Fuße des Hügels einen normalen Sumpf oder Morast erblickt – und dies eben mit meinen naturgegebenen Augen –, ich hätte sogleich an die Gefahr gedacht, an Haschims Verschwinden – und gehandelt!
Fest griff ich den Musaddas, das verwünschte und doch so notwendige Ding, hielt ihn dicht an meine Augenhöhle gedrückt und spähte angestrengt hindurch, wandte den Kopf langsam hin und her und ließ meinen Blick eifrig, aber höchst aufmerksam über den Salzsumpf gleiten, auf der Suche nach einem Anzeichen von Haschim. Die Mangrovenstümpfe prüfte ich besonders – welch schreckliche Ironie, dass ich sie mit Armen und Händen verglichen hatte! Kalter Schmerz stach in meinen Magen – was, wenn ich ein letztes Aufbäumen meines Freundes übersehen hatte, bevor er versunken war?
Da, endlich, erkannte ich eine Bewegung! War es ein Nebelstreif, ein wehender Dunst zwischen den Mangroven? Ich blickte scharf, bewegte meinen Kopf ein wenig, um die Perspektive zu ändern, und tatsächlich: Da war etwas. Doch schon verschwand es wieder, als ein weißer Schleier sich darumlegte.
Wenn doch nur etwas zu hören gewesen wäre! Ein Ruf oder auch nur eine Bewegung des Wassers, damit ich hätte sicherer sein können. Es half nichts, ich musste in den Sumpf hinein, um Genaueres zu erkennen. Gedankenschnell wog ich die Möglichkeiten ab – sollte ich zum Lager zurück, um ein Seil zu greifen? Als Sicherheitsleine und Wegweiser? Doch wo hätte ich es befestigen sollen? Ringsum war alles baumlos, und es gab auch keine großen Felsen in der Nähe. Ich hätte meine Gefährten wecken können, doch ihnen die Situation zu schildern, wäre allzu langwierig und auch heikel gewesen. Halef würde mir zwar sogleich glauben, er wusste schließlich schon, was ich durch den Musaddas sehen konnte. Und Sir David hatte so einiges mit einem magischen Wegstein erlebt, der ihm und uns auf dem Balkan die geheimen Pfade sichtbar gemacht und somit geöffnet hatte. Doch Amscha würde mich und uns wohl für irrsinnig und wahnhaft halten. Ich konnte kaum erwarten, dass sie mir vertraute, wie meine langjährigen Freunde es taten.
Und zudem zweifelte ich an dem Nutzen einer solchen Seilschaft, eben weil ich an dem zweifelte, was hier vor mir lag. War es ein Trugbild oder einer jener Übergänge in eine andere Welt, wie ich sie in den Bergen zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer erlebt hatte? Konnte ein schlichtes Seil mich bewahren vor Gefahr und Irrweg?
Aber selbst wenn vor mir tatsächlich ein Teich aus Treibsand lauerte, würde ich diesem durchaus entrinnen können, denn die Gefahren, die solcherlei geologische Besonderheit bergen, werden oftmals übertrieben. In Treibsand, jenem Gemisch aus feinsten Steinkörnchen und Wasser, versinkt man niemals tiefer als bis zur Hüfte, was von einer physikalischen Gesetzmäßigkeit herrührt, die ich nicht weiter erläutern will. In einem Sumpf hingegen kann einem das trübe Wasser wahrhaftig bis zum Hals stehen – und gar über dem Scheitel zusammenschlagen. Meiner Kenntnis nach, die sich eben aus Erfahrung und nicht aus Hörensagen oder Lektüre speist, würde ich dieses Areal ohne größere Gefahr betreten können. Ringsum gab es zu wenig Wasser, als dass sich hier wirklich Sumpf oder Treibsand hätten bilden können. Obgleich, wenn es hier nicht mit irdischen Dingen zuging …
Ich entschied rasch, denn Zeit war hier wichtig. Wollte ich Haschim retten, musste ich nun handeln, auch ohne Seil und Sicherungsmannschaft.
Ich trat in den verborgenen Sumpf – doch zuvor rief ich laut nach meinen Gefährten, die wohl gerade mit der Tagesdämmerung erwachten, je nach Bedürfnis und Anliegen, seien es Breakfast Tea oder Morgengebet.
„Halef!“, rief ich laut. „Sir David! Amscha! Rasch! Ein Seil!“
Das sollte genügen.
Bis dahin war ich auf mich allein gestellt. Ich musste meinem Können und meiner Erfahrung vertrauen. Vor allem aber trieb mich die Sorge um Haschim an. Und ich fühlte, dass er sich an diesem Ort befand, meine Hilfe brauchte, und dass in diesen Augenblicken nur ich es war, der ihm helfen konnte.
Ich setzte meinen Fuß auf eine der salzschimmernden Grassoden. Sachte gaben die Halme nach, ich fühlte das Knistern der silbrigen Kruste mehr, als dass ich sie hörte. Dann spürte ich Widerstand unter der Sohle – der Erdbuckel war fest genug, um mir Halt zu geben. Ich balancierte und vollzog den nächsten Schritt, der mich wiederum zu sicherem Stand führte. Einige dicht verflochtene Wurzeln waren ebenso als Tritt geeignet, wie ich rasch feststellte, und so kam ich gut voran, tiefer in den Salzsumpf, der vielleicht gar keiner war oder aber sich nicht an diesem Ort befand.
Meinen nächsten Schritt musste ich ausgreifender setzen, mit ein wenig Schwung. Um das Gleichgewicht zu halten, streckte ich beide Arme aus, dann schwang ich sie herum und griff nach einem hoch aufragenden Ast.
Wie konnte ich diesen Mangrovenauswuchs denn sehen, fragen sich nun meine Leser, die sich erinnern, dass ich mit einer Hand den Musaddas vor das Auge halten musste?
Nun, ich hatte Vorsorge getroffen, dass ich bei meinem Weg in den Sumpf beide Hände zur freien Verfügung hatte. Vor meinem ersten Schritt in das Brackwassergelände hatte ich eine Lederschnur aus meiner Kleidung gezogen und mit dieser den Musaddas vor meinem Auge befestigt. Ich war froh, diesen vor langer Zeit von der Kette befreit zu haben, an der sein erster Besitzer, Abu Zanad, einer der Banditen Al-Kadirs, den Sechseckring um den Hals getragen hatte. Seitdem ruhte der Ring in meiner Westentasche, jedoch ohne störendes Anhängsel. Bei Bedarf, wie in diesem Moment, war es mir ja rasch möglich, für alles Nötige zu sorgen. Ich bin nun wahrlich nicht eitel, aber man verzeihe mir, dass ich nicht zuvor mit großen Worten meine Idee und deren Ausführung geschildert habe, wie ich das Problem der magischen Sicht auf den verzauberten Sumpf löste – denn ich fand, dass ich mit jener Vorrichtung vor dem Auge doch gar zu seltsam ausschaute, wie die karikierte Schimäre aus einem karibischen Freibeuter und einem preußischen Kommerzienrat. Beides liegt mir gleichermaßen fern.
Doch es nutzte mir wohl, durch den Musaddas schauen und dennoch beide Hände verwenden zu können, denn ich kam gut voran, unter aller gebotenen Vorsicht, und war bald an dem Punkt angelangt, den ich vom Ufer aus, wie ich es einmal nennen mag, erkannt hatte. Hier saßen die Mangroven etwas dichter, die Flecken aus Gras waren spärlicher gesät, und so musste ich kurz über einen Verhau aus Wurzeln steigen, bis ich mein Ziel erreichte. Meine Kleidung war mittlerweile vom Dunst durchfeuchtet und helle Spuren von Salz zogen sich darüber. Meine Hände brannten ein wenig, doch erkannte ich den Nutzen, weil die Salzkristalle mir tatsächlich einen guten Griff an den glitschigen Mangroven ermöglichten.
Dann trat ich auf eine winzige Grasinsel zwischen den Wurzeln und sah vor mir eine Wasserfläche von der Größe eines kleinen Weihers, eher eines Tümpels. Ich hätte diese mit einem Dutzend Schritten durchmessen können, wäre es fester Grund gewesen. Doch ich erkannte, dass sich keine Wurzeln und kein Erdreich unter der Oberfläche befanden, die still und unbewegt den grauen Himmel darüber widerspiegelte. Wenn es denn der Himmel war.
Wasser, Brackwasser war es jedoch allemal, denn dessen schwachen Geruch konnte ich wohl wahrnehmen. Dumpf und still war es noch immer. Ich konnte somit auch nicht vernehmen, ob meine Gefährten sich bereits hinter mir versammelt hatten. Ihre Rufe wären wohl auch verwundert gewesen, weil ich nicht auf sie reagierte und stattdessen unbeirrt über staubigen Grund schwankte – ohne einen für sie erkennbaren Grund.
Für einen Herzschlag kam mir der Gedanke, dass ich für sie unsichtbar wäre, so wie der Sumpf und auch Haschim. Hätte ich ihn nicht am Boden liegen sehen müssen?
Nein, diese Überlegung ging fehl, weil sie zu logisch war. Ich hatte gespürt, dass Haschim in der Nähe sein musste. Ob tatsächlich oder auf einer anderen Ebene der Welt oder des Bewusstseins. Ich musste kein Magier oder Metaphysiker sein, um dies zu erkennen, denn dafür hatte ich in jenen Bereichen über die vergangenen beiden Jahre genug erlebt.
Ein Dunstschleier wehte über den Tümpel, obgleich ich keinen Wind verspürte.
Und dann zerfaserte dieser Nebelvorhang und enthüllte mir – das Schreckliche!
Ich sah Haschim auf dem Wasserspiegel knien, den Rücken mir zugewandt und den Blick erhoben. Er schaute zu einem kopfgroßen Gebilde, das vor ihm schwebte, etwa auf der Höhe des Scheitels eines großgewachsenen Mannes. Nein, das Gebilde schwebte nicht, es steckte auf der Spitze eines dürren, verästelten Mangrovenstamms, der schwarz glänzte und nackt war, wie ein junger, noch schwacher Baum im späten Herbst, furchtsam den harten Winter erwartend, einsam an verlassener Landstraße, umgeben von brachen Feldern.
Das Gebilde aber war tatsächlich ein Kopf, und es war der eines gewaltigen Vogels, von Menschengröße wohl, und doch fehlte ihm alles markant vogelhafte, denn dort, wo ein Schnabel hätte sein müssen, klaffte nur ein rötliches Mundloch. Ringsum lagen die blässlich grauen Federn an, feucht und glatt, und darüber glänzten die schwarzen Augen, faustgroß und von entsetzlich leerem Blick. Aus dem Schlund bleckte eine spitze Zunge – und dieses scheußliche Etwas begann schnarrend in einer Sprache zu reden, die ich nie zuvor gehört hatte – und die nicht von dieser Welt sein durfte, so misstönend und grauenerregend klang sie mir.
Ich vermochte nicht zu sagen, ob das Ding schon längere Zeit zu Haschim gesprochen hatte oder ich jetzt erst, da ich in den Bannkreis des Weihers getreten war, die furchtbaren Laute vernehmen konnte.
Doch ich durfte mich nicht bannen lassen von diesem schrecklichen Anblick und dem, was mir gleichermaßen Ohren und Seele marterte. Ich musste Haschim helfen, gleich, in welcher Gefahr er dort schweben mochte. Und dieser Gedanke war auch sogleich mein erstes Bedenken: Konnte ich meinen Augen trauen, bei dem, was ich da sah? Damit meine ich nicht den grotesken belebten Schädel auf dem Mangrovenstamm, sondern Haschim selbst. Dieser schien tatsächlich auf der blanken Oberfläche des Wassers zu knien, ohne um das Geringste einzusinken, wie es doch zwingend gewesen wäre, wenn sich unter der Oberfläche kein Grasflecken oder Wurzelgeflecht befunden hätte. Immerhin konnte ich erkennen, dass der Saum von Haschims Gewändern nass war – es sich also um keine Täuschung zu handeln schien, was die Beschaffenheit des Untergrunds betraf.
Oder doch? Einerlei! Ich musste Haschim aus dieser Lage retten, es konnte nicht anders sein, als dass er befreit werden musste. An einem solchen Ort, in solcher Gegenwart konnte er sich nicht freiwillig befinden!
Was sollte ich tun? Trotz meiner Einschätzung waren mir Gelände und Gegner unbekannt – ich sollte wohl besser nicht einfach heranstürmen und Haschim mit mir reißen.
Ich bemerkte ein wenig verwundert, dass ich, noch vor meinem eigentlichen Entschluss, bereits instinktiv etliche Schritte seitwärts gemacht hatte, über das Wurzeldickicht, welches den Weiher umringte. Doch das war genau die richtige Handlungsweise. Rasch, aber mit Bedacht umrundete ich den Weiher. Ich fand sicheren Tritt und Halt, und die Tonlosigkeit dieses Ortes mochte mir helfen, unbemerkt bis hinter das seltsame belebte Totem mit dem Schädel zu gelangen. Dass ich den blanken schwarzen Augen entgangen war, wollte ich glauben, eine Erklärung dafür hatte ich nicht. Das schnabellose Vogelhaupt war wohl zu sehr davon eingenommen, auf Haschim einzusprechen – oder ihn oder etwas zu beschwören – was wusste ich schon über dergleichen Dinge. Sie bekümmerten mich auch nicht, ich war froh, in diesen Momenten wieder auf meine bekannten Erfahrungen zurückgreifen zu können: das Anschleichen an den Feind und die Rettung eines Gefährten.
Ich stand nun hinter dem Pfahlstamm, sah nur den Federschädel, ohne das schrecklich missgestaltete Antlitz. Dafür konnte ich Haschim ins Gesicht blicken, der den Kopf erhoben und seine Augen auf das gerichtet hatte, was da zu ihm sprach.
Haschims Augen waren furchterregend – nicht leer und starr wie die eines Mannes unter Drogen oder in Trance, sondern unstet und irr, mit flatternden Lidern und blank und weiß, weil die Pupillen samt der Iris wechselnd nach oben, unten oder zu den Seiten verschwanden. Erschreckenderweise war sein Gesicht jedoch unbewegt, kein Muskel war verzerrt, der Mund weder verzogen noch geöffnet, wenngleich ich fast erwartet hätte, die Zähne gebleckt und die Lippen schaumbedeckt zu sehen wie bei einem Tollwütigen.
Was auch immer mit Haschim geschah, ich musste ihn aus diesem Bann befreien!
Mir blieb wohl nur eine Möglichkeit: ein direkter Angriff auf den unbekannten Gegner. Und dies mit bloßen Händen, denn ich hatte keine Waffen bei mir.
Ich sprang vor, stieß mich von den glitschigen Mangrovenwurzeln ab, so gut ich es vermochte, und setzte mit Macht über die Wasserfläche hinweg, die mich von Haschim und dem Vogeltotem trennte. Für einen Herzschlag dachte ich, dass mir dieser Sprung kaum gelungen wäre, wenn ich den Revolver und das schwere Messer am Gürtel getragen oder gar in den Händen gehalten hätte. So aber flog ich gleichsam voran, als würde ich neben der Kraft meiner Beine auch von meinem Willen getragen – die Zeit schien sich zu dehnen, und ich glaubte fast, mich nicht im Sprung, sondern tatsächlich im Flug zu befinden – als ich auch schon den Aufprall spürte, genau wie geplant!
Mit der einen Schulter stieß ich hart gegen den Mangrovenstamm mit dem Schädel darauf. Ich spürte die Erschütterung und wie sich die Wurzeln aus dem Grund lösten. Der Stamm schwankte, dass die Zweige durch die Luft peitschten und nach mir zu greifen schienen. Doch dann war ich bereits vorüber, hatte den Stamm passiert, was mir mit einer leichten Drehung des Körpers gelang – um mein zweites Ziel zu erreichen: Haschim aus dem Bann zu reißen, nachdem ich bereits den schnabellosen Kopf beiseitegestoßen hatte. Doppelt hält besser, schoss es mir durch den Sinn, und mein eigenes Lachen hallte stumm nach.
Als ich Haschim bei den Schultern ergriff, war mein Schwung aufgebraucht, doch in meinem Sturz konnte ich ihn zur Seite reißen. Wir prallten auf die Oberfläche des Weihers, und ich hätte schwören mögen, dass das Wasser mir für einen Wimpernschlag einen ungekannten Widerstand entgegenbrachte – bis wir eintauchten und die brackige Nässe aufspritzte.
Schon wollte ich mit heftigen Bewegungen der Arme und Beine ein Absinken verhindern – und zudem nach Haschim greifen, falls er denn besinnungslos wäre und zu ertrinken drohte –, doch das Wasser war seicht. Unter mir spürte ich abgesunkene Grassoden und Wurzelgeflecht, die sicher mein Gewicht und das Haschims hielten – jetzt begriff ich, dass ich dies bereits vorher unbewusst erkannt hatte und dass diese Zuversicht mich den gefährlichen Sprung ins Ungewisse hatte wagen lassen.
Ich griff dennoch nach Haschim und hob seinen Kopf an, damit er kein Wasser einatmete, als ich sah, wie er mich anblickte – mit jenen klaren Augen, die ich kannte. Er schien nicht wie aus einem Traum oder einer Trance erwacht, sondern blickte hellwach, wenngleich fragend. Wusste er nicht, was geschehen war?
Neben mir schlug der Mangrovenstamm ins Wasser und zwang mich, den Blick von Haschim zu wenden und mich gleichzeitig halb aufzurichten. Ich wollte nicht, dass der scheußliche Schädel uns nach seinem Sturz ins Wasser zu nahe kam. Ich sah mich um, erblickte das Gebilde aber nicht – es mochte versunken sein. Einerlei, es galt, diesen unheilvollen Ort zu verlassen. Ich erhob mich weiter, reichte dem noch immer verwirrt erscheinenden Haschim die Hand, als ich bemerkte, wie sich sein Blick abwandte und er an mir vorüber zum Himmel schaute. Ich wandte den Kopf und sah mit Entsetzen, warum ich den schnabellosen Schädel nirgends im Wasser gesehen hatte: Er schwebte ohne jeden Halt des Mangrovenstamms in der leeren Luft und starrte uns an – starrte mich an!
Der schnabellose Mund öffnete sich, das widerlich schimmernde rote Loch im Federschädel gab die spitze Zunge des Schlunds frei, und die ersten fremden Worte rollten schnarrend aus der Kehle, die nicht vorhanden war!
Und zu meinem nie gekannten Grauen konnte ich die Worte verstehen.
Der Schädel sprach zu mir und …
Eine Hand packte meine Schulter in hartem Griff und der Schmerz ließ die Stimme verstummen. Feste Finger zerrten mein Kinn zur Seite, zogen meinen Blick aus dem Bann der Vogelaugen. Stattdessen sah ich Haschim, aus dessen Augen Furcht sprach, aber auch Verstehen. Er war wieder ganz bei Sinnen und ich spürte ebenfalls, wie der Bann von mir abfiel und in meinem gesamten Leib ein stechendes Frösteln hinterließ.
Doch es war nicht allein ein inneres Gefühl. Mit einem Mal wurde auch die Luft um mich herum kühler, ebenso wie das Wasser um meine Stiefel. Die durchnässte Kleidung klebte klamm an mir. Es wehte kein Wind, die Mangrovenzweige bewegten sich nicht, und auch am grauen Himmel war keine Bewegung zu erkennen. Dennoch veränderte sich etwas.
Ein Wetterleuchten zuckte über den Himmel und der Widerschein glänzte weiß auf den schwarznassen Mangroven. Auf dem Wasser gleißte es grell und ich war dankbar und erleichtert, dass ich den scheußlichen Schädel in diesem Licht nicht schauen musste. Ich hatte meinen Blick auf Haschim gerichtet – in nahezu verzweifelter Frage.
Bevor Haschim antworten konnte – wenn er denn überhaupt eine Antwort wusste –, geschahen zwei unerwartete Dinge unmittelbar hintereinander. Ich hörte ein Surren über mir und dann einen dumpfen Aufprall. In meinem Kopf war ein schriller Laut, der hinter meiner Stirn entsprang und nicht zuvor durch meine Ohren gedrungen war. Am Zusammenzucken Haschims neben mir spürte ich, dass er wohl dasselbe vernommen hatte. Ich ahnte, was geschehen war – etwas hatte den Vogelschädel getroffen! Was, das war einerlei, ich wagte nicht hinzuschauen, denn hätte das scheußliche Etwas nicht hinab in den Salzsumpf stürzen müssen? Es musste noch immer dort oben schweben – und wer mochte ahnen, was nun Schreckliches geschah?
Da spritzte neben uns das Wasser auf. Wir schraken zurück, in Furcht vor dem Vogelschädel – und sahen stattdessen, wie sich eine langgestreckte Natter durch das Wasser schlängelte, das nicht allein von der Bewegung schimmerte, sondern auch vom Wetterleuchten glänzte.
Ich spannte meinen Körper, spreizte die Hände, um das gewiss giftige Tier zu packen, falls es angreifen sollte – da erkannte ich, dass es keine Schlange war, sondern ein Seil. Ein Seil, dessen uns zugewandtes Ende langsam im Wasser versank, während das andere sich im Wurzelverhau verfangen hatte, der den Weiher umgrenzte.
Woher das Seil stammte, ahnten Haschim und ich im gleichen Herzschlag – und wir ließen uns nicht länger von jenem scheußlichen Ort blenden, noch weniger von dem Wetterleuchten und auch nicht von dem grauenhaften Wesen, das wohl noch immer über uns schwebte. Bevor sich die Oberfläche des Wassers beruhigen konnte, sodass man die Spiegelung des Schädels hätte erblicken können, griffen wir gleichzeitig nach dem Ende des Seils, spürten erst einen Widerstand und dann einen Ruck – und waren mit einem Mal dem grauen Weiher entronnen!