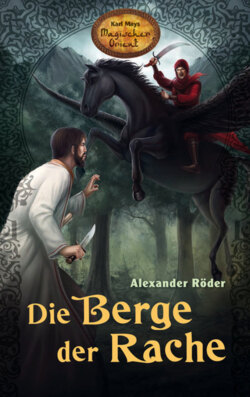Читать книгу Die Berge der Rache - Alexander Röder - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Viertes Kapitel Jenseits von Trapezunt
ОглавлениеDie „Knjas Korowjew“ lief bei morgendlichem Sonnenschein in den Hafen von Trabzon, wie das antike Trapezunt in osmanischer Zunge genannt wird. Vor den Höhen des Hausberges und der Hügel, welche die Mauern verschiedener Festungen tragen, ragten die Kuppeln und Minarette der einstigen Kirchen und neuen Moscheen auf. Doch diese Bauten sind nur steinerne Kinder im Vergleich zur Geschichte der Stadt, die zwei und ein halbes Jahrtausend zählt. Der Bildungsbürger kennt den Hafen aus der Anabasis des Xenophon, dem Bericht vom Zug der Zehntausend in den Perserkriegen. Aber ich will nicht weiter die Kriegsgeschichte referieren, die auch Skythen und Goten, Seldschuken und Mongolen als Gegner und Belagerer kennt, die ihre Spuren in Grund und Gedächtnis hinterließen. Auch die Herren der Stadt, ob Griechen, Römer, Byzantiner oder Osmanen, prägten das Bild Trapezunts ebenso wie jene Völker, die als Gäste oder Händler hier an der Küste des Schwarzen Meers eintrafen. Und alle Pracht ferner Länder kam über die Seidenstraße heran. Mit der Neuzeit erschienen dann Russen und Briten mit Botschaften und Dampfschiffen und Handelskontoren. Trabzon erblühte zu einem kleinen Istanbul, und nicht allein, weil es auch hier eine Hagia Sophia gibt – was nun wenig verwundert, denn auch Athen ist nicht die einzige griechische Stadt mit einer Akropolis. Doch was steigt, kann auch fallen und niedergehen, und nach den Kriegen zwischen Briten, Russen und Osmanen sank der Stern der Stadt, auch durch die Eröffnung der neuen See- und Landwege, durch Kanäle und Eisenbahnlinien, von welchen andere Städte profitierten. Einzig eine abscheuliche Profession florierte noch in Trabzon, und das war der Sklavenhandel. Obgleich seit zwanzig Jahren verboten, trieben sich jene, die mit den Ärmsten und Verschleppten ihre niederträchtigen Geschäfte machten, noch immer in den Gassen und Hafenanlagen herum. Deren Handelsgut waren bedauernswerte Menschen aus dem Kaukasus, Georgier und Tscherkessen, die von hier aus bis nach Ägypten verkauft wurden, an die levantinische Küste und gewiss auch nach Stambul. Alles Drohen der Staaten Europas konnte dies nicht unterbinden, weder am Schwarzen, noch am Mittelländischen, noch am Meer zwischen Arabien und Persien. Hätte ich in diesem Teil der Welt nicht eine persönliche Aufgabe zu verfolgen gehabt, ich hätte mich nur allzu gern in Kampf und Abenteuer begeben, um zumindest einigen dieser widerlichen Menschenschacherer das Handwerk zu legen – wobei es einen jeden ehrbaren Handwerker zu Recht empört, wenn man den Sklavenhandel als solches bezeichnet. Doch ich wollte nicht verzagen: Ich habe stets das, was ich an guten Taten geplant hatte, vielleicht aufgeschoben, doch niemals aufgehoben. Das Schicksal würde mich noch zu einer Gelegenheit führen, meinen Wunsch nach gerechtem Handeln erfüllen zu können. Zu diesen Zeitpunkt wusste ich es noch nicht, aber ich sollte in einigen Wochen Recht behalten und tatsächlich ein neues Abenteuer erleben, eines, das noch weit über meine schlichte Hoffnung, ein wenig Gutes zu tun, hinausführte.
Jetzt aber landeten wir in Trabzon.
Am Vorabend hatte ich mit Kapitän Rimski zu Abend gespeist, auch Bossoi, Haschim und Halef waren bei Tisch gewesen. Aus einem mir nicht ganz erfindlichen Grund glaubte der Kapitän, dass ich und meine Gefährten den Piratenangriff vereitelt und so Ungemach von Schiff, Besatzung, Passagieren und Fracht abgewendet hätten, und so wollte er sich mit einem kleinen Mahl in trauter Runde bedanken. Die Vorräte des Schiffs waren begrenzt, und doch richteten der Smutje und der Steward ein rechtschaffenes Vorspeisenbrett nach russischer Art an. Allerlei sauer und salzig Eingelegtes ordnete sich in schlichte gläserne Schalen: Gurken und Pilze und Zwiebeln und Tomaten, dazu Strömlinge und Stör, auch Würste und Käse, außerdem dunkles, ebenfalls etwas saures Brot, doch auch feines weißes, wenngleich etwas hart, und zuletzt ziemlich gesalzene Butter. Die Russen schienen zu glauben, was die Speisen über den russischen Winter haltbar machte, diente auch im orientalischen Klima – wobei ich natürlich auch um die heißen kontinentalen Sommer der Lande vor und jenseits des Urals wusste. Der Russe löscht seinen durch das SalzigSaure verschafften Durst gemeinhin mit Wasser und Weizenbrand (böse Stimmen sprechen auch von Kartoffelsprit, was jedoch nur in Notzeiten wahr ist, und von solchen sollte man keine Kulinaritäten erwarten) – doch da der Kapitän ein erfahrener und verständiger Orientfahrer war, ließ er die Wodkaflaschen verschlossen und öffnete stattdessen solche mit karbonisiertem Wasser aus dem Ort Narsan, welches die Russen „Reckenwasser“ nennen und was, ich muss es nüchtern bemerken, dann doch kaum anders mundet als Sauerbrunnen aus Selters.
Halef zog zunächst die Nase kraus, amüsierte sich dann aber über den Kitzel. Auch sprach er später seiner Schüssel Borschtsch zu, nachdem ihm alle versichert hatten, dass die rote Farbe der Suppe von roten Rüben herrührte. Ich wollte gar zu gern von der schwarzen Blutsuppe der Spartaner berichten, aber man unterband dies und bezichtigte mich halb scherzhaft einer gewissen Unsicherheit des Geschmacks bei Tischgesprächen. Immerhin konnte ich erfreuliche und gern angenommene Verbindungen zu den Krautküchen der Deutschen und Russen ziehen und die orientalischen Tischgäste durch solchen zweifachen Zuspruch auch zum Verkosten der mit Kohlstreifen gefüllten Teigtaschen bewegen. Denn so viel anders als die beliebten türkischen Strudelgebäcke sind jene Pirogen nun auch nicht.
Später raunte Halef mir fragend zu, was die Russen denn nur mit der Sauerkeit ihrer Speisen bezwecken wollten, und ob es etwas mit dem Magen oder der Mimik zu tun hätte. Ich konnte indes nur mutmaßen, dass dies ein Gegengewicht zu den Konfekten und Näschereien sei, die bei Zaren und Kulaken doch eher in orientalischer Übersüße verzehrt würden.
Auch mangels gebrannter Geister war der Abend heiter, eben der überstandenen Gefahren wegen, und nachdem der Erste Offizier Bossoi auch seinen Kautabak-Fauxpas gegenüber Haschim mit tiefem Bedauern und großzügiger Gabe aus seinem Rauchtabakvorrat feinster Herkunft wiedergutgemacht hatte, schieden wir voneinander und begaben uns zur Nacht.
Haschim hatte Bossoi ebenfalls etwas von seinem eigenen Tabak überlassen, mit der Empfehlung, ihn später bei Gelegenheit in einer europäischen oder eben doch russischen Pfeife zu rauchen, nicht in Papier gerollt oder mittels einer Nargileh. Da Bossoi wusste, dass Haschim ein Scheik und Gelehrter war, hatte er ergeben und geehrt all dies nach gehörigem Dank versprochen. Ich hatte ein amüsiertes Blinken in Haschims Auge bemerkt. Und da ich im Gegensatz zu Bossoi wusste, dass Haschim nicht nur ein Gelehrter in irdischen Dingen war, sondern eben auch in überirdischen, so fragte ich mich tatsächlich, ob dieser so edle und ehrbare Mann nicht vielleicht etwas im Sinn hatte, das ich und andere meiner Herkunft vielleicht unter dem Begriff Pennälerscherz kannten. Beim Einschlafen schwebten mir eigentümlicherweise Szenen aus den lustigen Bilderbögen des heiteren Zeichners Busch vor. Aber ich mochte auch im allmählichen Entschlummern nicht daran glauben, dass irgendwann irgendwo eine Pfeifenladung verpuffen und ein Offiziersgesicht schwärzen würde. Manchmal führt meine Kenntnis von solch vielfältigen Dingen meinen Geist an absurde Orte und zu nachgerade lächerlichen Ideen. Es mochte auch daran liegen, dass die beiden Russen, sozusagen zwischen Tür und Angel der Kapitänskajütentür, mir doch noch einen Ehrentrunk abverlangt hatten. So einen späten Schnaps bin ich nicht gewöhnt, da nutzt auch die reichliche Unterlage eines russischen Kapitänsdinners nicht. Ich fand es daher auch nicht ungewöhnlich, dass mir Halefs Schnarchen in der Koje nebenan tatsächlich so klang wie der wiederholte Name der köstlichen Rote-Rüben-Suppe.
Wir gingen von Bord, das Gepäck über den Schultern und unter den Armen. Über das stabile Fallreep nahe dem Laderaum klapperten die Hufe unserer Pferde: Rih, Risha und Halefs Ross hatten die Überfahrt ohne Blessuren überstanden und freuten sich nicht minder als wir über den festen Grund unter den Beinen, weil sie den Kopf frohgemut in den Nacken warfen und schnaubten. Mich selbst mag man für seltsam halten, aber nach der klaren salzigen Seebrise glaubte ich tatsächlich, ein wenig staubige Landluft vertragen zu können und statt eines schwankenden Decks einen wiegenden Sattel. Zudem waren mir der Trubel des Hafens, die Stimmen und der Lärm durchaus willkommen, nach dem eintönigen Rauschen des Wassers und dem Stampfen der Maschinen. Nichtsdestoweniger sah ich der Stille eines Ritts entgegen, bei dem nur das Hufschlagen und leiser Luftzug an die Ohren dringen.
Deshalb hatten wir auch beschlossen, nicht lange in Trabzon zu verweilen, sondern unseren Weg über Land rasch fortzusetzen, sobald wir uns mit Reisevorräten eingedeckt hätten.
Der russische Dampfer wurde entladen, Schauerleute schleppten polternd die Fracht über die Planken, die Ladekräne kreischten, warnende Rufe erschollen barsch. Die Passagiere hatten sich eilig, mit schwankenden Schritten, zu Karren und Kutschen begeben und schienen den Hafen, das Wasser, das Schiff fliehen zu wollen. Welche Gründe und Geschäfte sie auch nach Trabzon getrieben hatten, wer wusste dies schon; wir selbst wussten nur zu gut, was wir zu tun hatten. Ich schaute noch einmal aufs Schwarze Meer hinaus und fragte mich kurz, welchen Kurs das Schiff der Teuta wohl genommen hatte und wo ihr Gast, die Hexe Qendressa, an Land gehen würde. Ein normaler Hafen würde es kaum sein, denn sowohl in Trabzon als anderswo konnte kaum ein alter Piratensegler mit roten Segeln einlaufen, ohne Aufsehen oder gar Gegenwehr zu erregen.
Doch dies musste zunächst einerlei sein. Wir würden uns landeinwärts nach Südosten wenden, ins Gebiet der Kurden.
Als wir unsere Pferde gesattelt und bepackt hatten, sahen wir zum Ruderhaus des Schiffs empor. Dort standen Kapitän Rimski und sein Erster Offizier Bossoi, überwachten das Löschen der Ladung und beschauten den Hafen und die Stadt, welche sich zu beiden Seiten am flachen Küstenstreifen und über die Hügel dahinter erstreckte.
Unsere Blicke trafen sich, wir tauschten einen letzten, knappen Gruß aus. Bossoi nahm die Pfeife aus dem Mund, deutete darauf und tat Haschim mit gleicher Geste Bescheid, wie er mir am Abend zuvor mit dem Glas zugeprostet hatte. Haschim sandte ihm ein Lebewohl und wandte sich kaum merklich lächelnd ab. Ich wollte es zunächst ergründen, doch Halef beanspruchte meine Aufmerksamkeit, weil er in kurzer, heiterer Scharade die Arme verschränkte und die bestiefelten Füße zweimal in knappem Tritt nach vorne warf. Richtig, die russischen Matrosen hatten auf Freiwache gesungen und getanzt, kurz nach dem überstandenen oder vielmehr abgewendeten Angriff. Halef hatte dies durchaus lustig gefunden. Sein jetziges Verhalten sah ich ihm nach, auch weil das Schauspiel kurz genug währte, um nicht allzu auffällig zu sein. Aber mein lieber kleiner Freund muss eben noch an der Anwendung von Ironie arbeiten, die, wie es in ihrer Natur liegt, doch eher leise daherkommen muss. Keck schaute Halef mich an. Er wusste nach all den Jahren genau, was und wie viel er sich erlauben konnte, bis ich ihn ein wenig mahnte. Ich nickte milde. Als ich mich abwandte, glaubte ich zu bemerken, wie Haschim und Halef einen Blick wechselten, der mir seltsam vertraulich schien. Noch bevor ich weiter nachsinnen konnte, schnaufte Rih und drückte mir die Nüstern in den Nacken. Er hatte Recht: Was brauchte ich über meine Gefährten nachdenken – sie waren meine Gefährten, das war Ausgang und Ergebnis genug.
Wir stiegen in die Sättel und bahnten uns den Weg aus dem Hafen, hinein in die Gassen Trabzons. Zwischen den Festungshügeln, der dreifach unterteilten Zitadelle und den hadrianischen und byzantinischen Mauern hindurch ritten wir langsam voran. Wie überall im osmanischen Reich entstammten die Menschen hier vielen Völkern, und so wurde das Auge von vielerlei Tracht, das Ohr von vielerlei Sprache betört. Ich vernahm zum ersten Mal den Dialekt der Lazi, das Kartvelische, welches eine Kaukasussprache ist, die vornehmlich in Georgien, aber eben auch in dieser Gegend der Schwarzmeerküste gesprochen wird. Ich bin ja nun kein begeisterter Sprachwissenschaftler, sondern Reiseschriftsteller, also ein Mann, der gewissermaßen eine nüchterne Kunst betreibt. Und so mag man es für verwunderlich halten, dass ich bei den fremden Klängen tatsächlich vor meinem inneren Blick die schön gewundene Schrift des Georgischen sah, die sich wie Ranken über den Schreibgrund windet. Dieses Bild soll meinen Lesern genügen, denn obgleich das Kartvelische auch in lateinischer Schrift wie der unseren niedergeschrieben werden kann, so verlöre es doch recht viel dabei, weswegen ich hier von einer transkribierten Probe lazischer Rede absehe.
Dass ich auch Adyghisch und Kabardisch vernahm, die vorrangigen Dialekte der Zirkassier, sei nur am Rande und mit ein wenig Bitterkeit erwähnt, denn dieses Volk hat ein schlimmes Schicksal erlitten, weil es vor einigen Jahren einen erzwungenen Krieg mit dem russischen Zarenreich führte, unterlag, und aus seinen Landen des nordwestlichen Kaukasus vertrieben wurde.
All dies ließ mich recht verdrossen an die Überfahrt auf der „Knjas Korowjew“ zurückdenken. Doch was mochte der Kapitän mit der Kaukasuspolitik des Zaren zu schaffen haben? Wohl ebenso viel oder so wenig wie ich mit der Politik von Kaiser und Kanzler. Ich versuchte immerhin, in jenem kleinen Wirkungskreis, der mir beschieden war, gerecht und ehrbar zu handeln.
Meine düsteren Gedanken wurden unterbrochen von Halefs hellem Ruf, dass wir uns doch vor dem langen Ritt stärken sollten, und so hielten wir an einer Garküche, aus der appetitreizende Dünste stiegen. Ich nahm es dankbar an. Denn auch wenn der Kopf es wohl bemerkt, wenn die Füße neuen Grund betreten, so ist man doch erst so richtig an einem Ort angekommen, wenn der Magen es begriffen hat.
Wir schmausten mit Genuss, aber nicht allzu überschwänglich und zeitraubend an einer Schüssel gebratener Sardellen aus den trabzonischen Gewässern, dazu Pfannenbrot aus Mais, welches mich sehr an jenes erinnerte, das auf dem nordamerikanischen Kontinent gebacken wurde, sowie drei Näpfe mit Eintopf aus Bohnen und Kohl, ähnlich, aber doch anders als die rote Krautsuppe von nördlich des Schwarzmeeres. Ich konnte meine Gefährten amüsieren, indem ich anmerkte, dass der Name jener Fischlein, hapsi, im pontischen, also Schwarzmeerdialekt des Türkischen, tatsächlich „Mundvoll“ bedeutet, somit gleichbedeutend ist mit dem deutschen „Happen“. Auch wenn Halef durch die nebensächlichen Deutschstunden bei mir und dem Lehrer Lohse noch näher am Verständnis dieses Sprachspaßes war, vermochte Haschim diesem doch zu folgen, weil er sich des pontischen Griechisch erinnerte, in welchem die Sardelle „hapsia“ heißt. Und auch alle weniger polyglotten, vielsprachigen Zeitgenossen erkennen das treffende Schallwort. Wie schön, wenn Sprache und Schmackhaftigkeit so trefflich einhergehen.
Wir waren gesättigt und heiter, als wir mit frischem Reiseproviant und allerlei Ausrüstung auf den Packpferden Trabzon nach Südosten verließen. Wir passierten den mächtigen Hügel des Boztepe, der einst Minthrios hieß und an seinen Flanken antike Kultstätten des Mithras, byzantinische Höhlenkirchen, armenische Mönchs- und griechische Nonnenklöster beherbergt. Diesen wahrhaftig heiligen Berg ließen wir also hinter uns und begannen damit, das östliche Anatolien zu queren.
Die weiten Ebenen, Hügel, Berge und Hochplateaus wechselten im Takt der Tage. Ich muss gestehen, dass diese Reise, wenngleich zügig, doch eine entspannende Wohltat war, verglichen mit den scharfen Ritten, die wir jüngst auf dem Balkan hatten unternehmen müssen, als es galt, den Schut und seine Schergen an der Verübung ihrer Übeltaten zu hindern und an vielen Orten die gefangenen Unschuldigen zu befreien, die vom Schut zur Zwangsarbeit in seinen Fabriken versklavt worden waren.
Jetzt aber, wo die Zeit wohl ein wenig drängte, uns aber keine konkreten Schicksale die Schultern beschwerten, war es mir möglich, mich meiner Passion des Reisens hinzugeben.
Wir mieden die größeren Siedlungen und Städte, kehrten stattdessen in kleinen Orten und Gehöften ein, um zu speisen und die Nacht zu verbringen, auch kampierten wir dann und wann auf freiem Feld, in Wäldchen oder Taleinschnitten, um uns nach den Bequemlichkeiten wieder an das rohere, wildere Leben zu gewöhnen, das uns sicher bevorstand, wenn wir erst in den Kampf gegen Al-Kadir zogen.
Dennoch will ich meinen Lesern die Route ein wenig schildern, denn so sind sie es von mir gewohnt, und ich will niemanden enttäuschen, der von einem Reiseschriftsteller zurecht eine beschriebene Reise erwartet.
Nach Trabzon passierten wir Erzurum, von den Kurden Erzirom genannt, ein wenig eingezwängt zwischen der Hügelreihe, die den treffenden Namen „Kamelhals“ trägt, und den hohen Bergen des Palandöken, in welchen eine der Quellen des Euphrat entspringt.
Von all den Kriegen und Herrscherdynastien aus den Jahrhunderten Erzurums will ich nicht berichten, stattdessen aber anmerken, dass der Nationaldichter der Russen, Puschkin, diesen Ort nach einer Reise dorthin als Arzrum verewigt hat. Aber ach, eben doch in einem Bericht über den russisch-osmanischen Krieg vor einem halben Jahrhundert. Es dauert mich, aber Geschichte, selbst die der Kultur, kommt ohne Kampf und Konflikt nicht aus. Vielleicht sei etwas gefälliger vermerkt, dass Erzurum eine Kapitale der Schmuckherstellung ist, namentlich von solchem aus sogenanntem Schwarzen Bernstein.
„Oh“, sagte Halef, „das klingt aber interessant. Ist Bernstein nicht eigentlich ein Edelstein aus deiner Heimat, Sihdi? Hübsch golden gelb und glänzend? Der Schmuck der Germani, so wie es der himmelblaue Lazaward für die Afghani ist?“
„Nun, Halef“, meinte ich, „da liegst du in vielerlei Hinsicht gar nicht so falsch. Tatsächlich nennt man den Bernstein das Gold der Ostsee, und das ist ja ein Meer, welches die nordöstlichen Küsten meines Herkunftslands umspült – und den Bernstein an den Strand heran. Schön und schmückend ist dieser allemal. Für Damenhälse und für …“
„Ich habe gehört, dass er auch zum Hausbau verwendet wird, was mich sehr verwundert hat. Sind die Menschen an jenem östlichen Meer so reich, dass sie sich aus diesem Edelstein Paläste bauen, so wie es Könige und Sultane mit Gold und Marmor tun?“
„Nein, da hast du etwas missverstanden. Nicht Häuser werden aus Bernstein gebaut, sondern Zimmer. Und auch nur ein einziges. Das aber tatsächlich von einem König. Und er hat es gleich weiter verschenkt an einen anderen.“
„Wie kann man denn Zimmer verschenken, Sihdi?“, fragte Halef verblüfft.
„Das, mein Lieber, ist eines der Wunder des Abendlandes, welches ich dir später einmal berichten will. Es könnte eine längere Geschichte werden, und eine spannende noch dazu.“ Ich wackelte mit der Hand. „Aber etwas anderes ist nun wichtig: Der Bernstein ist gar kein Stein wie andere Edelsteine, sondern vielmehr das Harz von Bäumen, das aus der Urzeit herstammt und sich im Laufe der vielen Jahrtausende so verhärtet hat, dass man es als Stein bezeichnet.“
„Harz, Sihdi? Klebriger Baumsaft? Wie Mastix und Gummi? Damit schmücken sich die Damen deiner Heimat?“ Er überlegte kurz. „Und ich dachte schon daran, dass ich vielleicht doch nach Erzurum reite, um ein wenig hübschen Schmuck für Hanneh zu kaufen, wo wir schon in dieser Gegend sind, wo es eben Schmuck gibt.“
„Guter Halef, ich möchte dich als Neugierigen warnen. Nicht etwa davor, osmanischen Schmuck zu kaufen oder zum Schmuckkauf in Städte des Osmanischen Reichs zu reiten, sondern vor dem betreffendem Material. Denn wenn du es schon nicht schön findest, wenn Hanneh altes Harz um den schönen Hals trägt, dann wirst du noch mehr gegen schlichtes Holz haben.“
„Du willst mich necken, Sihdi! Erst sagst du, goldener Bernstein kommt aus Bäumen, und nun behauptest du, schwarzer Bernstein sind die Bäume selbst?“
„In der Tat. Die langen, geradezu ewigen Zeiten, die aus Harz Bernstein gemacht haben, haben aus Holz ebenso Bernstein gemacht. Oder eben doch nicht. Den schwarzen Bernstein nennt man nur fälschlich so. Unter den Gelehrten heißt er Gagat oder in anderen Sprachen Jett oder Jais. Und im Grunde ist es Kohle, die noch nicht lange genug im Boden lag.“
„Kohle“, hauchte Half entsetzt. „Ich hätte es mir denken können, bei der Farbe. Möglicherweise färbt dieser falsche Schmuck auch noch die Hälse schwarz!“
„Nun, das nicht. Man könnte versöhnlich sagen, dass diese Kohle eben leider nicht lange genug im Boden lag, sonst wäre sie zu Diamanten geworden. Auch wenn dies nicht ganz den geologischen Tatsachen entspricht. Aber einerlei: Ein BeinaheDiamant ist ebenfalls kein schönes Geschenk für eine Dame. Zudem, wozu braucht eine tapfere Kriegerin der Beduinen wie Hanneh irgendwelchen Tand?“
„Auch eine Kriegerin ist eine Frau, Sihdi. Und diese ist zudem noch die meine.“
„Da hast du wohl Recht. Und abschließend darf ich dir noch etwas erzählen, dass dich vollends von der Seltsamkeit des sogenannten schwarzen Bernsteins überzeugen wird. Die Merkwürdigkeiten gehen anscheinend auch auf Menschen über.“
„Ich bin gespannt, Sihdi!“
„Du sollst nun nicht glauben, ich sei zu einem Experten für Schmuck oder hübsche Steine geworden, ich gebe hier nur eine Posse wieder, von welcher der französische Kaufmann Galingré während unseres jüngsten Zusammentreffens in Skutari erzählt hat. Also …“
Und ich erzählte, in etwas anderen Worten für meinen Halef; meinen Leser gebe ich es wie folgt wieder: Es ging um einen wiederum französischen Preziosenhändler namens Jean Jais, der, nomen est omen, sich auf Trauerschmuck aus Gagat spezialisiert hatte. Wann immer also eine trauernde Witwe zu ihm kam, um etwas dezentes Geschmeide für das schwarze Kleid zu erwerben, verabschiedete er sie nach getätigtem Geschäft mit den Worten: „J’ aime le Rocambole.“ Ich wusste nun, dass es sich bei diesem Rocambole um einen zweifelhaften Charakter aus einer Serie von Sensationsromanen des französischen Schreibers Pierre Ponson du Terrail handelte, welcher sich, obgleich von Adel, auf das Verfassen von Schauernovellen und erdachten Abenteuern verlegt hatte. Was aber die Murmeleien des Schmuckhändlers damit zu tun hatten, erschloss sich mir nicht. Selbst Galingré musste zugeben: „Ils sont fou les français.“ Dieser Seitenhieb auf die geistige Gesundheit seiner ehemaligen Landsleute fiel ihm, dem erfolgreichen Auswanderer nach Albanien, natürlich leicht.
Halef hatte aufmerksam gelauscht, mehr und mehr die Stirn gerunzelt, und als ich geendet hatte, atmete er tief durch.
„Ich verstehe diese Geschichte nicht“, vermeldete er knapp.
„Ich auch nicht, Halef. Das ist ja das Kuriose daran.“
„O Sihdi. Was du so alles erzählst. Nun, vielleicht können sich deine Leser später einen Reim darauf machen, wie man bei euereins so schön sagt. Ich reite jetzt zu Scheik Haschim hinüber. Vielleicht kennt der eine richtig lustige Geschichte.“
Das tat Halef dann. Ich glaube aber nicht, dass Haschim eine solche Geschichte, wie Halef sie sich wünschte, parat hatte, oder wenn, sie überhaupt erzählen wollte.
Ich selbst hatte nun Zeit darüber nachzudenken, was Leute so alles von sich geben, wenn man lange am Schreibtisch oder eben im Sattel sitzt.
Wir kamen zu den südöstlichen Ausläufern des Taurusgebirges, den Ketten des Bingöl und des Bilican. Die Flüsse Murat und Karasu haben hier ihre Täler in den Grund geschnitten, und die hohen Berge und Plateaus wirken durch diese noch steiler und schroffer. Der mächtige Gipfel des Süphan ist dem See von Van nicht fern, und ein jeder, der dieses Land beschaut, ist nicht wenig ergriffen von diesen Extremen der Natur.
In der Provinz Muş lag die gleichnamige Stadt Mûs, oder auch umgekehrt, denn der türkische und der kurdische Namen unterscheiden sich nur durch jene Buchstabenornamente, die den Sprachforscher so entzücken. Den Völkerkundler hingegen bewegt, dass sich hier neben Türken und Kurden auch viele Armenier finden und dass jede Volksgruppe ihre Kirchen und Moscheen besitzt. Deren Türme und Minarette sahen wir, wie es unserer eingeschlagenen Reiseroute entsprach, jedoch nur von Ferne. Der bereits erwähnte Xenophon war einst in dieser Gegend, der ebenso erwähnte Puschkin nicht.
Schließlich trafen wir auf den Fluss Bitlis und folgten seinem Lauf, denn sein schmales Tal ist die einzige Passage durch den Taurus, zwischen den Niederungen des Sees von Van und der Ebene von Diyarbakir. Von Ferne drohte der erloschene Vulkan Nemrut, der an seinem Gipfel einen Kratersee trägt, gewissermaßen ein Gebirgszwilling des Van. Dieser Kegelberg trägt seinen Namen wegen einer Legende um den vorbiblischen Jäger Nimrod, doch so wie dieser in der Ferne der Zeit verschwunden ist, hat sich der Vulkan zum letzten Mal vor drei Jahrhunderten leise gerührt. Es möge so bleiben. Denn Gutes genug haben die früheren Eruptionen getan: Die Ebene vor dem einst feurigen Berg ist fruchtbar, und so ziehen sich weite Felder vor dem ragenden Gipfel dahin.
Die Stadt Bitlis umgingen wir, mochte auch deren Historie locken, die bis in die Zeit der Assyrer zurückreicht. Noch interessanter ist aber die jüngere Geschichte, welche der reisende Dichter Evliya Çelebi vor zweihundert Jahren in seinem Seyahatnâme, dem also schlicht ‚Reisebuch‘ genannten Bericht, beschrieben hat. Diesen Text kannte ich sowohl im originalen Wortlaut wie auch in der Übersetzung des geschätzten Orientalisten von Hammer-Purgstall, und besonders die Passagen über den kurdischen Fürsten Abdal Han, der sowohl dem osmanischen Sultan wie auch dem persischen Schah die Stirn geboten hatte, waren mir als sehr beeindruckend in Erinnerung geblieben. Vor allem, weil jener Abdal eben, um im Bilde zu bleiben, kein breit- oder engstirniger Herrscher war, der sich den fremden Potentaten der großen, mächtigen Reiche ringsum aus schlichtem Trotz nicht beugen wollte. Nein, diesem Fürsten lag schlicht sein Volk am Herzen, und er war darüber hinaus ein kluger und gelehrter Mann.
Tatsächlich griff Haschim diesen Punkt auf.
„Kara Ben Nemsi, Ihr kennt den Beinamen Abdals, zumindest jenen, den Çelebi ihm nicht von ungefähr gab?“
„Gewiss. Çelebi nannte Abdal Han den Hazarfann, den Mann der Tausend Künste.“
„Da Ihr von vielen Künsten wisst, vor allem den sieben freien Künsten des Abendlandes …“
Ich zählte an den Fingern ab: „Grammatik, Rhetorik, Logik – das Trivium. Arithmetik Geometrie, Musik, Astronomie – das Quadrivium.“
„Sehr gut“, nickte Haschim in einem angenehm wohlwollenden Tonfall, sodass ich gar nicht verstand, warum Halef gut hörbar in sich hineinkicherte.
„Aber“, begann Haschim, „auch wenn wir all die Künste hinzuziehen, die seitdem hinzukamen …“
„Nun, auch neben den septem artes gab es ja bereits die Theologie, Jura, Medizin und vieles mehr, wenn auch nicht im heutigen Verständnis.“
„Und wer sie denn alle zählen wollte, würden dem nicht immer noch einige fehlen, bis zu den besagten tausend Künsten des Abdal Han …?“
„Worauf wollt Ihr hinaus …?“, wollte ich fragen, doch dann hatte ich begriffen und begegnete Haschims leisem, weisem Lächeln mit einem kleinen Seufzer und einem Heben und Senken der Schultern, das mir zu einem Strecken und Recken im Sattel wurde. Dann wurde ich ein wenig spitzfindig, zwar wohl auf freundliche Art, doch ich musste dieser meiner Empfindung, meiner immer noch vorhandenen Skepsis gegenüber allem, was vorgeblich magisch und zaubersam daherkam, Luft machen.
„Aber Haschim“, meinte ich also, „Ihr wollt doch nicht einem Reiseschriftsteller glauben, der vielleicht nur aus Gründen des Interessantmachens in seine Worte gewisse Doppelbedeutungen legt, um seine Leser zum Sinnieren, gar Phantasieren zu bringen …“
Haschim zwinkerte mir zu, eine kokette Mimik, die ich von ihm noch nicht kannte.
„Abgesehen davon, dass ich es schätze, wie Ihr mit Worten über einen anderen gleichsam Euch selbst erkennen mögt, ganz gemäß dem Hellenenwort, so möchte ich doch anmerken: Warum sollte allein Çelebi den Abdal Han als so kunstreichen Mann bezeichnet haben?“
„Nun man kann ihn nicht mehr befragen. Beide nicht.“
„Befragen kann man wohl.“
„Ja, andere Schriften.“
„Nicht allein: auch Menschen, die Abdal Han kannten.“
„Diese dürften nach zweihundert Jahren allerdings recht alt sein.“
„Sehr alt. Älter als mancher meint.“
Ich musterte Haschim und dann begriff ich erneut.
„Marah Durimeh.“
„Wer weiß …“, sagte Haschim und lächelte. Ach, wie sehr ich doch meinen lieben Halef schätze, der sein Herz auf der Zunge trägt und aus nichts ein Geheimnis macht, selbst wenn es ein offenes sein mag.
Man spürte, dass unser Weg uns nun immer weiter vom eigentlichen Land der Türken hinab ins Zweistromland führte, und damit in biblische Gefilde. Der Euphrat und der Tigris hatten bereits schiffbare Ausmaße erreicht, lagen aber hier, in der Nähe der Stadt Cizre, so weit auseinander wie sonst nie in ihrem Doppellauf. Die Kurden nennen den Ort Cizir, die Araber Dschasirat, was jedoch nicht mit der Ebene im Zweistromland verwechselt werden sollte, welche man Al-Dschasira nennt oder eben Dschesireh. Wir waren dennoch recht nahe an den Weidegründen der Haddedihn, und Halef packte ein wenig die Sehnsucht. Aber da die Beduinen eben in diesem Gebiet umherziehen und selbiges wiederum sehr weit in den Westen reicht, wäre es wohl ein allzu großer Zufall gewesen, wenn wir Halefs Familie tatsächlich hätten einen kurzen Besuch abstatten können, ohne allzu lange zu suchen und Zeit zu verlieren. Dies alles würde warten müssen.
Am Rande des Landes um Cizir erhebt sich der Berg Cudi, von dem es heißt, hier sei die Arche des Noah gelandet, nachdem die Wasser der großen Flut sich zurückgezogen hatten. Allerdings gilt dies nur nach islamischer Tradition, die christliche verortet die Landungsstelle auf dem Berg Ararat, welcher viel weiter westlich, am anderen Ende Kleinasiens, sich erhebt. Es mag ohnehin nicht von Belang sein, wie es einst wirklich war, einzig die Stimmung, welche diese Lande hervorrufen, ist tatsächlich wahr und wahrhaftig, nahezu mit Händen zu greifen.
Doch es ist eben nicht nur die biblische Geschichte, die hier Erinnerungen hervorruft. Es ist auch meine eigene. Als wir östlich unserer Reiseroute den Stadthügel von Amadijah ausmachten, entsann ich mich meiner zwei Jahre zurückliegenden Erlebnisse. Halef, Sir David und ich hatten dort mit Mohammed Emin, dem Scheik der Haddedihn, dessen entführten Sohn Amad el Ghandur befreit. Auch traf ich dort zum ersten Mal auf Marah Durimeh. Nun würden wir sie gewiss nicht dort finden, weshalb wir Amadijah ebenso ohne Besuch passierten wie die Festung Kalah Gumri, die in einiger Entfernung über dem gleichnamigen Dorf thronte. Dort waren wir einst allesamt gefangen gesetzt worden, auf Befehl des Bey von Gumri, dem Anführer der Kurden von Berwari, und des Sohns von Abd el Summit Bey. Meine Leser kennen diese Ereignisse und erinnern sich so gewiss daran wie ich, obgleich sie jene nur aus meinen Berichten kennen, während ich sie eben selbst erlebt und teils erlitten habe und meine Freunde und Gefährten mit mir.
Doch nun war nicht die Zeit für kämpferische Nostalgie oder alte Geschichten, wir mussten voran. Und so passierten wir Mossul, ohne dass Halef und ich untereinander auch nur die Namen des damaligen Makredsch und des damaligen Paschas erwähnten, mit denen wir Händel hatten. Wir wollten auch Haschim nicht mit dergleichen belästigen, denn was war unser Streit mit jenen Provinzherrschern und Festungskommandanten schon gegen den bevorstehenden Kampf gegen den finsteren Magier Al-Kadir im Geisterreich! Tatsächlich waren dies bei all meiner Skepsis meine Gedanken. Ich konnte mich nicht erwehren, diese mir fremde Herausforderung als bedrohlich und unheilvoll zu verspüren. Ich konnte nicht wissen, was mich, was uns erwarten würde, und es war mir auch nicht gegeben, es mit früheren Erlebnissen zu vergleichen. Ich musste mir eingestehen, dass ich in die ersten Duelle mit Al-Kadir ungläubig, fast unbedarft hineingegangen war. Und dass meine alten Feinde, der Schut, der Mübarek und Hamd el-Amasat, wiederauferstanden waren, verändert und mit Zauber und Magie versehen, damit wirkten und ihr Unwesen trieben – dies hatte mich auch nur zum Teil auf jene fremde, befremdliche Welt vorbereitet. Jetzt aber wusste ich einiges und ahnte noch mehr, obgleich auf sehr unvertrautem Gedankengrund. Ich war froh, Haschim an meiner Seite zu haben, aus dessen Wesen und Kenntnis ich Vertrauen schöpfen konnte, vielleicht gar Hoffnung. Und die Aussicht, zudem die weise Marah Durimeh zu treffen und um Beistand und Rat bitten zu können, ließ mich ebenfalls zuversichtlich sein.
Und diesem Ziel näherten wir uns nun, zumindest was den Ort betraf.
Zwischen Mossul und Erbil, auf Kurdisch Hewler, welches die vielleicht älteste Stadt der Menschheit sein mag, weil dort laut Forschermeinung seit acht Jahrtausenden stets gesiedelt wurde, fließt der Strom des Großen Zab, der sich durch sein breites Tal wälzt, umgeben von den Höhen voller Eichen und Walnusswälder. Dessen Wasserlauf querten wir, um uns weiter nach Süden zum Bruderstrom des Kleinen Zab zu wenden, und damit in die Gegend von Lizan und Schohrd, zwei kleinen Orten, eher Dörfern nur, die jedoch die Stammsitze von einigen Menschen waren, die uns vor zwei Jahresläufen sehr nahe gestanden hatten. In Lizan, welches wir zunächst erreichen würden, waren dies vor allem der Melek von Lizan, also das Oberhaupt der Siedlung und seiner Bewohner, die nestorianische Kurden waren, wie auch Schakara, die Tochter des Gallapfelhändlers. Die Geschichten, welche uns mit diesen beiden verbanden, waren so unterschiedlich wie die Personen selbst und wiederum von solch Gegensätzen wie Liebreiz und Schauder als auch Feindschaft und Respekt geprägt. Diese Vielfalt von Gefühlen ergriff mich auch jetzt, als die erneute Begegnung nach langer Zeit bevorstand.
Wir kamen also von den bewaldeten Höhen hinab ins Tal des kleinen Zab und erwarteten, an besagter Stelle das vertraute Dorf Lizan zu erblicken – doch es war nicht mehr!