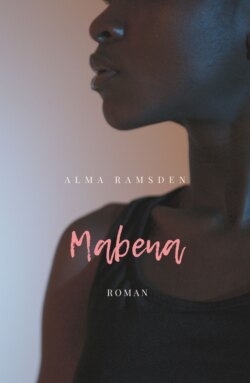Читать книгу Mabena - Alma Ramsden - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 5
Am Sonntag machte ich mich, wie geplant, auf nach Protea Glen, um den Gottesdienst zu besuchen. Fred lieferte mich pünktlich ab, und auf mein Drängen hin begleitete er mich auch in die Kirche.
Beim Eintreten richteten sich alle Blicke auf uns, und sofort fühlte ich mich verunsichert, wie immer, wenn ich im Mittelpunkt stand. Nachdem uns der Pastor an der Türe begrüßt hatte – er äußerte seine Freude darüber, mich zu sehen, erwähnte aber mit keinem Wort unser Gespräch von letzter Woche – setzten wir uns schnell in eine der hinteren Reihen. Während des Gottesdienstes versuchte ich angestrengt, nicht mit den Gedanken abzuschweifen, was mir nur halbwegs gelang. Ich hatte Gerda nirgends sehen können in der großen Gemeinde, was mich zutiefst enttäuschte, obwohl ich es nicht ernsthaft erwartet hatte. Aber ich wollte nicht aufgeben. Nach der Predigt würde ich versuchen, mit einzelnen Mitgliedern der Gemeinde zu sprechen. Es war immerhin möglich, dass Gerda in diese Kirche ging, aber aus den unterschiedlichsten Gründen heute nicht hier sein konnte.
Der Kontakt zu den Gemeindemitgliedern wurde mir dadurch erleichtert, dass es nach dem offiziellen Gottesdienst ein informelles Beisammensein gab, bei dem Tee und Kuchen angeboten wurde. Der Pastor, der es sich zu Beginn des Gottesdienstes nicht hatte nehmen lassen, mich vor versammelter Menge in der Gemeinde willkommen zu heißen, lud mich ausdrücklich zu diesem Treffen ein, das, so vermutete ich, unter anderem dazu diente, neue Mitglieder in die Kirche einzubinden; ich fühlte mich wie ein Insekt, das dem Netz der Spinne zu nahe gekommen war. Fred verließ mich bei diesem informellen Teil, eine vage Ausrede murmelnd. Fred wollte hier wohl eine Grenze ziehen. Er gehörte einer anderen Kirche an und wollte auch für einen gut bezahlten Job nicht am gemütlichen Beisammensein einer Kirche teilnehmen, in der er sich fremd fühlte.
Der Pastor gesellte sich zu mir und stellte mich den umstehenden Mitgliedern der Gemeinde vor. Während sich die Männer eher zurückhaltend gaben, hielten die Frauen ihre Neugier nicht versteckt: Sie hießen mich herzlich willkommen, fragten mich ganz unverblümt aus und betonten dabei immer wieder, wie wunderbar ihre Kirche sei. Ich fühlte mich etwas in die Enge getrieben, gab zur Antwort, dass ich noch auf der Suche nach dem wahren Glauben sei, aber generell Interesse an Glaubensfragen hätte. Den Frauen zu gestehen, dass ich schon seit vielen Jahren überzeugte Atheistin war, dazu hatte ich nicht das Herz. Abgesehen davon wäre es taktisch nicht klug gewesen.
Erst nach einer Zeit, die mir wie eine halbe Ewigkeit vorkam, gelang es mir, auf Gerda zu sprechen zu kommen. „Eine gute Freundin von mir geht in diese Kirche. Sie heißt Gerda. Leider scheint sie heute nicht hier zu sein. Sehr schade, ich habe sie lange nicht mehr gesehen.“
Ich zeigte den Frauen ihr Foto, in der Hoffnung, jemand möge sie erkennen. Die Frauen reichten das Foto in der Gruppe herum, die sich um mich geschart hatte, schüttelten aber nur den Kopf. Keine kannte sie. Das Foto wurde weiter gereicht an eine andere Gruppe von Frauen, mit denen ich noch nicht gesprochen hatte.
Eine ältere Dame aus dieser Gruppe schaute sich das Bild eine Weile eingehend an und sagte dann stirnrunzelnd: „Ich glaube, ich kenne das Mädchen.“
Die Nachricht traf mich wie ein Fausthieb, vor Aufregung wurde mir fast schlecht. Ich hatte überhaupt nicht mehr damit gerechnet.
„Wirklich? Woher?“, fragte ich. „Durch die Kirche?“
„Nein, nein. Ich kenne sie durch meine Enkelin.“ Die Frau machte ein trauriges Gesicht bei diesen Worten. Zudem wirkte sie nervös. Doch in meiner Aufregung machte ich mir nicht die Mühe, darauf einzugehen.
„Weißt du, wo sie wohnt?“
Die Dame schüttelte den Kopf, übergab mir das Foto wieder. „Nein, ich habe sie nur einmal gesehen. Und das ist eine Weile her. Sie war ein ruhiges, verschlossenes Mädchen. Ich habe nicht viel über sie erfahren. Ein bisschen überheblich war sie, um ehrlich zu sein.“
Meine Aufregung stieg. Das hörte sich sehr nach Gerda an. Ruhig, verschlossen, ein bisschen überheblich, so hatte man sie auch im Checkers geschildert, und so hatte ich sie in Erinnerung. „Du würdest mir sehr helfen, wenn du mir alles über das Mädchen sagen würdest, was du weißt. Sie ist eine gute Freundin von mir, und ich habe sehr gehofft, sie heute hier anzutreffen.“
„Ich weiß nichts über dieses Mädchen.“ Der Ton der Dame war plötzlich scharf, ihre Augen blickten mich misstrauisch an, ihr Gesicht war voller Trauer. „Meine Enkelin kannte sie. Ich habe sie, wie gesagt, nur einmal gesehen.“
„Kann ich mit deiner Enkeltochter sprechen? Das würde mir sehr, sehr helfen.“
„Nein, Sisiix“, mischte sich nun eine der anderen Frauen ein, „das ist nicht möglich. Sie ist tot.“
Erst da reagierte ich voller Schuldgefühle auf das traurige Gesicht der älteren Dame. „Es tut mir so leid“, murmelte ich. Ich sollte diese Frau nicht weiter behelligen. Doch ich wollte so vieles wissen: War die Verstorbene eine gute Freundin von Gerda gewesen? Wusste ihre Großmutter etwas über Gerda, das ich nicht wusste? Doch in Anbetracht der Trauer der Großmutter über ihre verstorbene Enkelin traute ich mich nicht, ihr diese Fragen zu stellen.
„Wie ist sie denn gestorben, deine Enkelin?“, fragte ich stattdessen, im Bewusstsein, dass diese Frage taktlos war.
Die Dame, die plötzlich einige Jahre älter wirkte, antwortete nicht. Und ich wagte nicht nachzuhaken.
Gerda ist auf dem Weg nach Hause nach einem langen Tag. Sie hat mit dieser neuen Stelle wirklich Glück gehabt, und das Leben ist leichter geworden. Dennoch ist sie oft müde abends. Sich jetzt noch hinter die Bücher zu setzen, scheint ihr fast unmöglich. Es ist kurz nach acht Uhr. Der Winter ist hart, nicht nur wegen der nächtlichen Kälte, sondern auch wegen der früher einsetzenden Dunkelheit, die das Leben in einem vielerorts schlecht beleuchteten Township sehr kompliziert macht; seit über zwei Stunden ist es dunkel.
Auf einmal hört sie etwas. Sie kann nicht einordnen, was für ein Geräusch es ist, ob es von einem Menschen stammt oder von einem Tier – oder gar von etwas Übersinnlichem? Sie geht weiter, und da hört sie es wieder, lauter. Es kommt aus den Büschen weiter hinten, und sie ist sich nun sicher, dass es ein Tier ist, das sich verletzt hat. Einer der streunenden Hunde.
Oder aber es ist ein verletzter Mensch.
Noch einmal hört sie das Geräusch. Gerda zögert. Soll sie nachsehen? Wenn es ein Mensch ist, kann es für sie gefährlich werden. Die Angreifer sind vielleicht noch in der Nähe. In solche Dinge möchte sie nicht hineingezogen werden. Besser weitergehen und so tun, als habe sie nichts gehört. Aber kann sie das? Sie ringt innerlich mit sich. Furcht und Neugierde wechseln sich ab, doch schließlich siegt ihre innere Überzeugung, dass sie einfach nachsehen muss. Vielleicht kann sie noch etwas tun für das Wesen, das dort liegt.
Sie geht auf das Gebüsch zu und schaut hindurch. Was sie sieht, lässt sie schaudern. Sie weiß, dass sie schreien und wegrennen, dass sie Hilfe suchen muss. Doch noch bevor der Hilfeschrei aus ihrer Kehle kommt, fasst sie einen Entschluss: Sie kann so wie jetzt nicht weiterleben. Auch sie wird eines Tages sterben. Und wozu hat sie dann gelebt? Das Leben ist zu kurz, um auf Liebe und Geborgenheit zu verzichten. Sie muss leben. Und sie besiegelt mit diesem Entschluss nicht nur ihr eigenes Schicksal, sondern auch Janices Tod, denn alles, was auf diese Gedanken folgt, führt unweigerlich darauf zu.
Ich musste lange auf Fred warten, der entweder die Zeit vergessen hatte oder annahm, ich würde für längere Zeit in der Kirche verweilen. Ich setzte mich vor der Kirche in die Sonne, nachdem auch die letzten Mitglieder sich auf den Weg nach Hause gemacht hatten, und hing meinen Gedanken nach.
Es war warm heute, und nach der traurigen Begegnung tat es mir gut, die Sonnenstrahlen auf meiner Haut zu spüren, mich zu erinnern, dass es Wärme gab – und Leute wie Andrea, Lena und Fred, dessen Loyalität ich inzwischen nicht mehr bezweifelte. Ich hörte das Lachen und die Schreie von spielenden Kindern und fragte mich, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich Kinder gekriegt hätte, wäre ich bei Simon geblieben und hätte ich unsere Ehe und ihre Krisen ausgehalten, wie viele aufopfernde Ehefrauen und Mütter es taten? Eines war sicher: Ich wäre nie nach Johannesburg gekommen, um eine junge Frau zu suchen, die mir einst so viel bedeutet hatte. Eine junge Frau, aus bitterer Armut stammend, die sich mit einem Stipendium an der Universität durchgeschlagen, in Haushalten geputzt und im Checkers an der Kasse gearbeitet hatte, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Und trotzdem hatte sie noch Zeit gefunden, sich für andere einzusetzen.
Und ich? Ich hatte in all den Monaten die Schatten an der Wand beobachtet, auf die wenigen Stunden wartend, die Gerda bei mir sein würde, und auf auf die seltenen Abende bei Andrea. Ich war abhängig geworden von zwei Frauen, die alles waren, was ich nicht war. Frauen, die wussten, was sie wollten, und ihren eigenen Weg gingen. Und während ich so in der Sonne saß und meinen Gedanken nachhing, begriff ich auf einmal: Meine Trennung von Simon und die Suche nach Gerda waren meine Art, es ihnen gleichzutun.
Und plötzlich hielt ich es nicht mehr aus, dieses untätige Rumsitzen. Ich musste etwas tun. Ich musste einfach alles daransetzen, Gerda zu finden. Ich holte die Liste mit den Namen und Telefonnummern der Waisenheime hervor, die ich im Internet gefunden hatte. Ich rief die dritte Organisation auf der Liste an – die zweite, deren Nummer nicht mehr existierte, hatte ich schon abgehakt –, und es nahm tatsächlich jemand das Telefon ab. Ich tischte der Frau, deren Namen ich nicht verstanden hatte, irgendeine Lüge über meine Identität auf und bat dann, mit Gerda verbunden zu werden.
„Gerda? Bei uns arbeitet keine Gerda.“
„Bist du sicher?“, fragte ich unschuldig. „Sie ist eine Studentin, die ab und zu in eurem Waisenheim arbeitet. Sie hat mir gesagt, dass sie heute bei euch sei.“
„Eine Studentin? Bei uns arbeiten keine Studenten. Zudem ist Sonntag, am Sonntag bin nur ich hier bei den Kindern.“
„Aber ihr seid doch Teil des Wits Netzwerkes.“ Ein Schuss ins Blaue.
„Nein, das sind wir nicht. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Wir sind ein Team mit drei Personen, und keine von uns heißt Gerda.“
„Tut mir leid. Dann habe ich wohl die falsche Nummer gewählt.“
„Vermutlich. Kein Problem.“
Meine vertraute Frustration kehrte zurück. Sollte ich nun wirklich alle Nummern auf der Liste anrufen, in der Hoffnung, auf das Heim zu stoßen, in dem Gerda gearbeitet hatte? Jeder andere Mensch in meiner Situation, so war ich überzeugt, hätte dies ganz selbstverständlich getan. Aber ich nicht. Die Lethargie, die ich in Simons Schatten lebend entwickelt hatte, war schwer zu überwinden.
Ich hatte nicht auf Simons Mutter gehört. Ich hatte nie etwas Nützliches getan in all den Jahren an seiner Seite, mir keine eigene Existenz aufgebaut, mein Selbstbewusstsein hatte mehr und mehr abgenommen. Als Konsequenz davon saß die Angst, enttäuscht zu werden, mich lächerlich zu machen, tief.
Einen kurzen Moment lang hielten die Frustration und die negativen Gedanken an. Doch dann siegte der Wille, Gerda zu finden, und ich überwand meinen inneren Schweinehund. Entschlossen wählte ich die Nummer der ersten Institution, bei der beim letzten Versuch niemand rangegangen war. Diesmal wurde das Telefon abgenommen. Ich erzählte meine Lügen und fragte nach Gerda. Erfolglos.
Ich wählte die nächste Nummer. Und die nächste. Den ganzen Sonntagnachmittag und den darauffolgenden Tag verbrachte ich damit, die Nummern auf meiner Liste anzurufen, manchmal mehrere Male, weil niemand ranging oder ein Anrufbeantworter eingeschaltet war – mit dem festen Vorsatz, nicht aufzugeben, bis ich alle Nummern erreicht hatte.