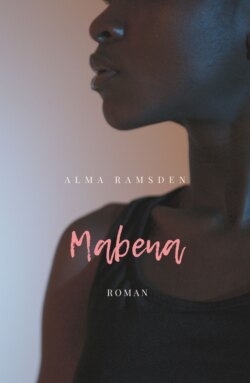Читать книгу Mabena - Alma Ramsden - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 3
Am nächsten Tag fiel mir das Aufstehen schwer. Wie früher, wenn ich bei Andrea und ihrer Familie gewesen war, fühlte ich mich so geborgen wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Danach wieder alleine zu sein, war, wie aus dem warmen, gemütlichen Chalet, das ich von den Winterferien in meiner Heimat kannte, in die eiskalte Nachtluft hinauszutreten. Ich wollte den Schlaf verlängern und weiter die Geborgenheit des gestrigen Abends spüren.
Aber schlussendlich trieben mich die Gedanken an Gerda doch aus dem Bett. Gerda, wo bist du, und wie werde ich dich jemals finden?
Immerhin hatte ich gestern Abend ein Problem gelöst: Ich hatte einen Begleiter für meine Mission gefunden. Andreas Pförtner hatte einen Bruder, der gerade arbeitslos war und sich der Aufgabe mit Freude annehmen würde. Ich kannte ihn nicht, doch das spielte keine Rolle. Nicht in erster Linie seine Anstellung, sondern die feste Anstellung seines Bruders hing nun von seinem tadellosen Verhalten mir gegenüber ab; das war eine bessere Voraussetzung als jedes Einstellungsgespräch.
Fred, so hieß Lukas‘ Bruder, hatte versprochen, um zehn Uhr in der Hotellobby auf mich zu warten. Dies gab mir Zeit, in Ruhe zu frühstücken, mich von meinem kleinen Kater zu erholen und mir auszurechnen, wie lange ich es mir noch würde leisten können, in diesem komfortablen 4-Sterne-Hotel zu wohnen. Ich kam zum Schluss: nicht sehr lange. Je früher ich also eine andere Unterkunft fand, desto besser.
Pünktlich um zehn Uhr stand Fred in der Lobby. Lukas hatte ihn gestern trotz später Stunde noch angerufen und ihn gebeten, sich heute bei mir vorzustellen. Ich nahm ihn mit in eines der vom Hotel bereitgestellten Sitzungszimmer, um ihm seinen Auftrag zu erklären.
Andrea hatte ich nicht offenbart, wozu ich Freds Dienste benötigte, und sie war diskret genug gewesen, nicht nachzufragen. Da ich nicht nur ihre Freundin, sondern auch die Frau ihres besten Freundes war, hatte es in der Vergangenheit häufig Situationen gegeben, in denen wir einander nicht alles mitgeteilt hatten. Es war ein ungeschriebenes Gesetz zwischen uns, dass wir uns nicht auf Dinge ansprachen, die die andere nicht von sich aus offenlegte. Fred hingegen erklärte ich, während ich ihm meine Visitenkarte hinhielt:
„Ich möchte eine junge Frau namens Gerda finden, und ich bin auf deine Diskretion angewiesen – auch und ganz besonders gegenüber Andrea und Lukas.“
Ich wusste nicht, ob ich ihm in dieser Hinsicht vertrauen konnte, aber da ich keine Wahl hatte, beschloss ich, mir darüber zunächst keine Gedanken zu machen.
Vertrauen hin oder her – ich schien mit Fred echt Glück zu haben. Er wirkte kompetent, war höflich und zurückhaltend, und der Gedanke, für eine Privatdetektivin zu arbeiten, schien ihn zu begeistern.
Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, erklärte ich ihm, dass wir nun als Erstes zum Checkers in Cresta, ein Einkaufszentrum im gleichnamigen Stadtteil im Norden Johannesburgs, fahren würden.
„Sprich dort mit den Angestellten. Sag ihnen, dass du nach Gerda suchst. Sie hat vor über zwei Jahren dort gearbeitet. Hier ist ein Foto von ihr, das du ihnen zeigen kannst. Ich kenne ihren Nachnamen nicht, und wenn du einfach nach Gerda fragst, bist du vermutlich nicht sehr erfolgreich. Sage ihnen, du bist ihr Onkel – oder was auch immer –, und versuche, etwas, egal was, über Gerda zu erfahren. Danach fahren wir nach Soweto.“
Ich sagte bewusst „wir“, um ihm zu signalisieren: Von jetzt an waren wir ein Team.
Wir fuhren also nach Cresta. Ich hatte Fred gerne das Steuer überlassen und saß auf dem Beifahrersitz. Die Konversation verlief sehr entspannt, obwohl wir uns noch keine zwei Stunden kannten. Ich fühlte, wie meine anfängliche Anspannung wich, ich fühlte mich geborgen.
Im Einkaufszentrum Cresta ging ich einen Kaffee trinken, während Fred ins Checkers loszog. Es war besser, man sah uns nicht zusammen, während er seine Nachforschungen anstellte; ich hatte Angst, es könnte die Leute im Laden misstrauisch machen. Ich schlürfte einen Cappuccino und las ein Wirtschaftsmagazin, bekam aber wenig mit von den Artikeln, die ich überflog; meine Gedanken waren bei Fred und seinen Ermittlungen.
Nach knapp einer Stunde kam er zurück. Ich lud ihn zu einem Kaffee ein, doch er lehnte ab. Ich insistierte nicht, da ich merkte, dass er sich unwohl fühlte in diesem schicken Café, in dem vor allem weiße, gutbetuchte Frauen mittleren Alters saßen und wie ich an ihren Cappuccinos nippten. Darum gab ich vor, hungrig zu sein, und wir gingen zusammen in einen KFC. Dort ließ er sich gerne einladen. Wir aßen einen Hähnchen-Burger, während er mir von seinen Nachforschungen erzählte.
„Ich habe versucht, mit möglichst vielen Angestellten vom Checkers zu sprechen“, erzählte er mir. „Doch es war sehr schwierig, weil diese während der Arbeitszeit nicht einfach Pause machen dürfen, um zu schwatzen. Ich habe mich als Kunde ausgegeben,“ – an dieser Stelle lächelte er verschmitzt – „damit die Gespräche wie Konversationen zwischen Angestellten und einem Kunden, der Beratung benötigt, aussehen. Um ihnen keinen Ärger zu bereiten.“
Ich nickte anerkennend. Fred schien ideal für diese Art von Aufgabe zu sein.
„Von den wenigen Leuten, mit denen ich sprechen konnte, hat sich nur eine Dame an Gerda erinnert. Sie arbeitet schon seit sieben Jahren dort und hat Gerda als ein schüchternes, freundliches Mädchen in Erinnerung, das stets pünktlich und fleißig, aber sehr verschlossen gewesen ist. Sie hat sich nicht viel mit dem andern Personal abgegeben.“
Ich nickte. Das hörte sich in der Tat stark nach Gerda an.
„Sie hat sich den anderen überlegen gefühlt, hat die Dame gesagt, weil dieser Job nicht ihr Beruf war, sondern ein Mittel, ihr Studium zu finanzieren. Sie hat auch nie viel von sich erzählt, ist etwas arrogant gewesen.“
„Und hat sie gewusst, wie Gerda mit Nachnamen heißt?“, fragte ich.
An dieser Stelle druckste Fred etwas herum und spielte verlegen mit den Pommes in seinen Fingern. „Ich konnte die Leute doch nicht nach Gerdas Nachnamen fragen“, sagte er schließlich, „weil ich vorgab, ihr Onkel zu sein.“
Das konnte ich ihm natürlich nicht übelnehmen, schließlich hatte ich ihm dies vorgeschlagen. „Hast du sonst etwas über sie in Erfahrung gebracht?“
Freds Gesicht hellte sich auf. „Ja, sie wohnt – oder wohnte damals – in Protea Glen.“
Diese Information schränkte unsere Suche schon mal erheblich ein. Ich holte meinen Laptop hervor und schaute auf der Karte nach. Protea Glen lag im Südwesten Sowetos, dies stimmte mit meiner Erinnerung überein, denn Gerda hatte immer vom Südwesten gesprochen. Das riesige Soweto war nun auf einen mittelständischen Teil des Townships geschrumpft.
„Dann fahren wir nun dorthin“, entschied ich. Ich blickte auf die Uhr, es war kurz nach zwei. Noch etwa vier Stunden würde es hell sein, in spätestens eineinhalb Stunden würden wir in Soweto sein. Das gab uns genug Zeit für eine erste Nachforschung.
Fred selbst wohnte in Vereenegingv mit seiner Frau und seinen drei Kindern, hatte aber Verwandte in Soweto und sagte, er kenne sich gut genug aus, um den Weg ohne Wegbeschreibung zu finden.
Wir begaben uns zurück auf die N1, die in der kurzen Zeit noch belebter geworden war. In Kürze würde es kein Durchkommen mehr geben. Sollten wir erst nach der Rush Hour zurückfahren, auch wenn das bedeutete, bis Einbruch der Dunkelheit in Soweto bleiben zu müssen? Ich war der festen Überzeugung, dass die emotionalen Schäden verstopfter Straßen und stundenlanger Staus allgemein unterschätzt wurden. Für den Fall, dass wir im Stau steckenbleiben würden, hatte ich uns zuvor noch rasch zwei Packungen Simba Chips und zwei Flaschen Appletiservi gekauft.
Während der Fahrt starrte ich gedankenverloren aus dem Fenster. Die Shacksvii entlang des Highways, deren Anblick mich gegen Ende meines letzten Aufenthaltes in dieser Stadt nicht mehr bedrückt hatte, weil ich mich an ihn gewöhnt hatte, stimmten mich traurig, wie vor vier Jahren, als ich zum ersten Mal nach Johannesburg gekommen war. Damals hatte sich die Traurigkeit wie eine Decke auf mich gelegt und mich zu ersticken gedroht.
„Wir sind fast da“, kündigte mein Begleiter nach knapp einer Stunde an. Wir bogen vom Highway ab und fuhren mitten in ein Labyrinth von Shacks.
„Wie lange dauert es noch, bis wir in Protea Glen sind“, fragte ich. Ich wollte weg von den bedrückenden Shacks, normale Häuser sehen.
„Nicht weit, nur ein paar Minuten. Wo soll ich dich rauslassen, Madam?“
Eigentlich hatte ich mich einfach etwas umsehen wollen, um die Eindrücke der Gegend, in der Gerda angeblich gewohnt hatte, in mir aufzunehmen. Doch wo genau ich aus dem Auto steigen wollte, hatte ich mir nicht überlegt. Was war ich doch für eine schlechte Detektivin.
„Was meinst du, wo wir aussteigen sollen?“, fragte ich, mit starker Betonung auf das Du, um ihn wissen zu lassen, dass ich ihn in meine Entscheidungen integrierte. Ich stellte ihm diese Frage, wohl wissend, dass ich keine Antwort erwarten durfte.
Doch überraschenderweise hatte er eine für mich: „Fang doch in einer Kirche an. Jeder geht in die Kirche. In einer der Kirchen wird man sie sicher kennen.“
„Wie viele Kirchen gibt es in Protea Glen und Umgebung?“
Fred schüttelte den Kopf, er wusste es nicht. Es mussten Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte sein. Ich war bereits dabei, in Missmut zu versinken, als mich die Erinnerung wie ein Blitz traf.
„Die anglikanische Kirche“, sagte ich zu Fred. „Gerda hat mir gesagt, dass sie in eine anglikanische Kirche geht.“ Vermutlich würde es auch von dieser mehr als eine geben. Doch es war ein Anhaltspunkt.
Oder du könntest bei den Waisenhäusern anfangen, sagte ich zu mir selbst. Aber nein, dazu war es zu früh, das musste ich mir für später aufheben. Ich hatte zu wenige Anhaltspunkte, um dieser Spur zu folgen, denn ich hatte wenig erfahren über Gerdas Recherchen in den Waisenhäusern. Gerda war immer sehr verschlossen gewesen, wenn es um ihr Privatleben ging, und ich war zu sehr in meiner eigenen Welt gefangen gewesen, um aktiv nachzubohren. Bei der kleinsten Abwehr ihrerseits hatte ich aufgegeben, etwas in Erfahrung zu bringen über diese Aktivitäten.
In Protea Glen angelangt, hielt Fred das Auto in einer Seitenstraße an und fragte ein paar ältere Damen, die gemächlich des Weges schlenderten, wo die nächste anglikanische Kirche sei. Von dem in Zulu gesprochenen Satz verstand ich bloss Isonto, Kirche.
Die Frauen waren sich einig, wo sie war, jedoch nicht darüber, wie man am schnellsten dorthin gelangte. Sie diskutierten und gestikulierten, eine wurde laut, eine andere beschwichtigte. Fred hörte geduldig zu – die Damen waren älter als er, er schien ihnen den nötigen Respekt zollen zu wollen.
Schlussendlich einigten sie sich auf eine Wegbeschreibung. Fred nickte, bedankte sich und fuhr los. Nur wenige Minuten später parkte er vor der Kirche. Ich stieg aus, doch Fred beharrte darauf, im Auto zu warten. Ich drängte ihn nicht und ging alleine auf die Kirche zu.
Sie war verlassen, doch aus einem Raum, der sich hinter dem Kirchenschiff befand, glaubte ich, Stimmen zu hören. Ich begab mich dorthin.
In dem Raum saßen ein älterer Herr und eine ältere Dame. Sie unterhielten sich und tranken Tee; eine halb gegessene Packung Kekse lag auf dem Tisch. Sie blickten mich überrascht an, als ich eintrat.
„Kann ich dir helfen?“, fragte der Herr, vermutlich der Pastor.
Ich wollte zuerst meine falsche Identität als Detektivin angeben, überlegte es mir dann aber anders. Es würde die beiden vermutlich nur verwirren und sie wenig kooperativ machen.
„Ich suche eine junge Frau. Sie heißt Gerda und ist ein paar Jahre jünger als ich. Sie ist eine Zulu, sie wohnt hier in der Gegend und geht in diese Kirche. Sie ist eine gute Freundin von mir. Ich möchte sie finden, weil ich ein Geschenk für sie habe.“ Die Behauptung, dass sie in diese Kirche ging, war natürlich reiner Bluff, doch wie hätte ich den beiden sonst erklären sollen, dass ich hier erschien?
Die beiden musterten mich mit Misstrauen. Dass aus dem Nichts eine Weiße, noch dazu eine Ausländerin, bei ihnen auftauchte und nach einem Mädchen fragte, von dem sie wohl noch nie gehört hatten, schien sie zutiefst zu verunsichern.
„Ich kenne keine Gerda“, meinte der Alte schließlich. „Sophia“, sagte er dann, sich an die ältere Dame wendend, „warum holst du unserem Gast nicht eine Tasse Tee. Sie sieht hungrig aus.“
Ich wollte widersprechen, denn ich befürchtete, dass der Tee begleitet werden würde von einer Portion Weißbrot-Sandwiches, belegt mit sehr pinker Wurst oder sehr gelbem Käse, und der Gedanke daran ließ mich schaudern, doch Sophia war bereits aufgestanden.
„Ich kenne keine Gerda“, sagte der Alte noch einmal. „Wie kommst du darauf, dass du sie hier finden würdest?“
„Sie wohnt in Soweto, hier in Protea Glen. Und sie geht in eine – diese – anglikanische Kirche. Es liegt mir sehr viel daran, sie zu finden.“
„Und ich habe Angst, dass ihr etwas zugestoßen ist“, hätte ich fast gesagt. Ich wusste nicht, woher ich diese Eingebung hatte, doch plötzlich war ich überzeugt: mein Drang, Gerda zu finden, resultierte aus der Angst, dass sie unauffindbar war.
Ich legte ihm ein altes Foto – mein einziges Foto – von Gerda hin. Aufgenommen hatte ich es im Zoo Lake Park kurz vor meiner Abreise aus Johannesburg im Juli 2008. Der strahlend blaue Himmel ließ einen glauben, an jenem Tag wäre es sehr heiß gewesen, doch die Temperatur hatte auch um die Mittagszeit keine 20 Grad erreicht. Gerda trug auf dem Foto jenen ausgeleierten Pullover, den sie immer zum Putzen angezogen hatte. Dieser Pullover und die enganliegenden Jeans, die sie ebenfalls häufig getragen hatte, hatten sich in meinem Gedächtnis eingebrannt – sie waren Teil von Gerda, machten Gerda ebenso aus wie ihre verschlossene Miene und die meist leicht zusammengekniffenen Lippen eines Mundes, der sich selten zu einem echten Lachen hinreissen liess.
07-07-2008 stand unten rechts auf dem Foto, kaum wahrnehmbar auf dem Grün der Wiese. Ich hatte das Foto bisher niemandem außer Fred gezeigt, dem ich notgedrungen mein volles Vertrauen zugesprochen hatte. Das Bild zeigte eine verhalten in die Kamera lächelnde Gerda, die bäuchlings auf einer Picknickdecke lag, den Kopf auf die Arme gestützt. Hinter ihr rechts sah man eine alte Trauerweide, links einen Teil des kleinen Sees, auf dem sich im Sommer die Bootsfahrenden tummelten. Ich merkte, wie die Augenbrauen des älteren Herrn sich hoben bei ihrem Anblick. Kein Wunder – Gerda war eine Schönheit. Ebene Gesichtszüge, große, mandelförmige Augen, hohe Wangenknochen und herzförmige Lippen. Rasch zog ich das Foto zurück – ich wurde fast etwas eifersüchtig bei der Reaktion des älteren Herrn.
Sophia kehrte zurück mit einem Tablett, auf dem eine Tasse Tee, Zucker, ein Kännchen Milch und nicht die gefürchteten Sandwiches, sondern ein riesiges Stück Torte mit viel Sahne und klebrigem Zuckerguss standen.
„Milch, Zucker?“
„Nein danke.“
Ich hatte keinen Hunger, doch ich wusste, dass das Ausschlagen des Tortenstücks die beiden verletzen würde. Das war das Letzte, was ich wollte. Ich aß es sehr langsam, aus Angst, man würde mir noch ein zweites Stück Kuchen anbieten, wenn ich das erste Stück aufgegessen hatte. Es war einfach, langsam zu essen. Der Zucker klebte mir am Gaumen, mir fiel das Schlucken schwer.
„Wir haben keine Gerda in unserer Kirche“, erklärte der ältere Herr, „und ich muss es wissen, denn ich bin der Pastor.“
Ich fragte ihn, wie er so sicher sein konnte, dass die hübsche, junge Frau auf dem Bild nicht in seine Kirche ging. Kannte er etwa alle seine Schäfchen?
„Nein“, gab er zu, „nicht alle, aber fast alle. Und ich merke mir jedes Gesicht, dem ich in meiner Kirche begegne. Dieses Gesicht habe ich noch nie gesehen.“ Er reichte das Foto an Sophia weiter, sie bestätigte seine Aussage.
„Bist du sicher, dass die junge Frau in diese Kirche geht?“
„Jetzt wo du es sagst…“, log ich. „Ich weiß nur, dass es eine anglikanische Kirche in Soweto, in dieser Gegend, ist, doch nicht, ob genau diese.“
„Es gibt noch mehr anglikanische Kirchen in Soweto“, fügte er an. „Wieso fragst du nicht in diesen nach?“
Ich nickte, bedankte mich für Tee und Kuchen und erhob mich. Doch so schnell ließen mich die beiden nicht gehen. Sie wollten noch mit mir Beten, bevor ich mich auf den Weg machte – um mir Kraft zu geben und damit der Herr mich zu Gerda führte. Darauf folgten mehrere Einladungen, an ihrem Gottesdienst teilzunehmen. Ich nickte höflich und versicherte, dass ich auf jeden Fall einmal vorbeikommen würde, wohl wissend, dass ich dies nicht tun würde.
Auf dem Weg zum Auto wäre ich fast mit einem Mann zusammengestoßen, der schnellen Schrittes daher ging. Er trug einen blauen Overall und schleppte Werkzeuge mit sich. Ein Mann, dem man ansah, dass er seine Tage nicht in einem klimatisierten Büro verbrachte – ein drahtiger, starker Mann, der harte Arbeit gewohnt war. Wir entschuldigten uns zeitgleich, lächelten einander zu, und er ging weiter.
Joe hat sich im Südwesten Sowetos ein gutes Leben aufgebaut. Er führt ein kleines Geschäft, in dem er kaputte Radios, Fernsehgeräte und andere elektronische Geräte repariert. Gelegentlich erhält er auch von einem Mittelsmann, der Beziehungen zu einer Organisation in Übersee hat, ein paar Geräte, die er dann reparieren und weiterverkaufen kann. Fast drei Viertel seines Umsatzes muss er dem Mittelsmann dafür zahlen, der davon wieder mehr als die Hälfte an die Organisation, deren Namen Joe nicht kennt, weitergibt. Joe fragt nicht nach den Details, er fragt schon gar nicht, ob die Geschäfte dieser Organisation legal sind. Woher erhalten sie die Ware, die oft fast wie neu ist, sodass die Reparatur kaum Zeit in Anspruch nimmt? Der Mittelsmann, der sich als Pete vorgestellt hat – Joe bezweifelt, dass dies sein wahrer Name ist –, hat ihm einmal erklärt, diese Dinge erhalte die Organisation umsonst, die Europäer wollten diese Sachen nicht mehr haben, seien froh, wenn sie sie loswürden, sie nach Afrika verschiffen könnten. Joe findet es schwierig, dies zu glauben. Wie kann man Gegenstände, die noch fast einwandfrei funktionieren, nicht mehr haben wollen?
Gott wird ihm diese kleine zweifelhafte Aktivität verzeihen, da ist Joe sich sicher. In seiner Umgebung gibt es Leute, die viel schlimmere Dinge tun als er. Gewiss muss sich Gott erst um diese Menschen kümmern. Er geht regelmäßig zur Kirche, und wenn er kann, spendet er etwas für die Armen – die noch Ärmeren.
Draußen fällt auf einmal ein Schuss. Obwohl in weiter Ferne, wirkt er dennoch bedrohlich nah. Joes Frau kommt aus dem kleinen Nebenzimmer, in dem sie mit den beiden Mädchen schlief.
„Ist etwas passiert?“
Joe schüttelt den Kopf. „Lass uns schlafen gehen.“ Er will nichts damit zu tun haben. Solche Dinge gehen ihn und seine Familie nichts an. Zudem, der Schuss ist weit weg gefallen.
Und doch zittert Joe plötzlich. Was, wenn die Unruhen aus Alexandra hierhergekommen? Dort herrscht ein Krieg, denkt er plötzlich, dort ist die Grenze zwischen der alltäglichen Kriminalität und Kriegsführung überschritten worden.
Auch seine Frau Anna wird dieser Gefahr ausgesetzt sein, wenn sie hier anfangen. Vor fünf Jahren heiratete er sie, damals hätte er nie gedacht, dass es einmal ein Problem sein könnte, dass sie keine Südafrikanerin ist, damals ist noch alles anders gewesen.
Er löscht das Licht und legt sich zu seiner Frau. Nein, es wird hier nicht anfangen. In Soweto ist die Vergangenheit noch zu präsent – all die Leiden, all die Mühen –, als dass sie die Leute wiederaufleben lassen würden. Hier sind sie sicher.
Auf Freds Rat hin verschob ich die weitere Suche nach Gerda auf den nächsten Tag.
„Es wird bald dunkel“, meinte er. „Es ist besser für uns beide, wenn wir uns auf den Heimweg machen.“
Ich wusste, dass er noch einen weiten Weg nach Hause hatte, nachdem er mich im Hotel abgeliefert hatte, und protestierte nicht, obwohl ich darauf brannte, mit der Suche weiterzumachen.
Früh zurück im Hotel zu sein, gab mir Gelegenheit, nach einer neuen Unterkunft zu suchen. Nachdem ich eine Webseite zur Vermittlung von Mitbewohnern durchforscht hatte, rief ich zwei Inserentinnen an. Das erste Zimmer war bereits vergeben, mit der zweiten Inserentin vereinbarte ich einen Termin für den nächsten Abend. Danach holte ich mir ein Bier aus der Minibar, öffnete eine Packung Nüsse und entschied, dass dies mein Abendessen sein würde. Ich hatte keine Lust, das Zimmer noch einmal zu verlassen, und der reichhaltige Kuchen lag mir noch immer schwer im Magen. Ich zappte durch die Kanäle auf der Suche nach einer nicht allzu banalen Unterhaltung, blieb bei den Nachrichten hängen und sah mir das Elend der Welt für ein paar Minuten an. Es wurde ausführlich von den xenophobischen Attacken berichtet, die vor einigen Monaten in Alexandra ihren Anfang genommen hatten, und von dort aufs ganze Land übergeschwappt waren. Ich hatte davon nicht viel mitbekommen, das war während jener Zeit gewesen, als ich in Brasilien gewohnt hatte - bevor ich Simon verlassen hatte und nach Europa zurückgekehrt war, um mir zu überlegen, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Was mich in der Konsequenz hierhergeführt hatte.