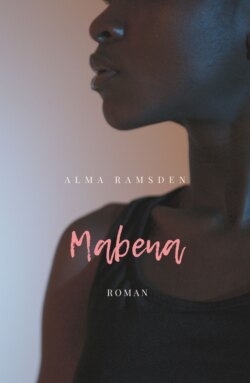Читать книгу Mabena - Alma Ramsden - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 1
Gerda, dachte ich, während ich darauf wartete, dass der Beamte die Begutachtung meines Passes abschloss und mit einem Stempel meine Einreise besiegelte. Ich starrte am Häuschen des gelangweilten, pedantisch arbeitenden Beamten vorbei an die Wand der Empfangshalle. An ihr hingen zwischen Plakaten, auf denen lachende Südafrikaner Touristen in Südafrika willkommen hießen, und Werbeplakaten für eine große Bank auch Flyer, die auf Menschenhandel aufmerksam machten und mit Notrufnummern für Betroffene versehen waren.
Gerda wie noch? Ich wusste es nicht. Sie hatte sich einfach als Gerda vorgestellt, mir ihren Nachnamen nie gesagt. Hatte sie ihn mir nicht sagen wollen? Es nicht für nötig gehalten? Oder hätte es an mir gelegen, danach zu fragen? Gerda, meine beste Freundin in den knapp zwei Jahren, die ich in Johannesburg verbracht hatte. Eine der zwei Frauen, denen ich mich hatte anvertrauen können, in deren Nähe ich mich wohl gefühlt hatte. Und dennoch wusste ich nicht einmal ihren Nachnamen. Wie sehr wünschte ich mir nun, da ich sie unbedingt finden wollte, dass ich sie einmal danach gefragt hätte – aber ich hatte viel zu spät erkannt, wie wichtig sie mir war.
Der Beamte händigte mir meinen nun mit einem Stempel versehenen Pass aus – „OR TAMBO INTERNATIONAL AIRPORT REPUBLIC OF SOUTH AFRICA ENTRY (816) 2010-08-03 VALID UNTIL 2010-11-01 CONDITIONS: HOLIDAY“ stand innerhalb des viereckigen Stempelabdrucks - und winkte mich durch. Ich lief durch die Empfangshalle, vorbei an wartenden Angehörigen und Freunden. Auf mich wartete niemand.
Sobald ich aus der Masse der ankommenden Passagiere heraustrat, begann ich zu frieren. Wie gut ich mich an diese Kälte erinnerte – sie war die intensivste Erinnerung an meine Zeit im südlichen Afrika.
Es ist kalt, als sie das erste Mal ihr neues Heim betreten, um sich davon zu überzeugen, dass ihnen das Grundstück, das der Makler ihnen über die halbe Erdkugel hinweg vermittelt hat, auch wirklich zusagt. Die Kälte kommt von außerhalb, aber auch von innerhalb des Hauses – die Kälte scheint von den Wänden des Hauses auszustrahlen.
„Kann man nicht die Heizung anschalten, damit es bis zum Einzugstermin schön warm ist?“, fragt die junge Ehefrau.
„Es gibt keine Heizung“, entgegnet der Makler mit einem bemüht humorvoll wirkenden Lächeln.
Sie ist perplex. Ein großer Garten mit Swimmingpool, ein Aufenthaltsraum mit Billardtisch, eine eingebaute Bar, aber keine Heizung.
„Man könnte natürlich“, fügt der Makler rasch hinzu, als er ihre entsetzte Miene sieht, „eine Heizung einbauen lassen. Oder Heizkörper kaufen.“
Auch beim Einzug ist es kalt. Weil sie selbst nur regungslos dasteht und die Männer beim Ausladen und Einrichten beobachtet. Während ihr Mann sie immer wieder fragt, wo sie dieses und jenes haben will, dringt die Kälte leicht in sie ein und füllt sie bald ganz und gar aus.
Simon, der sich zunächst vehement sträubte, zurückzukehren nach Südafrika, ist nun seltsamerweise in seinem Element. Schon bei der Landung am O.R. Thambo International Airport hatte seine Frau die Veränderung bemerkt – seine oftmals gespielte Selbstsicherheit war in echtes Selbstbewusstsein übergegangen. Er hat es geschafft, den Dämonen seiner Kindheit Herr zu werden.
Obwohl ich nie ein sonderlich enges Verhältnis zu Simons Eltern gehabt hatte, stattete ich ihnen dennoch schon an meinem zweiten Abend in Johannesburg einen Besuch ab. Sie hatten mich zum Essen eingeladen, und so saß ich, wie in alten Zeiten, an dem großen Esstisch aus schwerem Eichenholz. Das Gespräch wurde von Simons Mutter geleitet, als handle es sich um ein Business Meeting. Sie warf Anekdoten aus ihrem Leben und Neuigkeiten aus den Nachrichten in die Runde, um die Diskussion anzuregen. Sie stellte Fragen, wenn die Stille ihr zu viel wurde, und verlangte detaillierte Antworten.
Simon war ein Leben lang von Frauen umgeben gewesen, die mir unähnlicher nicht hätten sein können. Das hatte mir oft Sorgen bereitet: Simon, so meine Vermutung, hatte unbewusst eine Frau als Ehefrau gewählt, die alles repräsentierte, was seine Mutter – und Andrea – nicht waren. Seine Mutter: engagiert, kritisch, dominant. Andrea: hochintelligent, ehrgeizig, bei allen beliebt. Beide mussten ihm stets ein Gefühl der Minderwertigkeit gegeben haben. Als Konsequenz davon hatte er eine Frau geheiratet, die unscheinbar, zurückhaltend und anspruchslos war.
„Und was machst du in Johannesburg“, fragte Simons Mutter beim Hauptgang. Diese Frage hatte natürlich kommen müssen.
Und ich war auf sie vorbereitet. Selbstverständlich sagte ich ihnen nicht die Wahrheit – dass ich jene Person suchte, die mir so viel bedeutet hatte während meines letzten Aufenthaltes, ohne die die zwei schlimmen Jahre unerträglich gewesen wären. Stattdessen behauptete ich, das Fernweh hätte mich gepackt, und ich wollte noch einmal Freiheit schnuppern, bevor ich zurückkehrte nach Europa in einen eintönigen Bürojob, den ich mir hatte suchen müssen, nun, da ich nicht mehr mit Simon zusammen war.
„Ich habe bereits einen Vertrag für eine neue Stelle unterschrieben, mit der ich anfangen werde, sobald ich zurückkehre“, antwortete ich auf die Frage, wie ich mir meine Zukunft vorstellte, wenn ich wieder in der Schweiz war. Dies war eine unverblümte Lüge, in Wahrheit hatte ich noch keinen Schimmer, was ich mit mir anfangen würde, noch nicht einmal der Zeitpunkt der Rückreise stand fest.
Das Abendessen endete früh. Als leidenschaftliche und gesundheitsbewusste Sportler gingen Simons Eltern früh schlafen, standen sie früh auf, und aßen sie abends wenig und zu früher Stunde. Ich, die Unsportliche, die gerne und viel aß und wohl nur dank ihrer guten Gene nicht dick geworden war, ging auch heute noch etwas hungrig nach Hause. Im Hotel machte ich mich dann über ein Päckchen Erdnüsse her, das ich in der Minibar fand, und trank dazu ein Bier. Das Abendessen ließ mich in beklemmter Stimmung zurück, wie das immer der Fall gewesen war nach einem Treffen mit Simons Eltern. Noch heute tat Simon mir ein bisschen leid, trotz aller Gleichgültigkeit, die ich ihm gegenüber in den letzten freudlosen Jahren unserer Ehe entwickelt hatte, denn mit diesen Eltern aufzuwachsen, war ein 18 Jahre währender Albtraum gewesen. Dies hatte er mir des Öfteren in unseren anfänglich sehr vertrauten Gesprächen gestanden. Die dunkle Seite seiner Mutter, die mir und allen anderen Leuten größtenteils verborgen blieb, war in seiner Kindheit Simons stetiger Begleiter gewesen: Er war seinem Grossvater, ihrem verhassten Vater, ähnlich, was sie ihm nicht verzeihen konnte. Und was lag näher, als ihre Frustration über dieses zwar gewollte, aber ungeliebte Kind, an dem Kind selbst auszulassen. Simons Vater hatte ihm keine Zuflucht vor den Attacken seiner Mutter geboten, er war zu beschäftigt gewesen mit seiner Arbeit und den vielen Sportarten, denen er mit Leib und Seele nachging. Kein Wunder, dass aus Simon schon in jungen Jahren ein Mensch geworden war, der in jeder Hinsicht seinen Eltern widersprach: Wie ich aß er viel und ungesund, trieb wenig Sport und trank zu viel. Zudem – und hier unterschieden wir uns – stürzte er sich in das Nachtleben jeder Stadt, in der er wohnte. Während sich seine Essgewohnheiten mit der Zeit gebessert hatten und er sogar angefangen hatte, Sport zu treiben, war er vom Alkohol und Nachtleben nie losgekommen – auch während unserer Ehe nicht. Doch genau diese Angewohnheiten, die andere Ehefrauen wohl bemängelt hätten, waren jene, die mich auch am Ende unserer Beziehung am wenigsten abgestoßen hatten. Was mich an Simon gestört hatte, waren jene Eigenschaften, die ihn trotz all seines Widerstandes seinen Eltern gleichen ließen: Er hatte sich mit derselben Leidenschaft in seine Karriere gestürzt, mit der seine Mutter sich ihren sozialen Aktivitäten und beide seiner Eltern sich dem Sport und dem gesunden Leben verschrieben hatten, und er betrachtete sich als den Nukleus eines Universums, das aus seiner Arbeit, seiner Beziehung und seinem sozialen Umfeld bestand. Und selbstverständlich gab es außerhalb dieses Universums nichts, was von Bedeutung war. Wie seine Mutter redete Simon gerne, doch im Gegensatz zu ihr nicht über die sozialen Probleme im Land, sondern vor allem über sich selbst. Simon war ständig von Leuten umgeben, die diese elende Schwatzhaftigkeit teilten, und wenn sie in der sozialen Hierarchie über ihm standen, war es an ihm, ihnen zuzuhören, und nicht umgekehrt. Weil er sich also in gewissen Situationen zurückhalten musste, hatte er dies nie zu Hause getan, bei mir, wo er sich endlich seinem Rededrang hingeben konnte. Es war wohl unter anderem aus diesem Grund, dass Simon und seine Mutter ständig aneinandergerieten, denn jedes Mal, wenn sie aufeinandertrafen, ging es darum, wer das Gespräch dominieren durfte. Ein Kampf, den Simons Mutter ausnahmslos gewann, denn sie hatte mehr Macht in der Familie und mehr Ausdauer als Simon. Simons Mutter war keine Frau, die verlieren konnte.
Der kleine Junge, der sich einst aus Angst vor seiner wütenden Mutter unter der Bettdecke versteckt hat, ist heute ein erwachsener Mann, ein bedeutender Mann. Jung und naiv hat er angefangen in einer globalen Firma, doch sein Engagement und sein Ehrgeiz, seine Ideen und seine Verhandlungssicherheit haben bei denen ganz oben Beachtung gefunden, und bald ist er in dem großen Unternehmen aufgestiegen. Heute ist er auf der ganzen Welt unterwegs. Überall, wo es wichtige Rohstoffe gibt, ist er zu finden. Es läuft gut, es läuft besser, als er es sich je hat träumen lassen. An seiner Seite ist eine hübsche Frau, deren einzige Makel sind, dass sie zu viel grübelt und stets danach strebt, sich selbst zu verwirklichen, und es dennoch nie tut. Dabei bietet er ihr alles – es fehlt ihr weder an Geld, noch an Zeit, noch an seiner vollen Unterstützung für sie. Manchmal ertappt er sich bei dem Wunsch, dass sie mehr wie Andrea wäre: ehrgeizig, selbstsicher, dennoch warm und liebenswürdig. Aber was macht er sich vor: Eine Frau wie Andrea gibt es kein zweites Mal, und seine zweite Wahl hätte viel schlimmer ausfallen können. Und er liebt es dennoch, dieses seltsame Wesen, das ihm das Leben oft so schwermacht.
Am nächsten Tag stand ich früh auf. Hunger und Tatendrang trieben mich aus dem Hotelbett und in den Frühstückssaal. Nach einem reichhaltigen Frühstück machte ich mich auf den Weg nach Rosebanki. Ich war mir der schieren Unmöglichkeit bewusst, Gerda zu finden. Mein einziger Anhaltspunkt war, dass sie in Soweto wohnte – zumindest in den Jahren, als ich in Johannesburg gelebt hatte. Ich war nicht naiv genug zu glauben, ich hätte eine Chance, sie in dem riesigen Township aufzuspüren ohne fremde Hilfe. So war mein erster Schritt, mich an ein Tourismusbüro zu wenden, das Touren durch Soweto anbot. Ich hoffte, man könnte mir jemanden vermitteln, der mich auf meiner Suche in dem riesigen Township begleiten und mir über sprachliche und kulturelle Barrieren hinweghelfen würde.
Das erste Büro war jedoch nicht geneigt, mir etwas anderes als die von ihnen organisierte Bustour anzubieten, obwohl ich mehrmals erklärte, dass ich keine Absicht hatte, das Haus von Nelson Mandela, das Apartheidmuseum oder andere Attraktionen zu besichtigen.
Ich klapperte drei weitere Tourismusbüros ab, mit dem gleichen Resultat, bevor ich beschloss, meinen Plan B anzuwenden. Ich begab mich zu einem Arbeitsvermittlungsbüro, das ich mir wie die Touristenbüros im Voraus im Internet herausgesucht hatte. Ich reichte dem dort arbeitenden Herrn meine Visitenkarte, die ich extra für solche Zwecke angefertigt hatte, und erklärte ihm, dass ich Verstärkung für mein Team benötigte: einen guten Fahrer, der sich insbesondere in Soweto gut auskannte, redegewandt, mit Schulabschluss.
Ich schloss mit den Worten: „Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Diskretion stehen an oberster Stelle.“
Der Mann hatte sich alles sorgfältig notiert und betrachtete nochmals meine Visitenkarte, auf der mein Name stand sowie „Privatdetektivin, Shepherd Street, Bryanston“. An dieser Straße hatten wir tatsächlich einst gewohnt. Ich hatte absichtlich diese Adresse verwendet, weil ich hoffte, sie würde Eindruck machen. Die Idee, mich als Privatdetektivin auszugeben, war mir kurz vor meinem Abflug gekommen, als ich eine Verfilmung von Agatha Christies „Tod auf dem Nil“ geschaut hatte. Warum sich nicht als Privatdetektivin ausgeben in einem Land, in dem einen so gut wie niemand kannte? Vor allem aber gab es mir die Legitimität, einer Person nachzustellen, ohne auf allzu großen Argwohn zu stoßen, da ich dies als rein professionellen Auftrag ausgeben konnte. Ich hatte keine Zweifel, dass man mir schnell jemanden vermitteln würde.
Kurz nach zwölf machte ich mich auf den Weg zurück ins Hotel. Doch kaum hatte ich das Auto erreicht, meldete sich mein Magen, darum beschloss ich, in einem der vielen Cafés in Rosebank zu Mittag zu essen. Ich bestellte ein getoastetes Sandwich mit Salat und einen Cappuccino, der prompt begleitet von einem großen Glas Wasser kam, und blickte auf das rege Treiben der Menschen, während ich den Milchschaum löffelte und über meine nächsten Schritte nachdachte.
Hier, in diesem Café in Rosebank, bemerkte ich zum ersten Mal die Veränderung, die Südafrika seit meinem Aufenthalt in den Jahren 2006 bis 2008 durchgemacht hatte. Um mich herum saßen Schwarze, Colouredsii, Inder und auch Weiße, doch Menschen dunkler Hautfarbe dominierten das Bild. Leicht erkennbar an ihrer religiösen Kleidung waren Hindus, Muslime, Juden. Junge Mädchen mit Kopftüchern liefern kichernd an mir vorbei, eine Gruppe älterer Frauen in farbigen Saris diskutierte lauthals in einer mir unverständlichen Sprache, junge Männer mit Kippas auf dem Kopf unterhielten sich angeregt am Tisch neben mir.
Natürlich hatte ich auch schon bei meinem letzten Aufenthalt Menschen aller Hautfarben und Religionen in einstmals den Weißen vorbehaltenen Gegenden gesehen – doch waren es so viele gewesen? Ich war nun mit den anderen Weißen deutlich in der Minderheit.
Mein Herz war plötzlich – vielleicht zum ersten Mal – voller Freude und Hoffnung für dieses Land. Ich musste mir größte Mühe geben, die Leute nicht anzustarren, so sehr faszinierte mich das Geschehen um mich herum. Um mich abzulenken, holte ich ein Notizbuch heraus und beschloss, meine Gedanken wieder Gerda zu widmen.
Als Nächstes würde ich zum Checkersiii in Crestaiv fahren, obwohl ich mir wenig Hoffnung machte, dass man mir dort weiterhelfen konnte. Gerda hatte sehr unregelmäßig dort gearbeitet, sie war lediglich für die ganz geschäftigen Zeiten eingestellt worden; sie hatte einen Vertrag auf Abruf gehabt. Gerda hatte trotz eines Stipendiums arbeiten müssen, da es ihre Lebenshaltungskosten nicht gedeckt hatte. Während sie bei mir angestellt gewesen war, hatte sie den Großteil ihres zusätzlichen Einkommens von mir bekommen. Ich hatte sie immer wieder gedrängt, weniger Zeit in ihren anderen Nebenjob zu investieren und sich dafür auf ihr Studium zu konzentrieren; in meiner Besessenheit war ich so weit gegangen, ihr anzubieten, sie für die Stunden, die sie nicht bei Checkers arbeitete, zu bezahlen.
Ob Gerda ihr Studium beendet hat? Ich hatte keine Ahnung. Schon damals hatte ich sie im Grunde kaum gekannt, und natürlich wusste ich heute nicht mehr über sie.
Warum hatte ich mir nicht die Mühe gemacht, alles, absolut alles über sie zu erfahren, bevor ich Johannesburg verlassen hatte, um sicherzustellen, dass der Kontakt nie abbrechen würde? Die Antwort war simpel: Ich hatte bewusst alle Stricke durchtrennt, die mich an diesen Ort banden. Ich hatte geglaubt, ich könnte nach meiner Abreise mein Leben neu aufbauen und wieder glücklich werden.
Ich hatte es nicht geschafft und darum saß ich nun hier, in diesem Café in Rosebank, mit einem Stapel gefälschter Visitenkarten in der Tasche.
Gerda fängt nur wenige Tage später bei dem Paar, das aus Übersee hergezogen ist, zu arbeiten an. Die junge Schweizerin hat eigentlich nicht vorgehabt, jemanden einzustellen. Früher benötigte sie nie Hilfe im Haushalt, auch nicht, als sie selbst Vollzeit arbeitete. Warum soll sie nun jemanden anstellen, wo sie noch nicht einmal eine Stelle in Aussicht hat, und sie bereits einen Gärtner hat, der einmal in der Woche kommt. Die Tage ziehen sich schon so in die Länge. Wenn sie nicht einmal mehr putzen, waschen und kochen muss, was bleibt ihr dann noch? Doch unter den Hausangestellten in der Nachbarschaft verbreitete es sich schnell, dass die Neuen noch keine Haushaltshilfe haben. Und so klingelt es täglich, oft mehrmals täglich, an ihrer Haustüre; die arbeitslosen Verwandten und Bekannten der Informantinnen bitten sie um Arbeit.
„Du kannst doch nicht immer ‚nein‘ sagen“, meint Simon eines Tages, „diese Frauen wollen Arbeit.“
„Aber ich brauche niemanden.“
„Darum geht es nicht.“
„Worum geht es dann?“
Darauf antwortet er nicht.
„Na gut“, meint sie. „Die Nächste, die klingelt, stelle ich ein.“
Die Nächste, die klingelt, ist Gerda.
Sie führt kein Einstellungsgespräch mit ihr, fragt sie nichts Persönliches. Gerda klingelt, sagt ihren Vornamen, fragt nach Arbeit, und die Frau antwortet: „Du kannst zweimal in der Woche kommen.“
Ihre andere Haushaltshilfe, die ihr schon vor der Ankunft vermittelt wurde, und die auf ein höheres Pensum hofft, wird es ihr übelnehmen.
„Zweimal nur, Madam? Nicht mehr?“, fragt Gerda in tadellosem Englisch.
Eigentlich wollte sie nicht einmal „zweimal die Woche“ sagen, sondern nur: „einmal die Woche“.
„Zweimal“, wiederholt sie. „Öfter brauche ich dich einfach nicht.“
Gerda ist nicht zufrieden mit dem Angebot, drängt aber nicht weiter. Stattdessen macht sie sich sofort an die Arbeit.
Die junge Ausländerin ist darüber so verwirrt, dass sie es einfach geschehen lässt. Um nicht im Weg zu sein, begibt sie sich in ihr Schlafzimmer, wo sie den Rest des Tages verbringt, die Schatten an der Wand beobachtend. Seit ihrer Kindheit tut sie dies; es beruhigt sie wie keine andere Beschäftigung. Gerda meldet gegen vier Uhr nachmittags, sie sei fertig. In dieser Zeit hat sie alles, absolut alles, geputzt und aufgeräumt, was man nur in einem erst halb eingerichteten Haus putzen und aufräumen kann. Von da an hat ihre Arbeitgeberin noch mehr Zeit zum Nichtstun.
Simon hingegen arbeitet so viel wie noch nie in seinem Leben.
Ich bezahlte die Rechnung, gab ein großzügiges Trinkgeld und verließ das Café. Auf dem Weg zum Auto schlenderte ich durch die Massen und beobachtete weiterhin fasziniert die Leute um mich herum. Ich sah viele Männer, die mich an Simon erinnerten: Weiße in dunklen Anzügen, laut und selbstbewusst miteinander diskutierend und in schnellen Schritten durch die Menge gehend. Sie mussten in Eile sein, zurückkehren zu ihren Jobs, die es ihnen erlaubten, sich teure Anzüge zu kaufen. Ehrgeizige Männer am Anfang ihrer Karriere. Rückblickend realisierte ich: Simons Arbeitswut damals war seine Art und Weise gewesen, mit dem Umzug fertigzuwerden und sich selbst zu beweisen. Seinerzeit empfand ich es als das erste Anzeichen der Entfremdung, die letztendlich zur Trennung geführt hatte.
Für unsere Trennung gab es natürlich noch viele andere Gründe. Unter anderem, dass Simon sich immer das perfekte Familienleben gewünscht hatte mit mindestens zwei Kindern, die er am Abend, nach einem langen Tag bei der Arbeit, ins Bett stecken konnte. Mit der Zeit war dieses Thema zum Tabu geworden und hatte ihn vermutlich in seine lächerliche Affäre getrieben. Als ich davon erfahren hatte, war er mir aber schon so gleichgültig gewesen, dass ich mich geradezu über sie freute. Sie hatte mir erlaubt, mit dem Finger auf ihn zu zeigen, anstatt die Schuld bei mir selbst suchen zu müssen. Die Entscheidung, ihn zu verlassen, hatte auch nichts mit dieser Affäre zu tun, sondern einzig mit mir selbst: Ich wollte meine Vergangenheit aufarbeiten und mit mir selbst ins Reine kommen.
So war ich also, anstatt ihm noch einmal zu folgen, nach Johannesburg gegangen, um Gerda zu suchen.