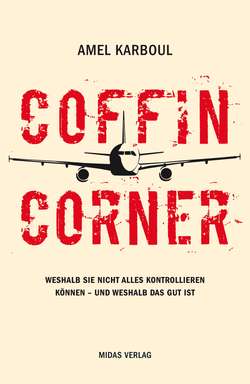Читать книгу Coffin Corner - Amel Karboul - Страница 12
Auf dem Sprung
ОглавлениеIn den 1970er-Jahren waren die Weltmärkte weitgehend stabil und berechenbar: Neue Konkurrenten und neue Technologien entwickelten sich nur langsam und Knalleffekte kamen nur alle paar Jahre einmal vor. Die einzelnen Weltmärkte – für Finanzen, für Fachkräfte, für Rohstoffe oder für Produkte entwickelten sich im Vergleich zu heute relativ unabhängig voneinander und relativ langsam und kontinuierlich. Sie können auch sagen: relativ berechenbar. Heutzutage brauche ich nur die Wirtschaftszeitung aufzuschlagen, und ich finde garantiert ein Ereignis, ein Produkt, eine Firma – kurz: irgendetwas, das gerade den Markt umkrempelt. Die Welt dreht sich immer schneller und die Veränderungen werden immer heftiger. Zunehmend kürzer wird auch die Zeit, die eine Erfindung braucht, um sich durchzusetzen – und um wieder zu veralten. Das lässt sich ablesen an der Zeitspanne, die eine technische Innovation ab ihrer Markteinführung braucht, bis sie 50 Millionen Nutzer hat.
Beim Radio waren das 38 Jahre.
Beim Fernseher 13.
Beim Internet vier.
Beim iPhone drei.
Bei Facebook zwei.
Auch die Informationsmenge, die zur Verfügung steht, wächst ständig. Und das macht alles immer komplexer. Was heute in einer Woche in der New York Times steht, ist mehr Information, als im 18. Jahrhundert ein Mensch in seinem ganzen Leben zu verarbeiten hatte. Allein das technische Wissen verdoppelt sich alle zwei Jahre. Bei meinem Maschinenbau-Studium habe ich im dritten Jahr festgestellt, dass die Hälfte von dem, was ich im ersten Jahr gelernt hatte, schon wieder veraltet war. Und das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her …
Wie tiefgreifend sich die Wirtschaft gerade ändert, zeigt Dirk Baecker vom Lehrstuhl für Kulturtheorie und -analyse an der Zeppelin Universität Friedrichshafen. Er vertritt die These, dass die kulturelle Entwicklung der Menschheit nicht gleichmäßig vor sich geht, sondern in plötzlichen Entwicklungssprüngen, gefolgt von Phasen sehr langsamer Entwicklung, auf die dann wieder ein Sprung folgt.
Ein solcher Sprung war zum Beispiel die Erfindung der Schrift im vierten Jahrtausend vor Christus in Mesopotamien. Ein anderer, die Erfindung des Buchdrucks. Immer, wenn es einen solchen Sprung in einer »Schlüsseltechnologie« gibt, verändert sich nicht nur dieser Zweig der Wirtschaft, sondern gleich die ganze Gesellschaft, der komplette Alltag, das ganze Leben. Und zwar rasend schnell.
Laut seiner Theorie stecken wir gerade mitten in einem solchen Entwicklungssprung: in der digitalen Revolution. Das World Wide Web wurde 1995 erfunden. Aber schon jetzt hat es unsere Alltagskultur, unsere Kommunikation, unser Selbstverständnis und unser Weltbild völlig verändert. Und das ist erst der Anfang. Die digital vernetzte, globale Gesellschaft ist erst im Entstehen, und wir wissen noch überhaupt nicht, wie sie aussehen wird.
Spannend an Baeckers Theorie finde ich drei Dinge. Erstens: Der allgemeine Sprachgebrauch und die meisten Kommentatoren gehen davon aus, dass Wirtschaft und Gesellschaft sich im Laufe der Menschheitsgeschichte immer schneller verändern, sie sprechen oft vom Phänomen der »Dynaxity« – der Kombination aus zunehmender Dynamik und zunehmender Komplexität. Aber laut Baecker stimmt das nicht kontinuierlich. Wir haben nur gerade den Übergang von einer ruhigen Phase in eine beschleunigte Phase der Veränderung erlebt. Von dieser kurzen Phase der extremen Beschleunigung auf die ganze Menschheitsgeschichte zu schließen, ist womöglich ein Kurzschluss.
Zweitens bedeutet das, dass die Menschheit solche chaotischen Phasen extremer Veränderung schon öfter erlebt hat. Mit dem Blick auf das große Ganze ist der gegenwärtige Schub an Innovation und Veränderung also ganz normal.
Drittens: Was derzeit geschieht, ist verwirrend für einen Menschen, der geprägt ist von einer Gesellschaft, mit einem ruhigeren Geschichtsverlauf mit viel Ordnung und Sicherheit. Der Effekt ist in etwa so, wie wenn Sie einen Menschen aus dem Tiefschlaf reißen und zur Hauptgeschäftszeit mitten in einen Souk in der Medina von Tunis stellen.
Die Verwirrung ist berechtigt: Während eines Entwicklungssprungs verändern sich Gesellschaft und Wirtschaft nicht nur rasend schnell, sondern auch völlig unvorhersehbar. Kleinste Ereignisse können reichen, um die Welt aus den Angeln zu heben. Eine unscheinbare Erfindung, das Verhalten einer Einzelperson, ein einzelner Kommentar in einem gut vernetzten Forum, kann Märkte, Meinungen, ja sogar politische Systeme verändern – oder auch nicht. Das weiß vorher niemand.
Nehmen Sie den Arabischen Frühling: Der wurde nicht von einer politischen Gruppe ausgelöst, sondern von einem Gemüsehändler. Am 17. Dezember 2010 zündete sich in Sidi Bouzid, einer Kleinstadt 200 Kilometer von Tunis entfernt, Mohamed Bouazizi aus Protest gegen behördliche Willkür an: Die Behörden hatten seine Ware beschlagnahmt. Eine individuelle Verzweiflungstat, die zunächst in Tunesien, in den nächsten Wochen und Monaten in ganz Nordafrika und dem Nahen Osten, eine nicht zu stoppende Protestwelle gegen die autoritär herrschenden Regime auslöste. Das historische Ereignis war völlig ungeplant, völlig unorchestriert, völlig flächendeckend und völlig wirkungsvoll. Und niemand hatte es vorausgesehen.
Über Twitter, Facebook und Mobiltelefone verbreitete sich die Nachricht über die Selbstverbrennung von Bouazizi in Sekundenschnelle in der ganzen Welt. Über dieselben Kanäle verabredeten sich die sonst eher obrigkeitshörigen Tunesier im ganzen Land zu Protestdemos. Die Aufstände blieben keine Eintagsfliege: Nach 28 Tagen Unruhen, Protesten und Ausschreitungen war es soweit, dass der tunesische Präsident Zine el Abidine Ben Ali das Land verließ. Kurze Zeit später waren auch der ägyptische Präsident Husni Mubarak und der jemenitische Präsident Ali Abdullah Salih nicht mehr im Amt. Der libysche Diktator Muammar al-Gadaffi hielt sich noch einige Monate länger; er wurde nach einem brutalen Bürgerkrieg im Oktober 2011 umgebracht.
Geplant war das alles nicht. Doch ebensowenig kann es Zufall gewesen sein. Es sind nur genügend Faktoren zusammengekommen, um eine Entwicklung über eine bestimmte Schwelle zu heben, die die bestehende Ordnung vom Chaos trennt. Jenseits der Schwelle ist die Entwicklung unvorhersehbar, unkontrollierbar, unbeeinflussbar. Anders als in der ruhigen, geordneten Zone, wo eine Ursache eine Wirkung nach sich zieht – oder umgekehrt ein Effekt eine bestimmte Ursache hat, ist es in den stürmischen Zeiten jenseits der Schwelle ganz anders: Viele Faktoren, viele Wirkungen, und alles ist mit allem vernetzt und mit wechselseitigen Auswirkungen miteinander verbunden. Ja, Sie könnten sagen: Das ist das Chaos. Wie furchtbar! Aber es ist viel angenehmer, einfacher und praktischer zu sagen: Das ist die normale, komplexe Welt, mit ihrer zentralen Eigenschaft – Unvorhersehbarkeit.
Das heißt: Wenn Sie ein Ereignis verstehen wollen, hilft Ihnen die Suche nach DER Ursache nicht weiter. Es gibt sie nicht. Und wenn Sie eine Wirkung erzielen wollen, hilft Ihnen DIE Maßnahme nicht weiter. Denn sie erzeugt mit großer Wahrscheinlichkeit eine ganz andere Wirkung als Sie planen. Eine Intervention wirkt immer auf das ganze System, nicht nur auf einen Teil davon, und das Ganze wirkt dann wieder auf den Teil. Mit unvorhersehbaren Ergebnissen. Einfaktorielle Interventionen können Sie derzeit glatt vergessen.
Die Welt, die Wirtschaft, die Gesellschaft verlaufen nicht mehr nach dem so praktischen Ursache-Wirkungs-Prinzip. Aber die Zeit der relativen Vorhersehbarkeit war möglicherweise nur ein Spezialfall der Geschichte, nur eine Phase. Das gegenwärtige Chaos ist die Normalität von heute. Kein Grund zur Aufregung, wir können es nicht ändern. So sehe ich es …