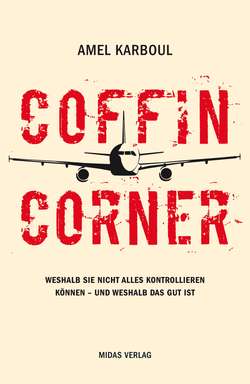Читать книгу Coffin Corner - Amel Karboul - Страница 8
SHIFT HAPPENS Interview: Peter Laudenbach
ОглавлениеFür Amel Karboul sind Veränderungen vor allem eines: eine große Chance. Zumindest, wenn man sie zu nutzen weiß.
Amel Karboul hat wenig Zeit. In den letzten Tagen war sie bei Sitzungen eines Think Tank des Außenministeriums in Berlin, nach dem Interview wird sie nach London zurückfliegen, wo sie lebt. Amel Karboul ist in sehr unterschiedlichen Welten zuhause. Als Ministerin der tunesischen Übergangsregierung hat sie 2014 für die junge arabische Demokratie gearbeitet. Als Unternehmensberaterin coacht sie Führungskräfte, 2007 hat sie das internationale Beratungsunternehmen CLP (Change, Leadership & Partners) mitgegründet. Als Intellektuelle reflektiert sie ihre Erfahrungen in Vorträgen und Aufsätzen. Vor Kurzem ist ihr Buch »Coffin Corner« erschienen, in dem sie darüber nachdenkt, wie sich Führungsaufgaben angesichts von Globalisierung und den Transformationen der Wissensgesellschaft verändern. Innovationen in der Führungskultur von Unternehmen sind in ihren Augen als Antwort auf komplexer werdende Herausforderungen unvermeidlich. Im Gespräch ist sie wach, unprätentiös, konzentriert und direkt – es geht ihr um die Themen, die sie beschäftigen, nicht um Selbstinszenierung.
Frau Karboul, was hindert Organisationen und Unternehmen daran, sich zu erneuern und auf Veränderungen zu reagieren?
Amel Karboul: Wir haben alle mentale Modelle, die uns helfen, uns zu orientieren. Aber sie können uns auch blockieren. Unternehmen wollen möglichst effizient arbeiten. Aber der Versuch, alle Abläufe immer weiter zu optimieren, engt ihre Handlungsspielräume ein. Kennen Sie die Coffin Corner? So nennen Piloten die Flughöhe und Fluggeschwindigkeit, bei der die Maschine am wenigsten Benzin verbraucht und auf den geringsten Luftwiderstand stößt. Mindestund Maximalgeschwindigkeit liegen hier nahe beieinander. Das ist hoch effizient, und es ist gefährlich. Jedes unvorhergesehene Ereignis kann den Absturz auslösen. Die extreme Fokussierung auf Effizienz setzt voraus, dass sich alle Einflussfaktoren kontrollieren lassen. Aber je komplizierter und schneller die Welt wird, desto weniger funktioniert das. Das ist das Paradox: Der Versuch, Sicherheit und Kontrolle herzustellen, führt in einer komplexen Umgebung zu Unsicherheit und Risiko. Wir müssen die reine Effizienz-Orientierung durch eine Vielzahl von Handlungsoptionen ersetzen. Mein Bild dafür ist der Wechsel von einer Autobahn, auf der man immer nur geradeaus fahren kann, zum Anblick des Inneren eines Granatapfels mit unzähligen schillernden Kernen. Diese riesige Auswahl an Möglichkeiten ist komplizert und etwas unübersichtlich – aber auch voller Chancen.
Sie selbst haben ihr Leben sehr abrupt verändert, als Sie sich 2014 entschieden haben, als Ministerin in die tunesische Übergangsregierung einzutreten. Eine wichtige Erfahrung?
Absolut. Ich hatte schon länger den Wunsch, mich stärker gesellschaftspolitisch zu engagieren. Ich dachte eigentlich, dass ich mindestens ein halbes Jahr brauche, um den Rücktritt als CEO von Chance, Leadership & Partners vorzubereiten. Meine Vorstellung war ein langsamer Übergang. Dann kam im Januar 2014 der Anruf von Mehdi Jomaâ, dem tunesischen Übergangspräsidenten. Ich hatte zwei Stunden Zeit, mich zu entscheiden, ob ich nach der demokratischen Revolution in Tunesien Tourismusministerin der Übergangsregierung werden will. Nach dieser Entscheidung hat sich mein Leben innerhalb von 24 Stunden komplett geändert. Gleich zu Beginn der Arbeit als Ministerin war ich mit massiven Vorwürfen konfrontiert, weil ich als Beraterin auch in Israel gearbeitet hatte. Das wollten konservative Kräfte zum Skandal machen. Der Schritt in die neue Funktion kam sehr schnell, ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Und das ging. Wir können viel mehr verändern, als wir glauben, in Organisationen und im eigenen Leben.
Sie haben sich als Ministerin demonstrativ um ein gutes Verhältnis zu Israel und den Juden bemüht und sich damit viel Ärger eingehandelt. Das war auch eine Innovation in der tunesischen Politik, oder?Ja, genau. Das war richtig und notwendig, ich konnte auch einfach nicht anders. Ich weiß, was es heißt, als Angehörige einer Minderheit zu leben. Das verändert den Blick auf andere Minderheiten. Danach bekam ich Morddrohungen und stand 24 Stunden am Tag unter Polizeischutz, ich konnte meine Kinder nur noch selten sehen. Das ist der Preis, den man zahlen muss. Ich bin sicher, dass auch Angela Merkel jetzt Morddrohungen bekommt, weil sie sich für die Füchtlinge einsetzt. Ich bewundere Merkel für ihre klare Haltung.
Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, USA und Europa verhalten sich wie »geschlossene Gesellschaften«, die sich eigentlich nur wünschen, dass sich nichts ändert. Verhindert Wohlstand Innovation?
Das ist eine Gefahr. Es gibt ja den berühmten Satz von Steve Jobs: »Stay hungry, stay foolish.« Das ist wahnsinnig wichtig. Unser Wohlstand ist nicht selbstverständlich. Ich bin in Tunesien aufgewachsen. Dort bin ich oft an den Ruinen von Karthago vorbei gefahren, das war auch einmal eine Weltmacht. Wer weiß, ob Europa in 50 oder 100 Jahren noch so reich ist. Vielleicht sind dann viele Europäer Refugees. Ich hoffe es nicht, aber wir wissen nicht, welche Katastrophen und Veränderungen wir noch erleben werden.
Wie kann man lernen, auf einschneidende Veränderungen mit Innovation zu reagieren?
Veränderung hat mit einem Perspektivwechsel zu tun. Wir machen bei CLP mit Führungskräften Learning Journeys, bei denen es um solche produktiven Irritationen geht. Es verändert den Blick, wenn Führungskräfte aus Europa sehen, dass eine Fabrik der Metallindustrie in Indien moderner und effizienter ist, als sie es sich vorstellen konnten. Wenn ein Unternehmen über seine China- oder Afrika-Strategie nachdenkt, ist es ein Unterschied, ob man das in Konferenzräumen in Stuttgart oder Zürich bespricht oder ob die Verantwortlichen nach in Kapstadt oder Peking fliegen und dort diskutieren. Auch wenn die Teilnehmer, die Fragestellung, die Faktenlage die gleichen sind, es wird eine andere Diskussion. Es geht immer wieder darum, sich solchen produktiven Irritationen auszusetzen.
Wie lassen sich diese lehrreichen Irritationen vom Einzelnen auf Organisationen und Unternehmen übertragen?
Organisationen brauchen Regeln und Routinen, und sie brauchen die Möglichkeit, sie flexibel zu handhaben. Der Unique Selling Point von Menschen ist, dass sie ihre Entscheidungen anders treffen können als regelgesteuerte Maschinen. Menschen setzen Innovation in Gang, nicht Algorithmen. In Zukunft wird es eher um Werte als um Routinen gehen. Müssen Regeln in Unternehmen immer starr und hierarchiegesteuert sein? Das glaube ich nicht. Ich habe zum Beispiel eine Mayo-Klinik besucht, eine der besten Klinik-Ketten in den USA. Ich war beeindruckt davon, wie selbstverständlich es um das Wohl der Patienten geht, und nicht um bis in kleinste geregelt Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten. Die Wirklichkeit ist komplizierter als alle Regelwerke. Und je komplizierter sie wird, desto weniger funktionieren mechanische Regeln. Heute werden in Unternehmen mit einem enormen Aufwand Budgetpläne geschrieben. Oft genug sind sie nach ein, zwei Monaten obsolet. Die Märkte und all die Faktoren, die hineinspielen, kümmern sich nicht um Budgetpläne. Vergesst die Budgetpläne!
Verhindert die Illusion von Sicherheit und Planbarkeit in unbeweglichen Organisationen die Chancen für Innovation?
Die Simulation von Planbarkeit war in der alten Industriegesellschaft leichter. Unter Bedingungen einer großen Stabilität war das sicher auch sinnvoll. Bei den disruptiven Veränderungen, die wir jetzt erleben, funktioniert das nicht mehr. Um die systemischen Kräfte zu durchbrechen, braucht es andere Perspektiven. Deshalb ist Diversität so wichtig. Jemand, der zum Beispiel aus einer anderen Kultur kommt oder eine andere Hautfarbe hat, bringt eine andere Perspektive ein. Wenn man einmal zu einer Minderheit gehört hat, hat man einen anderen Blick auf die scheinbar selbstverständliche Normalität. Man sieht im Gleichen etwas anderes.
Mussten Sie als Ausländerin mit der fehlenden Wertschätzung für Diversität und Blockaden in ihrer Umgebung zurechtkommen?Dauernd. Das war ärgerlich, aber es hat mir auch geholfen. Das schärft den Blick für die Unbeweglichkeit der Apparate. Ein Beispiel: Als ich nach dem Studium für Daimler gearbeitet habe, hat die Ausländerbehörde meine Arbeitserlaubnis nicht verlängert. Ich hatte in Deutschland studiert, ich hatte eine Top-Position im Unternehmen, aber das war der Ausländerbehörde egal. Ich habe meinen Chef panisch angerufen, ich durfte nicht mehr arbeiten, das war´s. Ich habe mich dann in Stuttgart ab- und in Sindelfingen angemeldet, um den Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde zu wechseln. Daimler ist sehr wichtig für Sindelfingen. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber in Sindelfingen habe ich eine unbegrenzte Arbeitserlaubnis bekommen. Ohne diese Flexibilität hätte ich das Land verlassen müssen. Das war etwas crazy. Ein anderes Beispiel, diesmal für eine produktive Erfahrung: Ich war für Daimler in Südafrika. Es gab seit Jahren Probleme mit Mitarbeitern und der Arbeitsqualität. Ich habe vorgeschlagen, die Workshops in einer Stammesprache, Xhosa, zu machen. Es stellte sich heraus, dass die Arbeiter schlicht nicht alles verstanden hatten. Vielleicht kommt man nur auf so eine Idee, wenn man einmal in ein Land gekommen ist, dessen Sprache man nicht versteht. Das war eines meiner ersten Projekte, und es war lehrreich. Man kann mit einer kleinen Intervention viel bewegen. Vielleicht fängt genau so oft ein Prozess der Innovation an.
Beobachten Sie in Unternehmen ab und zu die Mentalität: Was wir machen, hat die letzten 30 Jahre funktioniert, wir machen einfach weiter?
Absolut. Ich sehe, wie viel verschwendet wird, an Ressourcen und an Möglichkeiten. Ich kenne Unternehmen, die merken, dass die alten Regeln nicht mehr funktionieren. Statt etwas zu ändern, reagieren sie mit Hilflosigkeit. Wir haben ein Medizin-Diagnostik-Unternehmen beraten. Der damalige CEO ist jemand, den ich sehr respektiere. Er hat uns ein Video gezeigt, wie er mit Mitarbeitern in einem Workshop über anstehende Veränderungen redet. Er hat keine Diskussion zwischen den Mitarbeitern in Gang gesetzt. Ich habe ihn gefragt, weshalb er das sehr frontal macht, ohne interaktive Einheiten. Er hat mich angesehen und gesagt, er hätte es nicht gelernt, früher war es nicht üblich. Ich kann ihm das nicht vorwerfen. Im Gegenteil, ich war beeindruckt von der Klarheit, mit der er das benannt hat. Wir müssen immer wieder Räume für den Dialog, für die Begegnung schaffen – nicht, weil es sich gut anfühlt, sondern weil es notwendig ist. Solche Vorschläge werden gerne als Esoterik abgewertet. Aber Followership, die beziehungsorientiert funktioniert, wird so wichtig werden wie Leadership. Das müsste zur Ausbildung von Führungskräften gehören. Ich glaube, viele haben da noch ein echtes Defizit. Die Harvard Business School hat Followership-Kurse angeboten. Die Leadership-Kurse waren immer voll, der Followership-Kurs war am Anfang fast leer.
Weshalb ist Followership so wichtig?
Weil die Aufgaben zu komplex sind, als dass nur ein starker Leader oder eine Gruppe von Führungskräften alles steuern könnten. Ihre Aufgabe wird es sein, die Eigenverantwortung der Mitarbeiter zu stärken. In Zukunft wird jeder viel stärker für sich selbst verantwortlich sein. Ich glaube nicht, dass uns ein guter König oder unser Arbeitgeber diese Arbeit abnimmt. Vielleicht haben uns Organisationen in der stabilen Zeit der alten Industriegesellschaft daran gehindert, erwachsen zu werden. Es war bequem, die Verantwortung für das eigene Handeln an die Organisation zu delegieren. Jeder hatte sein Plätzchen. Menschen, die zu Minderheiten gehörten oder, egal aus welchen Gründen, nicht so ein bequemes Plätzchen hatten, haben vielleicht etwas klarer den Preis der Bequemlichkeit, die Entmündigung, gesehen. Es gab mal einen brand-eins-Titel: »Führung – Scheißjob.« Natürlich ist es das manchmal. Du musst Dich selber verändern, dabei bist Du auch verletzlich. Du bist mit Deiner eigenen Transformation beschäftigt, das ist anspruchsvoll genug. Und gleichzeitig musst Du das System transformieren, damit es Deine eigene Veränderung akzeptieren und selber in die neue Verantwortung wachsen kann. Das ist ein anspruchsvolles Paradox. Solche Transformationen können Ängste auslösen. William Bridges nennt das »Noman´s Land«. Das alte ist nicht mehr da und das neue ist noch nicht da. Man hat in solchen Übergangsphasen viel mit Angst, Unsicherheit, Zweifel zu tun.
Müssen wir uns daran gewöhnen, dass solche Transformationsprozesse der Normalzustand werden?
Ich glaube schon. Die Frage ist dann, wo bekommt man seine Sicherheit her? Organisationen haben den Leuten ja auch eine Orientierung und Identität gegeben. Das kann in Zukunft nur noch aus jedem selbst kommen. Ich meditiere zum Beispiel täglich, selbst als ich in der Regierung unter massivem Druck stand. Das war wirklich meine Überlebensstrategie, anders hätte ich es nicht geschafft. Das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle: Was gibt uns in dieser Ambiguität und permanenten Transformation einen Halt?
Wie sieht die permanente Transformation in Ihrem Leben aus?
Ich habe eigentlich drei oder vier Identitäten. Ich habe meine Firma, ich bin Gründerin, aber nach der Rückkehr aus der Politik muss ich meine Rolle im Unternehmen neu finden. Ich habe zwei Kinder. Ich war in der tunesischen Regierung, und natürlich bin ich dem demokratischen Umbruch in der arabischen Welt weiter stark verbunden. Ich bin Generalsekretärin des Maghreb Economic Forum, ein Think Tank, der Wirtschaftsreformen in den nordafrikanischen Ländern begleitet. Die Zukunft der tunesischen Demokratie wird auch von den wirtschaftlichen Perspektiven abhängen. Und ich versuche, mir mit dem Schreiben und den Vorträgen immer wieder Reflexionsräume zu schaffen.
Klingt anstrengend.
Ich glaube, die Transformationsphase wird nie abgeschlossen sein. In dem Land, aus dem ich komme, Tunesien, haben viele Menschen keinen Zugang zu akademischer Bildung oder zu einem funktionierenden Gesundheitsystem. Aber sie sind daran gewöhnt, mit Unsicherheit umzugehen.
Das sagen Sie, als wäre Unsicherheit eine Ressource.
Ja, auf jeden Fall. Zugang zur Ressource Unsicherheit und die Fähigkeit, mit ihr umzugehen, wird immer wichtiger. Auch deshalb glaube ich, dass Afrika eine große Zukunft hat. Hier in Europa sieht man das noch nicht richtig, man sieht oft nur die Elends-Klischees und verpasst die großen Potentiale. China ist da wesentlich klüger. Alle neuen Potentiale, die auf uns zukommen, sind mit starken Unsicherheiten behaftet. Wer Angst davor hat, verpasst Chancen.
Haben Sie ein Beispiel dafür, wie Europa in Afrika Chancen verpasst?
Zum Beispiel beim Marktzugang für innovative afrikanische Firmen oder der Bereitschaft zur Kooperation. Es gab bei einem marokkanischen Versicherungsunternehmen, das in ganz Afrika expandiert, ein Angebot an die Allianz, da zu investieren. Die Allianz hat das, vielleicht auch aus Angst vor Unsicherheiten und dem afrikanischen Markt, nicht gemacht. Investoren aus dem Mittleren Osten und aus Asien sind eingestiegen. Dieses Unternehmen ist heute die größte Versicherung Afrikas, extrem profitabel und schnell wachsend. Ein anderes Beispiel: Eine sehr innovative tunesische IT-Firma, die Software für die Finanzindustrie entwickelt. Bei einem Pitch sagte ein deutscher CFO sinngemäß: A Company from Tunesia – that´s a joke. Sie kamen nicht in den europäischen Markt. Dann haben sie eine marode belgische IT-Firma gekauft. Seit sie als europäische Firma wahrgenommen werden, haben sie europäische Kunden, bis hin zur Bank of England. Aus ähnlichen Gründen hat ein tunesischer Kabelhersteller eine portugiesische Firma gekauft. Nur so wurden sie ernst genommen und konnten in Europa wachsen. Diese europäische Ignoranz ist eigentlich unglaublich. Das ist auch der Grund, weshalb wir unser LCP-Headquarter von Tunis nach London verlegt haben.
Ist Europa etwas provinziell?
Wir müssen verstehen, dass Europa, Nordafrika und der Nahe Osten eine Region sind, auch wenn Europäer glauben, Zäune bauen zu müssen. Das Worst-Case-Szenario: Europa wird obsolet aus Altersgründen, es wird ein Museum für Touristen aus Asien und Amerika. Nordafrika wird immer ärmer bei wachsender Bevölkerung. Es werden mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken, andere radikalisieren sich. Der Nahe Osten investiert seine Milliarden in Asien und Amerika. Ein Best-Case-Szenario könnte aus Kooperation bestehen: das europäischen Wissen und die Managementerfahrung, kombiniert mit den vielen jungen, hochmotivierten, zum Teil auch gut ausgebildeten Nordafrikanern und den finanziellen Mitteln des Nahen Ostens. Wir haben alles, was man braucht: Knowhow, junge Leute und Geld. So könnte man Europa vital halten und aus Afrika das nächste China machen. Das ist eine große Chance, aber dafür müssen wir uns von unseren mentalen Barrieren befreien. Ich habe dieses Szenario in einem Vortrag bei den Baden Badener Unternehmergesprächen vor vielen Führungskräften entwickelt und war überrascht, auf welches Interesse meine Überlegungen bei Vorständen von DAX-Konzernen gestoßen sind.
Müssen sich die deutschen Unternehmen umbauen, um zukunftsfähig zu werden, zum Beispiel für dieses Best-Case-Szenario?
Ja, sicher. Und das kann anstrengend sein. Wir haben einen größeren deutschen Mittelständler beraten, der sich stärker internationalisieren wollte und damit Schwierigkeiten hatte. Mit den Führungskräften waren wir mit den Mittelständlern bei John Deere, ein großer Landwirtschaftsmaschinen-Hersteller, der seine Internationalisierung sehr gut hingekriegt hat. Die Antwort der John-Deere-Leute war glasklar: Wir haben alles probiert, es gibt nur einen Weg der funktioniert. Stellt internationale Leute ein, auch im Vorstand. Der deutsche Mittelständler hatte einen Holländer im Vorstand, nicht gerade ein Culture Clash. Der Holländer wäre fast wieder rausgeflogen, weil er kulturell so angeeckt ist. Vielleicht sind die simpelsten Veränderungen manchmal die schwierigsten und die wirkungsvollsten. Ich selbst war nach dem Studium bei einem großen deutschen Konzern im internationalen Trainee-Programm. Der Konzern hat viel Geld ausgegeben, um junge Professionals mit anderem kulturellen Hintergrund in sein Unternehmen zu holen. Aber am Ende wurde keiner der Asiaten und Afrikaner übernommen, und das lag sicher nicht daran, dass sie nicht gut gewesen wären. Solche mentalen Blockaden können am Ende sehr teuer werden. Man muss die Leute nicht nur einstellen, man muss sich auch für sie öffnen. Und man muss wahrscheinlich auch eine kritische Masse einstellen. Drei oder vier Leute verändern keine Kultur. Deshalb ist es eine gute Nachricht für Deutschland, dass jetzt eine Million Flüchtlinge aus Syrien und anderen Ländern hier leben wollen. Das ist super, eine riesige Chance.