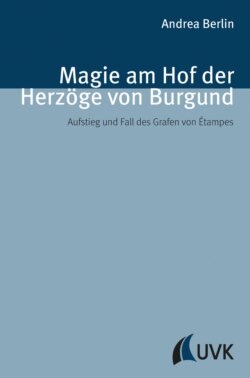Читать книгу Magie am Hof der Herzöge von Burgund - Andrea Berlin - Страница 11
1.2. Historische Hinführung 1.2.1. Zur burgundischen Geschichte im 15. Jahrhundert
ОглавлениеDer in der Forschung vorherrschende Begriff des burgundischen Staates59 bezeichnet ein ungewöhnliches politisches Gebilde im ausgehenden Mittelalter.60 Es entstand im 14. Jahrhundert mit der Vergabe des Herzogtums Burgund durch den französischen König Johann II. (1350 – 1364) an seinen jüngsten Sohn Philipp (1363 – 1404), als eine Seitenlinie des Königshauses Valois. Dieser Herzog wurde später als Philipp der Kühne bekannt. Das zunächst vergleichsweise kleine Herzogtum schaffte es innerhalb weniger Jahrzehnte, zu einem der Zentren des westeuropäischen Machtgeschehens zu werden. Diese Entwicklung vollzog sich durch die schrittweise, aber beständige Ausweitung des burgundischen Besitzes durch Erwerb, Erbe, Heirat und Krieg, die aber durch einen steten Bezug zum französischen Königtum geprägt blieb. Das dadurch entstandene Gebiet, der état bourguignon, umfasste neben dem Herzogtum und der Freigrafschaft Burgund auch Herrschaften im heutigen Belgien, den Niederlanden und Luxemburg. Die Herzöge von Burgund waren dadurch nicht nur von Frankreich, sondern auch vom Reich her lehnsabhängig. Daneben war das Herzogtum, insbesondere während der Zeit des Hundertjährigen Krieges, auch durch Verbindungen zum englischen Königshaus geprägt.61
Die vorliegende Studie beschäftigt sich speziell mit Ereignissen in den letzten Regierungsjahren Herzog Philipps des Guten (1419 – 1467) zu Zeiten sich verschärfender Konflikte mit seinem Sohn, dem späteren Karl den Kühnen (1467 – 1477). Daher soll im Folgenden in einigen groben Zügen die historische Situation um die Mitte des 15. Jahrhunderts, in die sich die Fallstudie des Processus contra dominum de Stampis einfügt, umrissen werden.
Die Herrschaft Herzog Philipps des Guten begann mit einem Mord, der das Verhältnis zwischen Frankreich und Burgund nachhaltig beeinflussen sollte. In der Spätphase des Hundertjährigen Krieges kam es durch Konflikte zwischen den Burgundern und den Armagnacen auch zu starken innerfranzösischen Auseinandersetzungen.62 Im Zuge dessen waren Annäherungen zwischen Karl VI. (1380 – 1422), dem Dauphin und den Burgundern notwendig geworden.63 Eines der anvisierten Treffen zwischen dem zweiten Herzog von Burgund, Johann Ohnefurcht (1404 – 1419), und dem Dauphin endete jedoch am 10. September 1419 in Montereau-fault-Yonne mit der Ermordung Johanns Ohnefurcht.64 Der Mord an seinem Vater führte dazu, dass sich der neue Herzog von Burgund, Philipp der Gute, verstärkt England zuwandte, wenngleich der französisch-burgundische Kontakt nicht vollkommen abriss. Zu einer ernsthaften diplomatischen Annäherung und einem Friedensschluss zwischen Frankreich und dem Haus Burgund kam es im Jahr 1435 mit dem Vertrag von Arras.65 Dies bedeutete zunächst vor allem das vorläufige Ende der anglo-burgundischen Beziehungen; das burgundisch-französische Verhältnis blieb jedoch trotz des Friedensschlusses angespannt und wurde insbesondere durch den Konflikt Karls VII. (1422 – 1461) mit seinem Sohn Ludwig und der Flucht des Dauphins an den burgundischen Hof 1456 noch verschärft.66 Philipp gewährte dem jungen Ludwig seine Gastfreundschaft, die dieser bis zum Tode des Vaters 1461 annahm. Bereits zu dieser Zeit soll der Dauphin eine Abneigung gegen Prunk und Gepränge gehegt haben; eine Abneigung, die sich in der Nähe der burgundischen Macht- und Prachtentfaltung vergrößert haben mag.67 Bei der Krönung Ludwigs XI. (1461 – 1483) zum französischen König ist das Haus Valois-Burgund aber als angesehener Gast vertreten. Diese Vorgeschichte mag Philipp den Guten dazu veranlasst haben, auf ein gutes Verhältnis zu Frankreich und auf einen gewissen Einfluss auf dessen neuen Regenten zu hoffen. Seine Erwartungen wurden indes durch das ambitionierte machtpolitische Agieren des Königs enttäuscht. Ludwig XI. versuchte vielmehr seit Beginn seiner Regentschaft, den Einfluss Burgunds einzudämmen.68
Dieses Vorgehen war aus französischer Sicht nur zu verständlich, zählte Philipp der Gute doch durch die glänzende Entwicklung seines Herzogtums zu den mächtigsten Fürsten in Westeuropa. So hatte sich der Herzog zunächst in einem mehrere Jahre dauernden, durchaus auch kriegerischen Ringen mit seiner Cousine Jacqueline die Grafschaften Hennegau, Holland und Zeeland gesichert.69 In anderen Fällen verlief der Gebietszuwachs friedlicher. So konnte er die Grafschaft Nemours käuflich erwerben, während das Herzogtum Brabant als Erbschaft an ihn fiel.70 Hinzu kam der Erwerb des Herzogtums Luxemburg und der kleineren Herrschaften Mâcon und Auxerre.71 1461 befand sich Philipp zudem in der Position, mehrere Revolten von Städten seiner nördlichen Territorien niedergeschlagen zu haben, unter denen besonders der lange währende Krieg gegen Gent hervorzuheben ist.72
Die selbstbewusste französische Politik Ludwigs XI. führte zu weiteren Spannungen im burgundisch-französischen Verhältnis, da auch der Graf von Charolais als zukünftiger burgundischer Herzog ihr in Sorge um sein Erbe äußerst kritisch gegenüber stand. Insbesondere der Rückkauf der Somme-Städte im Jahr 1464 verschärfte die Abneigung Karls gegen den französischen König und erhöhte zugleich die Spannungen zwischen Herzog Philipp und seinem Sohn.73 Die königliche Politik rief allerdings nicht nur in Burgund Ablehnung hervor, sondern führte zu der Formierung einer Opposition französischer Fürsten, der Ligue du Bien Public. Die Unzufriedenheit mündete in die sogenannten Guerre du Bien Public, einen Krieg mehrerer französischer Fürsten gegen Ludwig XI., in dem Karl von Burgund faktisch die Führung gegen den König übernahm. Die berühmte Schlacht von Montlhéry am 16. Juli 1465 brachte aber keine Entscheidung. Ludwig musste nach Paris flüchten, wo er mehrere Monate von seinen Gegnern belagert wurde.74 Erst mit dem Vertrag von Conflans im Oktober 1465 konnten die Konflikte für einige Zeit unterdrückt werden. Die Auseinandersetzungen zwischen Karl und Ludwig brachen allerdings nach dem Tod Philipps des Guten wieder aus und führten zu weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen, die erst mit dem Vertrag von Péronne 1468 beigelegt wurden.75
Die herausragende Stellung, die die Herzöge von Burgund unter den französischen Fürsten einnahmen, führte nicht nur zu Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen mit Frankreich und den mit dem Königtum verbündeten Fürsten. Es ergaben sich zudem, insbesondere aus dem Bestreben, die burgundische Erbschaftsfolge zu sichern, zahlreiche inner-burgundische Konflikte, auf die an späterer Stelle noch einzugehen sein wird.76 Diese Konfliktsituationen bilden gleichsam den Rahmen für die vorliegende Studie.
Der Graf von Étampes nun war nicht nur als Familienmitglied dem Haus Burgund eng verbunden. Er stand Philipp dem Guten auch bei dessen militärischen Unternehmungen zur Seite. Jedoch wurden dem Grafen seitens des burgundischen Erben Karl schwere Vorwürfe gemacht, ein Komplott gegen ihn geplant zu haben. Diese Vorwürfe reichten dabei bis zu der Anschuldigung, der Graf von Étampes habe ihm, damals noch Graf von Charolais, mittels Wachsfigurenmagie schaden wollen. Der Fall Étampes reiht sich damit in die zahlreichen Prozesse des späten Mittelalters ein, die wegen Verrats, Illoyalität oder eines Anschlagsversuchs auf den König oder einen Fürsten geführt wurden. Unabhängig davon, ob solche Vorwürfe nun gerechtfertigt waren oder nicht, wurden diese Prozesse häufig dazu genutzt, um unliebsame Gegner aus dem Weg zu räumen.