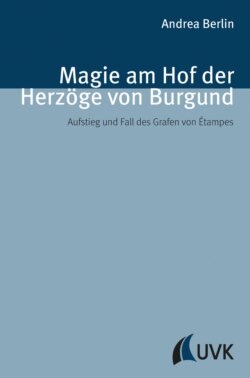Читать книгу Magie am Hof der Herzöge von Burgund - Andrea Berlin - Страница 9
1.1.1.3. Gedruckte Quellen
ОглавлениеForschungen über die französische und burgundische Geschichte werden durch mehrere größere Editionen und laufende Editionsprojekte erleichtert, die für diese Arbeit herangezogen werden konnten. Für die Ereignisse um den angeblichen Zaubereianschlag des Grafen von Étampes unmittelbar wichtig sind die Editionen der Protokollbücher des Ordens vom Goldenen Vlies, die von Sonja Dünnebeil bearbeitet werden und seit 2002 in der Instrumenta-Reihe des Deutschen Historischen Instituts Paris erscheinen.16 Von Relevanz ist hier insbesondere das zweite Protokollbuch, in dem die Kapitelsitzung in Brügge aus dem Jahre 1468 und damit der Ausschluss des Grafen von Étampes aus dem Orden vom Goldenen Vlies dokumentiert ist.
Zu den älteren Editionen gehören diejenigen der Briefbestände französischer und burgundischer Adeliger. Verwendung konnten davon die Lettres de Louis XI. finden, in denen allerdings nur die durch Ludwig geschriebenen, nicht die von ihm empfangenen Briefe ediert sind.17 Die edierten Briefe Karls des Kühnen verzeichnen hingegen sowohl solche, die er selbst verfasst hat, als auch Briefe, die er empfangen hat.18 Die Anzahl der Schriftstücke insgesamt ist allerdings geringer als die des französischen Königs. Auch für die Geschichte der burgundischen Niederlande oder das Wirken der Herzöge in diesem Gebiet wurden ausführliche Editionen historischer Werke oder kleinere Quellenbestände bereits seit dem 19. Jahrhundert herausgegeben und konnten für diese Arbeit herangezogen werden.19
Eine zentrale Quelle der geschichtswissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Aufstieg und Fall des burgundischen Herzogtums im 14. und 15. Jahrhundert ist seit jeher die zeitgenössische Chronistik gewesen. Das betrifft durchaus auch französische Blicke auf das Herzogtum, etwa von Froissart oder den Chroniques de France, in erster Linie wird aber die ungewöhnlich reiche Geschichtsschreibung, die im Umfeld der burgundischen Herzöge selbst entstanden ist, herangezogen.20 Die Erscheinungsformen, Schreibanlässe und auch die Tendenzen der burgundischen Geschichtsschreibung sind ausgesprochen vielfältig; ebenso sind es die Selbstbezeichnungen. Neben den Begriffen mémoires oder chroniques findet sich oft auch der Ausdruck récueil. Trotz dieser unterschiedlichen Bezeichnungen lassen sich aber auch gewisse Parallelen herausarbeiten.21 Gemeinsam ist allen Werken zunächst die volkssprachige Abfassung; lateinische Historiographie in Prosaform entsteht am burgundischen Hofe nicht mehr. Gemeinsam ist den Chronisten auch die thematische Nähe zum burgundischen Hof, nehmen dessen Herzöge und ihre Taten doch großen Raum in den burgundischen Chroniken ein; ein Umstand, den die Herzöge auch durchaus für sich zu nutzen wussten. So urteilt Jean Devaux: »jamais, jusque-là, aucune maison princière n’avait bénéficié d’une production aussi soutenue qui fût à même de transmettre à la postérité les glorieux faits d’armes accomplis sous son égide.«22 Die Chronisten bemühten sich nach eigenen Aussagen um eine möglichst neutrale, wahrheitsgetreue Berichterstattung, auch wenn sich bei einigen Autoren zumindest gewisse Sympathien oder Antipathien für die Protagonisten ihrer Erzählungen, wenn nicht offene Parteilichkeit erkennen lassen.23 Die Verpflichtung, nur die tatsächlichen Ereignisse aufschreiben zu wollen, hatte auch Einfluss auf die Belegpraxis der Chronisten. Während im 13. und 14. Jahrhundert Augenzeugenberichte einen hohen Stellenwert zu haben schienen, tauchten im 15. Jahrhundert vermehrt Verweise auf namhafte Werke auf, wie es schon in der antiken Geschichtsschreibung gängige Praxis war.24 Oft handelte es sich hierbei um Chronisten früherer Jahre. Weiterhin wurden Ereignisse aber auch mit dem Verweis auf – namentlich genannte oder anonyme – Augenzeugen oder mit der Kennzeichnung als eigene Erlebnisse belegt.25
Zu den burgundischen Chronisten, die in dem genannten Zeitraum gelebt und gewirkt haben, gehören Enguerrand de Monstrelet (ca. 1390 – 1453), Jean le Fèvre de Saint-Remy (ca. 1395/96 – 1468), Jean de Wavrin (ca. 1400 – nach 1471), Mathieu d’Escouchy (ca. 1420 – nach 1482), Jacques du Clercq (1420 – 1501), Jean de Haynin (1423 – 1495), Georges Chastelain (um 1405 – 1475), Jean Molinet (1435 – 1507) und Olivier de la Mache (um 1425 – 1502). Eine Einschränkung für ihre Auswertung in der vorliegenden Arbeit ergibt sich aber aus der Lebenszeit und der erzählten Zeit der Chronisten, sodass sich eine Beschränkung auf die Chronisten Jean de Wavrin, Jacques du Clercq und Georges Chastelain ergibt, bei denen die Ereignisse um das Jahr 1463, also die Aufdeckung des Komplotts, oder der Ausschluss des Grafen aus dem Orden vom Goldenen Vlies 1468 erwähnt werden. Für die Darstellung anderer Ereignisse wiederum kann auf die Werke der anderen genannten Autoren zurückgegriffen werden.
Von den genannten drei Autoren, die als besonders aussagekräftig für die vorliegende Studie gelten dürfen, ist der indiciaire Georges Chastelain der bekannteste, was sich sowohl in der älteren als auch in der aktuellen Forschung niederschlägt.26 Er war als Historiograph in den Diensten zunächst Herzog Philipps des Guten, später auch bei Karl dem Kühnen tätig; er hat aber auch – vielleicht kann man sogar sagen: vor allem – als Dichter großen Ruhm erworben. Chastelains Chronique, die nur fragmentarisch überliefert ist,27 hat nicht nur unter Zeitgenossen, sondern auch in späteren Generationen interessierte Leser gefunden. Graeme Small hat dies in einem sehr illustrativen Beitrag aufgearbeitet, der den sich wandelnden Interessen an dem Chroniktext nachgeht.28 Die zeitgenössische Beliebtheit seiner Chronique, die sicher auch aus Chastelains dichterischer Prominenz heraus erklärlich wird, mag noch dadurch verstärkt worden sein, dass er selbst immer wieder die besondere Verantwortung seines Amts betonte.29 Er stellte bei allem Bemühen um Objektivität doch merklich sich und sein Werk in den politischen Dienst des Herzogs und der Führungseliten. Seine besondere Favorisierung des burgundischen Adels hat sogar die Frage aufgeworfen, ob Chastelain nicht selbst zum Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies geschlagen wurde.30
Jacques du Clercq und Jean de Wavrin haben erst in den letzten Jahrzehnten wieder verstärkt das Interesse der historiographiegeschichtlichen Forschung auf sich gezogen – ohne freilich, dass dieses Interesse je gänzlich abgebrochen war. Beide sind, wie bereits 1946 Jean Stengers herausgearbeitet hat, in ihren Arbeiten von der Chronik des selbsterklärten Froissart-Fortsetzers Enguerrand de Monstrelet abhängig.31 Über Jacques du Clercq ist als Person erstaunlich wenig bekannt; alle wesentlichen Details entstammen seinen Mémoires selbst.32 In der burgundischen Chronistik nimmt der Sohn eines Rats Philipps des Guten aus Lille eine Sonderstellung ein, weil er sein Werk offenbar selbstständig, jedenfalls ohne Referenz an einen fürstlichen Auftraggeber oder Adressaten verfasste – er schreibt à distance, wie Franck Mercier feststellte,33 was sich nicht nur auf die Darstellung, sondern unter Umständen auch auf den Grad der Informiertheit ausgewirkt haben könnte. Dem steht entgegen, dass du Clercq bei der Abfassung seiner Arbeit durchaus auch auf amtliche Schriftstücke zurückgegriffen hat.34 Ferner wird ein didaktischer Anspruch und eine Nähe zum Adel deutlich, die ihm möglicherweise seine Leserschaft am burgundischen Hof bescherten.35 »Er stand also«, folgert Klaus Oschema wohl zu Recht, »der Adels- und Hofkultur seiner Zeit vermutlich näher, als es die wenigen konkreten Details seiner Biographie, die wir kennen, zu zeigen vermögen.«36
Gelesen wurde du Clercq jedenfalls am burgundischen Hofe, denn Jean de Wavrin greift bei der Abfassung seines Werkes auf ihn zurück.37 Aus einer angesehenen flandrischen Familie stammend, aber unehelich geboren nahm dieser seiner Herkunft nach zunächst eine ambivalente Rolle in der burgundischen Hofgesellschaft ein, scheint dann aber eine steile Karriere am Hof gemacht zu haben.38 Mehrfach war er im Auftrag Philipps des Guten in Frankreich, England und Italien;39 auch unter Karl dem Kühnen war er beschäftigt. Bedeutsam ist ferner seine große Sammlung von Büchern gewesen, die Antoinette Naber näher untersucht hat.40 Wavrins Receuil des croniques et anchiennes istories de la Grant Bretaigne, a présent nommé Engleterre wurden und werden verstärkt von der britischen Forschung beachtet;41 seine besondere persönliche Stellung als Chronist zwischen England und Burgund hat vor einigen Jahren noch Alain Marchandisse beleuchtet.42