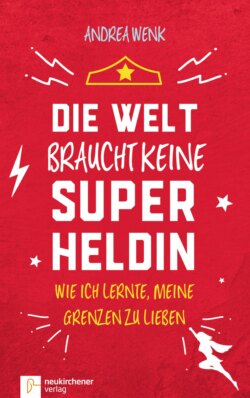Читать книгу Die Welt braucht keine Superheldin - Andrea Wenk - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Das Leben ist (k)ein Ponyhof
„Weite Räume meinen Füßen,
Horizonte tun sich auf,
zwischen Wagemut und Ängsten
nimmt das Leben seinen Lauf.“
Eugen Eckert1
Beim Thema „Grenzen“ und wie wir damit umgehen, lohnt es sich, einen Blick zurück in die eigene Kindheit zu werfen. Ich möchte dich an meinem Rückblick ein wenig teilhaben lassen:
Als Kind wurde ich durch die Struktur meiner Familie und die äußeren Umstände geprägt. Unbewusst zog ich damals Schlussfolgerungen für mein Leben und eignete mir Strategien an, wie ich erfolgreich durchs Leben gehen könnte. In diesen ersten Jahren meines Lebens legte ich durch positive und negative Erfahrungen meine Möglichkeiten und Grenzen fest, das heißt meine innere Überzeugung, wozu ich fähig bin oder was ich eben nicht kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass meine Kindheit mich prägte, wie eng oder wie weit ich meine eigenen Grenzen heute setze. Dazu gehören innere Werte, die mein Verhalten bestimmen, zum Beispiel wann etwas „gut“ oder „schlecht“ ist, aber auch die Einstellung, wie man mit Problemen und Herausforderungen umgeht. Wie viel Mut bekam ich mit, um „unbekanntes Land“ zu erkunden? Wie entmutigt wurde ich durch gewisse Erfahrungen, sodass ich lieber in den engen Mauern meiner „Stadt“ blieb? Natürlich spielte mein Charakter auch noch eine Rolle. Es gibt die extrovertierten, freiheitsliebenden Menschen, denen kein neues Abenteuer zu viel ist. Wie du im Verlauf dieses Buches feststellen wirst, gehöre ich nicht zu dieser Sorte Menschen, aber trotzdem erlebte ich so manches Abenteuer.
Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann gibt es für mich ein „Vorher“ und ein „Nachher“. Es gab die Zeit bis zur vierten Klasse und zum Übertritt in die weiterführende Schule, die ich als pure Freiheit erlebte. Überwiegend schöne Erinnerungen hege ich an diese Zeit. Ich wuchs in einem sehr kinderreichen Stadtviertel auf. Die schulfreien Nachmittage verbrachte ich spielend mit anderen Kindern draußen rund ums Haus: Räuber- und Gendarmenspiel, Verstecken, Tischtennis, Fahrradfahren, Rollenspiele und Abenteuer erleben. Das Leben war in meinen ersten zehn Jahren ein echter Ponyhof. Ich fühlte mich geschätzt, fähig und voller Lebenslust. Dabei orientierte ich mich gerne nach außen, hin zu Freunden und Schulkameraden. Vertrauensvoll, wie ich war, konnte ich mir damals nicht vorstellen, dass es im Leben je etwas geben könnte, was mir nicht gelingen oder bei dem ich auf Widerstand stoßen würde. Ich war eine sehr gute Schülerin, hatte Freude am Unterricht und brachte immer Bestnoten im Zeugnis mit nach Hause. Kurz: Es lief alles wie „geschmiert“!
Als ich etwa zehn Jahre alt war, geschahen zwei einschneidende Dinge: Meine Eltern lernten Jesus kennen, entschieden sich für ein Leben mit ihm und wir besuchten von da an eine evangelische Gemeinde. Gleichzeitig wechselte ich in die weiterführende Schule. Ersteres veränderte mein Leben im Nachhinein betrachtet positiv, Zweiteres schleuderte mich in null Komma nichts in die „Nachher-Phase“ meiner Kindheit.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich während meiner ersten Jungschar-Pfingstfreizeit Jesus in mein Leben eingeladen hatte. Es war so selbstverständlich geschehen, wie nur Kinder glauben können. Von da an nahm ich immer meine Bibel in die Schule mit, zeigte sie meinen Freunden ganz stolz und erzählte ihnen von Jesus. Als ich dann in die weiterführende Schule und dementsprechend in ein anderes Schulgebäude wechselte, veränderten sich nicht nur der Schulstoff, die Lehrer und die Klassenkameraden. Von nun an wurde auch mein Glaube an Jesus anders bewertet. Während meiner restlichen fünf obligatorischen Schuljahre war ich der „Fisch“. In den 1990er-Jahren war es als Christ damals Ehrensache, auf seinem Auto oder Fahrrad einen Fischaufkleber zu haben und sich somit gleich bei allen als Nachfolger von Jesus zu „outen“. Auf der einen Seite trug ich dieses Zeichen mit Stolz, auf der anderen Seite machte es mich aber auch zur Außenseiterin. Das erste Mal in meinem Leben wurde ich mit Ablehnung konfrontiert und dem Gefühl, „nicht dazuzugehören“. Ich wusste nicht recht, wie ich mit dieser Tatsache umgehen sollte.
Ich stieß an eine Grenze – eine Grenze, die Menschen ziehen, wenn sie sich eines Klischees oder eines Vorurteils bedienen.
So stieß ich an eine Grenze – eine Grenze, die Menschen ziehen, wenn sie sich eines Klischees oder eines Vorurteils bedienen. Sie sahen den „Fisch“ an meinem Fahrrad und steckten mich gleich in eine Schublade mit den Vorurteilen „langweilige Spaßbremse“ und „fromme Streberin“. In dieser Schublade wurde es mir manchmal echt eng und ich hatte immer das Gefühl, dass mich die meisten meiner Klassenkameraden nie so wahrnahmen, wie ich wirklich war. Es gelang mir bis zum Ende der Schulzeit nicht, mich aus dieser Schublade zu befreien. Einerseits hielten mich die vorgefertigten Meinungen meiner Klassenkameraden in diesen engen Grenzen gefangen, andererseits ließ ich mich aber auch eingrenzen, ohne mich wirklich dagegenzustellen.
Während meiner ersten Kindheitsphase hatte ich viele Freundinnen und war ein wichtiger Teil eines Ganzen; ich war lebensfroh, laut und ideenreich. Dadurch gelang es mir auch oft, den Ton anzugeben oder ein Spiel zu bestimmen. Der „Abstieg“ zur Außenseiterin war hart für mich und löste noch lange Zeit Beklemmungsgefühle aus. Ich hatte zwar auch in der weiterführenden Schule Freundinnen, nur einfach nicht mehr die „Hippen“ und „Coolen“ der Gruppe. Während dieser Zeit habe ich meine Freundin Steffi kennengelernt, und wir gingen lange zusammen durch dick und dünn. Wir wurden mit „Streberin“ und „Fisch“ betitelt, aber was machte das schon, wenn man auf die tiefe und wertvolle Qualität der daraus entstandenen Beziehung blickt?!
In der weiterführenden Schule machte mir aber nicht nur das soziale Umfeld zu schaffen, sondern auch das schulische Niveau. Von Bestnoten während der Grundschulzeit fielen meine Leistungen, vor allem in Mathematik, auf knapp genügend. Der Leistungsdruck stieg an und ich konnte ihm manchmal fast nicht standhalten. Einige der Lehrer waren noch von der alten Garde; in jungen Jahren durften sie die Schüler körperlich züchtigen. Ihr Verständnis von Pädagogik könnte man heute als verstaubt bezeichnen und ich fühlte mich damals so eingeschüchtert von ihnen, dass ich Lern- und Denkblockaden entwickelte. Im Matheunterricht zeigten sie sich am stärksten: Im Schnellrechnen musste die ganze Klasse auf den Tischen stehen. Der Schüler, der am schnellsten die Lösung einer Rechenaufgabe rief, konnte sich hinsetzen. Ich stand regelmäßig als Einzige noch hoch oben auf dem Tisch – beschämt … entmutigt … erniedrigt.
Erst viel später während meiner Ausbildung zur individualpsychologischen Lebensberaterin erkannte ich, dass sich aus diesem „Vorher“ und „Nachher“ meiner Kindheit ein innerliches Bewegungsgesetz entwickelt hatte. Diese zwei Phasen wiederholten sich immer wieder in meinem Leben! Als ich jung war, wechselten sie sich ab. Heute laufen sie parallel und bemühen sich ums Gleichgewicht. Das „Vorher“ war von Spielen und Freude, von Unbefangenheit und Vertrauen geprägt – ich nenne diese Phase „Spielen“. Im „Nachher“ musste ich mich beweisen, Leistung bringen und durchbeißen, deshalb nenne ich es heute „Alltag“.
Mit der Zeit entwickelte ich die Fähigkeit, mich in beiden Phasen zu bewegen. Ich wurde in der zweiten Hälfte meiner Kindheit nicht so sehr entmutigt, dass ich nicht mehr gewagt hätte, zu leben und zu spielen. Denn es gab in dieser Zeit ja nicht nur die Schule, sondern auch mein Privatleben, das immer mehr geprägt wurde von der Kirchengemeinde und meinen christlichen Freunden. Dort wurde ich angenommen, wie ich war, machte tolle Erlebnisse und lernte durch ältere Vorbilder vieles von Gott und dem Leben mit Jesus. Ich denke, das hat viel dazu beigetragen, dass mein Horizont nicht so eng wurde, als dass er mir die Luft zum Atmen genommen hätte.
Allerdings entwickelte ich durch die Erfahrungen während meiner zweiten Kindheitsphase eine latente Menschenfurcht. Das vertrauensvolle Mädchen, das meinte, niemand könne ihm etwas anhaben, musste die Erfahrung machen, dass es auch abgelehnt werden konnte. Bis heute spüre ich eine gewisse Vorsicht im Umgang mit Menschen, die ich nicht gut kenne. Ich gehe nicht automatisch davon aus, dass sie mir wohlgesinnt sind. In mir liegt ein recht tief verwurzeltes Misstrauen, dass mein Gegenüber mir vielleicht Böses antun will. Deshalb gebe ich nicht gleich schon am Anfang einer neuen Beziehung persönliche Dinge preis, die mich verletzbar machen. Ich brauche immer einige Zeit, bis ich anderen vertrauen und mich öffnen kann.
Mauern haben in der Kindheit ihren Dienst getan, und jetzt denkt man, dass man mit derselben Strategie auch im Erwachsenenleben weiterkäme, aber sie können einen am Leben hindern.
Als Kind errichtet man Grenzmauern, um sich zu schützen und nicht verletzt zu werden. Wenn man dann erwachsen ist, stehen diese Mauern immer noch da. Obwohl sie eigentlich längst ausgedient haben, klammert man sich weiter daran fest oder versteckt sich hinter ihnen, einfach aus Gewohnheit oder mangels einer Alternative. Diese Mauern haben in der Kindheit ihren Dienst getan, und jetzt denkt man, dass man mit derselben Strategie auch im Erwachsenenleben weiterkäme.
Ich habe auch zwei solche Grenzmauern errichtet und musste dann irgendwann feststellen, dass sie mich am Leben hindern und mich kleinmachen. Die eine Mauer mag zwar klein erscheinen, hatte aber trotzdem einen großen negativen Einfluss auf mein Leben: Wie schon erwähnt, standen das Fach Mathematik und ich auf Kriegsfuß. Schuld daran waren Lernblockaden, die von pädagogisch fragwürdigen Lehrmethoden seitens unserer Lehrer ausgelöst wurden. Als ich die neunte Klasse mit einer knapp genügenden Mathenote beendete, hatte sich in mir die tiefe Überzeugung festgelegt, dass ich unfähig bin zu rechnen. Bevor ich dann meine Ausbildung zur Pflegefachfrau begann, hatte ich noch zwei weitere Schuljahre vor mir und auch dort stand Mathematik auf dem Stundenplan. Es war wie ein ultimativer Befreiungsschlag meiner jahrelangen schulischen Unterdrückung, dass ich am Ende dieser zwei Jahre eine ungenügende Mathenote ins Schulzeugnis bekam – ich war sogar stolz darauf!
Meine Grenzmauer hieß zu diesem Zeitpunkt: „Ich kann nicht rechnen und werde es auch nie können.“ Jahrelang war für mich Mathematik eine Theorie, die ich nicht in mein Leben integrieren konnte und es auch nicht wirklich musste. Während meiner Ausbildung realisierte ich jedoch schnell, dass Rechnen jetzt eine ganz praktische Seite bekam. Ich hatte nämlich plötzlich dem Patienten gemäß ärztlicher Verordnung eine gewisse Anzahl Milligramm eines bestimmten Medikamentes zu spritzen. Dieses Medikament musste aus einer Ampulle gezogen werden, die eine bestimmte Anzahl an Milligramm Wirkstoff auf einen Milliliter enthielt. Meine Aufgabe war es dann, auszurechnen, wie viel von der Flüssigkeit ich in die Spritze aufziehen musste, um der Verordnung des Arztes nachzukommen. Ich kann mich erinnern, wie ich manchmal vor Spritze, Kanüle und Ampulle stand, den Zeitdruck im Nacken, meine „Unfähigkeits-Mauer“ vor Augen und total blockiert war – es fühlte sich an wie damals, als ich allein auf einem Tisch stand. Der Gedanke daran, dass ein falsches Resultat nicht einfach eine ungenügende Note nach sich ziehen würde, sondern je nach Wirkstoff den Tod eines Menschen bedeutete, half auch nicht gerade zur Lösung meiner Blockaden.
Meine Grenzen der Kindheit wurden mir nun zum Stolperstein im Erwachsenenleben. Ich musste mich bewusst entscheiden, diese „Ich-kann-nicht“-Festlegung abzubauen, wenn ich ohne Furcht meinem Beruf nachgehen wollte. So übte ich fleißig mit den Zahlen, und wenn ich mir nicht sicher war, fragte ich nach. Mit jedem Erfolgserlebnis stieg mein Selbstbewusstsein. Heute weiß ich: Wenn ich etwas für meinen Alltag brauche, dann kann ich rechnen! Und mehr brauche ich nicht.
Es gibt aber noch eine andere Mauer, die ich bis heute immer wieder ein Stück mehr demontiere. Weil ich die Erfahrung machte, dass man mich wegen meines Glaubens an Gott ablehnte, auslachte und ausschloss, wuchs in mir die Überzeugung: „Richtig gute Freundschaften kann man nur mit Gleichgesinnten, mit Christen, haben.“ Das war mir lange nicht so bewusst, aber es hatte einen großen Einfluss auf mein Leben. Ich habe gute Freundinnen – alle glauben an Gott. Beim Kennenlernen von andersdenkenden Menschen spüre ich zunächst immer dieses leise Misstrauen, als würde ich fast darauf warten, dass sie mit dem Finger auf mich zeigen und mich auslachen. Erst in den letzten Jahren begann ich zu realisieren, dass es Menschen gibt, die mich so mögen, wie ich bin, auch wenn sie meinen Glauben nicht teilen. Wie einengend, wie unreif und entmutigend wäre es doch da, die Kindheitsgrenzen weiterhin zu meiner Einschränkung zu machen. Mich auf andersglaubende Menschen einzulassen, kostet mich zwar immer noch Mut, aber wie bei allem im Leben gilt: Übung macht den Meister!
Als erwachsene Frau darf ich Verantwortung für mein Denken, Fühlen und Handeln übernehmen. Dadurch erhalte ich Gestaltungskraft!
Bin ich jetzt also ein Opfer meiner Kindheit, weil sie definiert, wie weit oder wie eng ich Grenzen stecke? Nein! Es gab Situationen und Umstände als Kind, die ich mir weder aussuchen oder beeinflussen noch mich dagegen wehren konnte. Aber heute, als erwachsene Frau, darf ich Verantwortung für mein Denken, Fühlen und Handeln übernehmen. Dadurch erhalte ich Gestaltungskraft! Ich entscheide, welche Grenzmauern meiner Kindheit ich abtragen will und welche stehen bleiben sollen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es Gottes Sehnsucht und sein Wille ist, meine Füße auf weiten Raum zu stellen. Er will mir Platz, Freiheit und Luft geben, damit ich mich in meinem Leben entfalten kann. Damit das möglich wird, gehört manchmal auch der schmerzhafte Prozess dazu, dass ich alte Muster und Strategien loslasse und ich mich auf neue Leben spendende Wege begebe. Wie Eugen Eckert in seinem Liedtext schreibt:
Weite Räume meinen Füßen,
Horizonte tun sich auf,
zwischen Wagemut und Ängsten
nimmt das Leben seinen Lauf:
Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Schritt ins Offene, Ort zum Atmen,
hinter uns die Sklaverei;
mit dem Risiko des Irrtums
machst du Gott, uns Menschen frei.
Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Da sind Quellen, sind Ressourcen,
da ist Platz für Fantasie;
zwischen Chancen und Gefahren,
Perspektiven wie noch nie.
Du stellst meine Füße auf weiten Raum.
Doch bleib Kompass, bleibe Richtschnur,
dass wir nicht verlorengehen;
zu der Weite unsrer Räume
lass uns auch die Grenzen sehn.
Eugen Eckert2