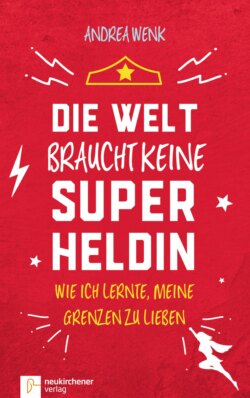Читать книгу Die Welt braucht keine Superheldin - Andrea Wenk - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4. „No Problem, Madam!“
„Ich muss bis an meine Grenzen gehen, bis zum Äußersten, das mir möglich ist, um beim anderen anzukommen. Begegnung geschieht, so gesehen, immer an der Grenze.“
Anselm Grün3
Bis zu meinem letzten Ausbildungsjahr hatte ich schon einige Landesgrenzen überschritten oder überflogen. Aber weder Urlaube in Frankreich noch ein Sprachaufenthalt in England hätten mich jemals auf die Erfahrung, die mit dem Praktikum in einem indischen Krankenhaus auf mich wartete, vorbereiten können!
Mit der Reise nach Indien überflog ich nicht nur mehrere Landesgrenzen, sondern stieß hart an meine eigenen Grenzen und darüber hinaus. Wie gut, dass ich das zum Zeitpunkt der Abreise noch nicht wusste. Da sah ich nur das Abenteuer, das vor mir lag, und konnte mir den Schock, der auf mich wartete, nicht einmal im Traum vorstellen.
Während meiner späteren Auslandserfahrungen mit einer Missionsgesellschaft lernte ich, dass der „Kulturschock“ in sechs Phasen verläuft. Die erste ist die „Honeymoon-Phase“ (engl. für Flitterwochen), danach kommt die „Irritation“, gefolgt von der „Krise“. In der vierten Phase „lernt man am Unterschied“, und dadurch folgt die „Akkulturation“, in der man sich gewisse Kompetenzen im Umgang mit dem Fremden aneignet. Die sechste und letzte Phase ist die „Bikulturelle Kompetenz“ – die Fähigkeit, sich in der eigenen und der fremden Kultur zu bewegen und erfolgreich zu leben.
In der Honeymoon-Phase sieht man vieles durch die rosarote Brille, ist blind für die Realität und deren Herausforderungen. Man erfreut sich am exotischen Essen, der Natur, der Andersartigkeit und alles ist einfach nur aufregend. Mit dem ersten Schritt vom Flughafen raus auf indischen Boden wurde mir klar: In Indien gibt es keine rosarote Brille für mich! Meine Reaktion auf Indien ist der Beweis, dass die Phasen nicht immer linear – schön nacheinander –, sondern manchmal parallel oder sprunghaft verlaufen. Ich stürzte nämlich kopfüber in die „Krise“! Der Pulsschlag des indischen Lebens stürmte ungefiltert auf mich ein und hatte mich in Sekundenschnelle in seiner engen und lauten Umarmung. Die stickige Luft machte es nicht gerade leichter. Es gab keine Möglichkeit der Tarnung, ich konnte nicht unauffällig in der Menschenmenge verschwinden. Es kam mir vor, als hätten sich alle Taxifahrer Indiens hier versammelt, um uns anzuschreien und an den Armen zu reißen, damit sie uns einen guten Deal anbieten könnten. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich mich noch nie so weit außerhalb meiner mir wohlbekannten Grenzen befunden. In jenem Moment, inmitten aller Taxifahrer Indiens, traf mich der Kulturschock völlig unvorbereitet und hart.
Zum Glück hatte ich mich mit meiner Freundin Margret gemeinsam auf dieses Abenteuer in Indien eingelassen. Während der Fahrt vom Flughafen zum Krankenhaus saß ich völlig apathisch neben ihr und überließ ihr die ganze Konversation mit unserem Fahrer. Für sie muss es sich so angefühlt haben, als ließe ich sie im Stich. Aber mein Körper und meine Seele waren wie gelähmt und schalteten einfach auf Autopilot. Die Fahrt durch die Stadt sehe ich bis heute glasklar vor mir und nichts, absolut nichts war rosarot! Ich realisierte, dass ich Leib und Leben gefährden würde, sobald ich auch nur versuchte, diese Straßen zu überqueren. Der Verkehr war außer Kontrolle und es schien das Gesetz des Stärkeren zu herrschen. Später erfuhren wir, dass man zwar ohne funktionierendes Licht am Auto auf der Straße fahren könnte, aber nie und nimmer ohne funktionstüchtige Hupe, denn das wäre glatter Selbstmord.
Es kam mir vor, als hätten sich alle Taxifahrer Indiens hier versammelt, um uns anzuschreien und an den Armen zu reißen, damit sie uns einen guten Deal anbieten könnten.
Ich sah den Schmutz, die unendlich vielen Menschen und immer wieder die mageren heiligen Kühe. Wie sollte ich es bloß zwei Monate in diesem lauten, grellen, intensiven Land aushalten? Alle meine Sinne schrien: „Reizüberflutung!“ Ich konnte absolut nichts dagegen tun. Wie gerne wäre ich in diesen ersten Stunden zurück ins Vertraute geflüchtet, hinter die Stadtmauern meiner kleinen Welt, dorthin, wo ich alles kannte und wusste, wie ich mich zu verhalten hatte. In dieser ersten Zeit schrieb ich in mein Tagebuch: „Die ganze Nacht hindurch pulsiert diese Stadt mit Leben, Lärm, Musik, Gehupe, Geschrei, und wenn dann niemand mehr etwas zu melden hat, kommt der Muezzin und dröhnt alle, die es hören oder nicht hören wollen, mit seinen Lautsprechergebeten zu!“
Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase auf dem Krankenhausareal und im Gästehaus wurden wir in Arbeitskleider gesteckt und an die Seite der indischen Krankenschwestern gestellt. Schnell stellte sich heraus, dass wir zwar Einblick in alle Bereiche haben konnten, aber nicht wirklich als Krankenschwestern arbeiten durften. So wie wir es machten und gelernt hatten, war es in Indien „falsch“ und fremd, sodass unser Alltag oft aus Zuschauen bestand. Hinzu kam, dass sie uns keine Hilfsarbeiten geben wollten, da wir Weißhäutige sind. Durch die Lernschwestern erfuhren wir, dass Krankenschwester ein „niedriger“ Beruf sei, und sie alle konnten nicht nachvollziehen, dass wir als Weiße nicht Ärztinnen werden wollten.
In dieser Zeit habe ich gelernt, dass durch eine andere Kultur auch medizinische Grenzen anders definiert werden können, und das führte bei uns mehr als einmal zu der in der zweiten Kulturschockphase beschriebenen Irritation. Inder, die beim Krankenhauseintritt kein Geld vorweisen konnten, wurden in den öffentlichen Krankenhäusern abgewiesen, auch wenn dies hieß, dass sie noch vor dem Gebäude sterben mussten. Bei unserem Krankenhaus handelte es sich um eine christliche Institution und es nahm alle Leute auf. Nur leider erlebten wir in dieser kurzen Zeit einige Male, dass die Leute zu spät zu uns fanden, da sie es vorher schon in anderen Krankenhäusern versucht hatten. Dadurch kam manchmal jede Hilfe zu spät. So auch für eine schwangere Frau mit Schwangerschaftsvergiftung kurz vor ihrem Entbindungstermin. Als sie auf der Notfallstation ankam, stand sie schon unter Schock und alle Bemühungen halfen nichts – sie starb. Mit ihr starb ihr Kind, das außerhalb ihres Bauches lebensfähig gewesen wäre. Völlig entgeistert fragten wir die Ärzte, weshalb sie das Kind nicht gerettet hätten. Sie schauten uns verständnislos an und meinten: „Ein Kind kann ohne seine Mutter nicht leben.“ Eine Selbstverständlichkeit für die indischen Ärzte und Schwestern – für uns entsetzlich ungerecht. Wie konnten diese Leute so herzlos sein? Lange noch hat uns dieses Erlebnis zu schaffen gemacht.
Als ich einige Wochen dort war, wurde mir klar, dass die Inder durch die anderen Lebensumstände wohl auch andere Grenzen in ethischen Fragen ziehen. In einem Land, in dem so viele um ihre Existenz kämpfen müssen, hat ein Baby ohne Mutter kaum eine Chance. Es wäre nicht einmal sicher, dass jemand aus der Verwandtschaft es aufnehmen würde, da alle schon genug Mäuler zu stopfen haben.
Zwei Monate sind zu kurz, um alle sechs Phasen des Kulturschocks zu durchleben, denn um eine bikulturelle Kompetenz (sechste Phase) zu erreichen, muss man jahrelang in einem Land leben. Trotzdem erlebte ich bis zum Schluss einige Momente, in denen ich am Unterschied der zwei Kulturen lernte (vierte Phase).
Ich machte die traurige Erfahrung, dass das einzelne Leben in Indien nicht so viel zählt wie das Ganze und dass der Tod dem Leben viel näher ist als bei uns. Wenn ich nicht bereit bin, meine westliche Brille auszuziehen, und versuche, wenigstens ansatzweise durch die indische Brille zu blicken, dann kann ich an diesen Unterschiedlichkeiten verzweifeln. Ich erlebte einige Situationen, in denen meine Vorstellung von Richtig und Falsch bis auf die Grundfesten erschüttert wurde und ich lernen durfte zu akzeptieren, dass sich gewisse Fragen nicht einfach schwarz-weiß beantworten lassen, sondern die Antwort irgendwo im Zwischenraum, im Niemandsland zwischen den Grenzen von Richtig und Falsch, liegen.
Gewisse Fragen lassen sich nicht einfach schwarz-weiß beantworten, sondern die Antwort liegt irgendwo im Niemandsland zwischen den Grenzen von Richtig und Falsch.
Während ich zu Beginn des Praktikums das Gefühl hatte, dass mich das Land mit seiner intensiven Umarmung ersticken würde, machte ich nach und nach die Erfahrung, dass mich viele Menschen mit einer herzlichen Umarmung aufnahmen. Margret und ich bekamen Kontakt zu den Lernschwestern, die uns an ihrem einzigen freien Tag jeweils zu ihren Familien oder zu ihren Geburtstagsfesten einluden. Wir wurden bekocht, bis unsere Geschmacksnerven von all der Schärfe taub waren, und auf einen Jahrmarkt mitgenommen – hinein in Achterbahnen, die sämtlichen Sicherheitsvorschriften offen ins Gesicht lachten. In diesen Begegnungen wurde für mich wahr, was Anselm Grün in seinem Buch Grenzen setzen – Grenzen achten schreibt: Beziehungen mit diesen jungen Frauen fanden an meiner Grenze, an meinem Äußersten, statt. Ich musste bereit sein, mich weit aus dem Fenster hinauszulehnen und Beziehung anzubieten auf die einzige Art, die ich kenne – auf die Schweizer Art. Dort, weit außerhalb meiner Grenzen, machte ich mich verletzbar und hatte bis zum Schluss nie die Gewissheit, ob mein Angebot auch richtig verstanden wurde.
Wir lernten zum Beispiel schnell, dass man in Indien mündlich etwas abmacht, dann aber am verabredeten Tag noch schnell wegen der Zeit telefoniert. Stolz, dass wir uns ihrer Kultur anpassten, gingen Margret und ich dann eines Tages zur abgemachten Zeit am Nachmittag ins Schwesternhaus, bereit, mit den anderen Frauen in die Stadt zu gehen. Als wir dort ankamen, war niemand startklar und alle steckten noch in ihren Schlafanzügen! Während sich unser schweizerischer Sinn für Pünktlichkeit sehr angegriffen fühlte, kämpften wir darum, uns an die Situation anzupassen und nicht verärgert zu reagieren. Solche Momente waren jeweils der Grenzstein: das Ende meiner Erfahrungswelt und der Beginn des anderen. Das war mein Äußerstes, das versuchte, mit dem anderen zu verschmelzen und ihn zu verstehen. Bei diesem spezifischen Erlebnis kam das Verständnis erst im Nachhinein. Den jungen Frauen zuzuschauen, wie sie sich für unsere Verabredung vorbereiteten, öffnete mir die Augen. Man stelle sich den Tagesablauf der Lernschwester dort vor: Sechs Tage die Woche waren ihre Stunden durchgeplant von sechs bis zweiundzwanzig Uhr. Die einzige freie Stunde, die sie hatten, war zwischen zweiundzwanzig und dreiundzwanzig Uhr. Deshalb wurde an ihrem einzigen freien Tag schon die Vorbereitung auf das Weggehen zum genussvollen Anlass, indem sie einander die Haare wuschen, sich in Saris wickelten, einander die Nägel lackierten, kicherten, tratschen und die Vorfreude wachsen ließen. Hätten Margret und ich uns von unseren Vorstellungen leiten lassen, unserem Ärger Luft gemacht und die Verabredung sausen lassen, weil es nicht unseren Vorstellungen entsprach, dann hätten wir eine kostbare Stunde unter Freundinnen verpasst und den Wert des Ganzen nicht begriffen. Wir wären um ein Erlebnis ärmer und die kulturellen Grenzen hätten uns nicht bereichert, sondern wir hätten eine trennende Mauer aufgebaut. Wie froh bin ich, dass uns die Verschmelzung zweier Kulturen in diesem Moment gelang!
Ich habe am Anfang erwähnt, dass ich Indien nie mit einer rosaroten Brille sehen konnte, weil das Land dafür viel zu intensiv ist. Rosarot war also – abgesehen von einem meiner Saris – keine Farbe, die ich mit unserem Aufenthalt dort in Verbindung bringe. Es gibt jedoch eine andere Farbe, die voll und ganz zutrifft: blau! Während mir die rosarote Brille verwehrt blieb, um die Erfahrungen mit der indischen Kultur ein wenig zu dämpfen, ging ich mit einer gewissen Blauäugigkeit in die zwei Monate hinein. Die ersten Wochen half mir diese Naivität über das Gröbste hinweg. Irgendwann wurden uns dann aber doch die irritierenden kulturellen Unterschiede auf ärgerliche Art und Weise bewusst; wir waren in der „Irritationsphase“ angelangt. Wir stellten fest, dass ein Inder einem nicht immer die Wahrheit sagt. Die Menschen in Indien leben in einer Schamkultur, das heißt, dass es für sie nicht denkbar ist, einfach zu sagen, sie wüssten etwas nicht oder sie hätten einen Fehler gemacht. So hörten wir gefühlte tausendmal „No problem, Madam!“. Vom Angestellten im Fotoshop bis hin zum Passanten auf der Straße, den man nach dem Weg fragte, nickten sie alle lächelnd mit dem Kopf und gaben einem den Eindruck, dass sie genau wüssten, wovon sie sprechen. Wenn man ein Problem hatte, konnten sie einem das Gefühl geben, dass es eigentlich keines sei. So leichtgläubig und kulturgeblendet, wie wir anfangs waren, glaubten wir das tatsächlich auch.
Mit diesen kulturellen Unterschieden umzugehen, bedarf es mehr als zwei Monate Aufenthalt. So habe ich bis zum Schluss nicht verstehen oder akzeptieren können, dass ein Inder lieber lügt, als ehrlich zu sagen, dass er etwas nicht weiß. Mir wurde bewusst, dass ich durch meine kulturellen Einflüsse geprägt bin und sie mit zu meiner Identität gehören. Dieses Bewusstsein bekam ich aber erst durch die Begegnung mit einer anderen Kultur und dadurch, dass ich mit ihrer Andersartigkeit konfrontiert wurde. Plötzlich wurde der Begriff „normal“ infrage gestellt. Für mich ist es normal, jemandem, der mich nach dem Weg fragt, zu sagen: „Ich weiß es nicht“, wenn ich den Weg nicht kenne. Für einen Inder ist es normal, in derselben Situation trotz totaler Ahnungslosigkeit einfach selbstbewusst in eine Richtung zu zeigen.
Während meiner späteren Asienaufenthalte entdeckte ich auf den Märkten immer wieder T-Shirts mit dem Aufdruck „Same, same – but different“ („ganz gleich, aber anders“). Genau dieser Spruch scheint zu meiner ersten Erfahrung in Asien zu passen: Wir sind alle von Gott geschaffene Menschen („Same, same“), aber in unserer kulturellen Prägung eben ganz anders („but different“).
Wir sind alle von Gott geschaffene Menschen, aber in unserer kulturellen Prägung eben ganz anders.
Wenn ich meine Zeit in Indien nur mit der Brille der Krankenschwester bewerten würde, hätte sie sich nicht gelohnt, da die Ärzte und Schwestern uns dort weder wirklich brauchten noch helfen ließen. Wenn ich den reichen Schatz an Erfahrungen anschaue, habe ich vielleicht nicht viel für meinen Beruf gelernt, aber dafür umso mehr fürs Leben! Die Erfahrung zu machen, dass man andersartigen Menschen nur an der Grenze seines Selbst begegnen kann – nur durch das mutige Aufeinanderzugehen –, hilft mir bis heute in der Begegnung mit Menschen, die ich anfänglich schwer einordnen kann, weil sie anders sind. So erlebe ich immer wieder wertvolle Momente, in denen das „Du“ und „Ich“ zu einem kurzen „Wir“ verschmelzen, bevor jeder wieder seines Weges geht, bereichert von der kurzen gemeinsamen Erfahrung.