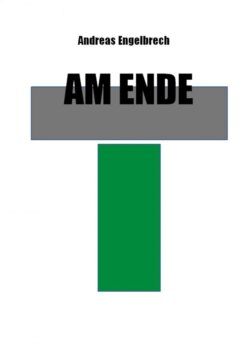Читать книгу Am Ende - Andreas Engelbrech - Страница 6
Kapitel 4
ОглавлениеEine Woche später
„Ist das die Skulptur?“ Der Arbeiter stand vor einer großen, etwa zwei mal zwei mal zwei Meter großen Figur. Sie war gefertigt aus Computerschrott, zusammengeschweißt, zurecht gebrochen, zurechtgeformt. Die Figur hatte die Form eines Pferdes, sollte die Form eines liegenden Pferdes haben. Der Titel: „Das Trojanische Pferd.“
„Wie schwer wird sie wohl sein?“ Der Arbeiter diskutierte mit seinen Kollegen, wie die Skulptur am besten zu transportieren war. Dieses monumentale Pferd war nicht so einfach zu bewegen. Groß, schwer, unförmig. Durch das große Tor der zu einem Atelier umgebauten Scheune war sie leicht hinaus zu transportieren. Zuvor musste sie aber angehoben und sorgfältig verpackt werden.
Ein Gabelstapler erledigte diese Arbeit, eine Transportkiste wurde zusammengezimmert und mit Styropor ausgestopft. Jetzt konnte der Skulptur, die trotz ihrer massiven Größe aufgrund der Computerbauteile einen sehr zerbrechlichen Eindruck machte, ohne Gefahr verschickt werden.
„Wann kommen Sie nach Bilbao?“, fragte ein Angestellter des Guggenheim-Museums in Bilbao, der zugleich den Empfang des Kunstwerks quittierte.
„Ich werde in einer Woche nach Bilbao fliegen und mich auf die Eröffnung der Ausstellung vorbereiten. Wenn sie denn jemals eröffnet wird.“ Der Schöpfer der Skulptur, der Künstler Thomas Jensen-Mendez, war skeptisch. Seit den Anschlägen in Paris und Amsterdam war das Museum in Bilbao geschlossen. Der Termin für die Eröffnung der Skulpturen-Ausstellung zeitgenössischer europäischer Bildhauer war verschoben worden. Auf unbestimmte Zeit.“
„Wie groß ist die Gefahr, wenn wir die Ausstellung nur für geladene Gäste eröffnen? Und dann erst für das normale Publikum. Wir haben unsere Sicherheitsleute durchleuchtet, haben die Stärke der Wachmannschaften erhöht. Das Konzept für die Sicherheitskontrollen ist so gründlich, dass kein Rollstuhl, keine Handtasche, nichts, was irgendwie gefährlich ist, in das Museum gelangen kann.“ Der Direktor des Guggenheim-Museum sprach, er kämpfte um die Wiedereröffnung seines Museums. Seit Paris waren fast zwei Wochen vergangen.
Er fuhr fort: „Was nützt es, wenn wir all diese Meisterwerke verstecken, sie einsperren, ohne dass sie jemand zu Gesicht bekommt. Diese Kunst gehört nicht in einen Tresor, sie soll von allen Menschen gesehen werden. Sie soll die Menschen anregen, erfreuen, inspirieren. Kein Foto, kein virtueller Rundgang, nichts, kann das Erlebnis des Museums selber ersetzen. Gerade in diesem Gebäude kommt die Kunst voll zur Geltung, Architektur und Kultur ergänzen sich hier ....“ Der Museumsdirektor konnte gar nicht genug Worte finden, um das Erlebnis seines Museums zu beschreiben.
„Wenn die Kunstwerke zu Asche zerfallen, hat die Menschheit auch nichts mehr davon!“ Mit diesen Worten beendete der Direktor des Spanischen Überwachungsdienstes die Aufzählung. Sein Untergebener, zuständig für die Sicherheit im Grossraum Bilbao, nickte ihm zustimmend zu.
„Es wurde doch sogar ein Überflugverbot verhängt. Und selbst Schiffe dürfen dem Gebäude nicht zu nahe kommen.“ Der Direktor ließ nicht locker.
„So lange wir nicht wissen, wer dahinter steckt und welche Ziele mit all diesen Attentaten auf Museen verfolgt werden, müssen wir vorsichtig sein. Besser eine unzugängliche als eine leere Festung!“ Mit diesen Worten entschied der Direktor des Spanischen Überwachungsdienstes, daß das Guggenheim-Museum wie viele andere Museen weiterhin geschlossen bleiben sollte. Geschlossen und abgeschirmt wie eine Burg in früheren Zeiten.
Ein paar Tage später drehte ein Filmteam des Spanischen Fernsehens in den Räumen der vorgesehenen Sonderausstellung über die Werke zeitgenössischer europäischer Bildhauer.
Einige der Künstler waren anwesend, ließen sich bereitwillig interviewen.
„Was wollen Sie mit ihrem Werk, dem Trojanischen Pferd, aussagen?“ Der Kulturjournalist hatte sich zusammen mit Jensen-Mendez, einem deutsch-spanischen Bildhauer, vor dessen Werk in Szene gesetzt.
„Ich will damit symbolisieren, wie sich die Technik, vor allem die Computer, in unser Leben einmischen, uns unterwandern. Und wie damals, in Griechenland, holen wir bewusst die Computer in unser Leben, ohne an mögliche Gefahren zu denken.“
„Viele Ihrer Kritiker spotten über Ihre Arbeit. Angeblich würden Sie mehr am Recycling von Computerschrott verdienen als an ihrer Kunst selber!“ Der Journalist provozierte absichtlich, stieß aber auf einen ruhigen, abgebrühten Interviewpartner.
„Genauso wie sich andere Künstler intensiv mit der Auswahl ihrer Materialien beschäftigen, sei es die Farbe des Marmors, die Maserung des Eichenholzes, was auch immer, nehme ich auch nicht einfach nur, was herumliegt. Die Suche nach dem geeigneten ausgesonderten Computermaterial hat mindestens genauso lange gedauert wie das Zusammenfügen und Formen der Skulptur selbst.“
Für den deutsch-spanischen Künstler waren es die üblichen Fragen, die üblichen Provokationen, die üblichen Schmeicheleien. Aber er hatte es mit einem der besten Kulturjournalisten zu tun. „Eine letzte Frage noch. Diese Skulptur hier, sie sieht aus wie ein Engel: Hat er etwas mit den Gerüchten um ihre schwere Krebserkrankung zu tun? Sozusagen eine Erinnerung, eine Hoffnung an das Leben danach?“
Es war eine Frage, die ihm nicht gern gestellt wurde. Er wusste, dass die Nachricht von dem bevorstehenden Ende eines großen Künstlers alles andere als eine Höflichkeit war. Die Preise würden steigen, durch die Decke gehen. Bald gab es keine neuen Werke mehr von ihm. Ein abgeschlossenes Sammelgebiet sozusagen.
„Die Skulptur ist kein Engel, sondern ein Kolibri. Haben Sie jemals einen Kolibri gesehen? Ich saß wochenlang an dieser Arbeit. Aber es ist mir nicht gelungen, die Eleganz, die Leichtigkeit, die schillernden Farben wiederzugeben. Das Original der Natur ist schöner, unnachahmlicher.“ Und nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: „Aber es stimmt. Lange habe ich nicht mehr!“
„Ich möchte einen Termin haben!“ Wütend ging der Direktor des Guggenheim-Museum in seinem Büro auf und ab. Er sprach mit dem Direktor des Spanischen Überwachungsdienstes, welcher über Bildtelefon aus Madrid zugeschaltet war. „Ich lasse mich nicht länger hinhalten. Die Menschen wollen in das Museum, wollen die Ausstellung besuchen! Die Menschen wollen sich vom Terror eines Verrückten nicht verängstigen lassen.“
Es war weltweit überall das gleiche. Nirgendwo wollten die Menschen länger vor den verschlossenen Türen von Museen und Kunstausstellungen stehen. Politiker, insbesondere jene der Opposition, griffen das Thema genauso beherzt auf wie jene Banausen, die seit Jahren nicht im Museum waren. Jetzt, da die Kunst hinter verschlossenen Türen geschützt werden musste, interessierten sich auf einmal mehr Menschen dafür.
„Solange wir nicht wissen, wer oder was dahintersteckt, können wir kein Museum eröffnen. Kein einziges!“ Der Direktor aus Madrid sagte das gleiche wie seine Kollegen in Europa und dem Rest der Welt.
„Ich erhalte jeden Tag mindestens fünfzig Anrufe von Prominenten und einflussreichen Personen. Nicht gezählt die Anrufe von ganz normalen Menschen, die jeden Tag bei meinen Mitarbeitern eingehen. Sagen Sie mir einen Termin, wenn wir wieder aufmachen können.“ Die Geduld des Direktors war am Ende.
„Es bleibt dabei. Alle Museen bleiben bis auf weiteres geschlossen! Es ist zum Schutz der Kunst und nicht zuletzt auch der Menschen, die sie sehen wollen. Begreifen Sie das nicht?“ Mit diesen Worten beendete der Experte aus Madrid das Gespräch. Der Bildschirm wurde dunkel.
Vier Wochen nach der Zerstörung der Mona Lisa fand in Paris eine Pressekonferenz statt. Sie wurde durchgeführt vom Leiter der SK Mona Lisa, flankiert vom Chef der Pariser Polizei und dem neuen Leiter der SK Van Gogh. Untermalt wurde die Szenerie mit Kopien der bekanntesten Werke Vincent Van Gogh´s und der Mona Lisa auf Staffeleien, versehen mit Trauerfloren am linken oberen Bildrand.
Nach der Vorstellung statistischer Zahlen über die Anzahl der eingesetzten Beamten, eingegangener Hinweise, durchgeführter Ermittlungen und Verhaftungen und ebenso vieler Freilassungen durften die Journalisten Fragen stellen:
„Wer steckt hinter den Anschlägen? Handelt es sich um Terroristen?“
„Wir gehen derzeit einigen vielversprechenden Hinweisen hinterher. Es ist möglich, dass hinter den Anschlägen Spekulanten stehen, die aus der Verknappung von Werken verschiedener Künstler Kapital schlagen wollen.“
„Gibt es ein Bekennerschreiben?“
„Nein.“
„Gibt es Hinweise auf weitere Anschläge?“
„Weitere Anschläge sind nicht auszuschließen!“
„Warum wurden die Täter noch nicht gefasst? Paris und Amsterdam sind doch weltweit einige der bestüberwachtesten Städte überhaupt.“
„Die Flucht der Täter war sehr präzise und mit hoher Sachkenntnis geplant. Das lässt den Schluss zu, dass eine hochkriminelle und finanzkräftige Organisation dahintersteckt.“
„Stimmt es, dass die Verletzten im Louvre auf Fehler der Polizei zurückzuführen sind?“
„Dieser Vorwurf entbehrt jeder Grundlage. Die Täter haben das Risiko für die Besucher durchaus in Kauf genommen. Eine frühzeitigere Evakuierung, wie von bestimmten Medien für möglich gehalten, wäre nicht möglich gewesen!“
„Wann werden die Menschen wieder in die Museen gehen dürfen?“
„Derzeit werden die Sicherheitseinrichtungen aller Museen überprüft und auf den neuesten Stand der Technik und der Erkenntnisse gebracht. Sorge macht uns vor allem der menschliche Aspekt. In Amsterdam beging ein absolut zuverlässiger Wachmann mit besten Referenzen den Vertrauensbruch. In Paris missbrauchte eine den Sicherheitskräften bestens bekannte und beliebte Altenpflegerin das Vertrauen und die Gutmütigkeit des Sicherheitspersonals.“
Die abschließenden Worte fand der Pariser Polizeichef: „Meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen versichern, dass die Pariser Polizei wie selbstverständlich die Sicherheitskräfte in Europa und anderen Teilen der Welt mit hohem Aufwand an Personal und Knowhow an der Aufklärung der Verbrechen arbeitet. Es wird alles unternommen, um so schnell wie möglich die Museen für die Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen. Was im Louvre genauso wie in Amsterdam geschehen ist, stellt mehr als die Zerstörung von Kunstwerken dar. Es ist ein Verbrechen an der ganzen Menschheit. Es ist die barbarische Tat von Verrückten, denen es um die Befriedigung niedriger Motive geht. Ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass dadurch Einzigartiges, Unwiederbringliches zerstört wird. Wie erklären wir unseren Kindern, warum sie das Bild der Mona Lisa nicht mehr betrachten können?“
Zwei Tage später gab das Guggenheim-Museum im Bilbao als eines der ersten Museen weltweit nicht ohne Stolz bekannt, dass es zusammen mit seiner neuen Sonderausstellung wieder eröffnen würde. Das Ereignis sollte in einem besonderen Rahmen stattfinden. Mit einer Vernissage am Vorabend, zu der sich eine Vielzahl von Prominenten aus ganz Europa angemeldet hatten.
Das Ereignis kam einer Oscar-Verleihung gleich. Die Ankunft der Prominenten, die vor den Haupteingang des Museums fuhren, im Blitzlichtgewitter aus ihren Limousinen stiegen und den Roten Teppich entlang ins Museum schritten, wurde sogar live übertragen. Alles was Rang und Namen hatte, und irgendwie mit Kunst zu tun hatte oder die Publicity brauchte, musste demonstrativ die Wichtigkeit der Kunst für die Menschheit unter Beweis stellen. Kulturexperten sprachen davon, dass das Schaffen von Kunstwerken eine Besonderheit des Menschen sei und ihn dadurch vom Tier unterscheide. Die Zerstörung von Kunst wurde als barbarisch und nicht-menschlich verurteilt. Vielerorts wurde an die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten in Deutschland, an die Killing Fields der Roten Khmer in Kambodscha, die Kulturrevolution in China erinnert.
Die ausstellenden Künstler selbst erfreuten sich einer Aufmerksamkeit, wie sie sonst nur Filmstars mit Rekordgagen und Königskinder bei Märchenhochzeiten erhielten.
„Herr Jensen-Mendez. Die Nachricht von Ihrer schweren Erkrankung hat nicht nur die Kunstwelt sehr betroffen gemacht. Weltweit wird Anteil an Ihrem Leid genommen. Gleichzeitig gibt es aber auch kritische Stimmen, die ihr angekündigtes Ende als einen sehr gelungenen Werbegag bezeichnen. Immerhin hat sich der Wert Ihrer Werke in kürzester Zeit vervielfacht. Und wenn die Meldungen stimmen, sind sämtliche Ihrer Skulpturen ausverkauft.“
„Ich kann Ihnen versichern, dass mein baldiges Ende kein Werbegag ist. Ich kann schon sehr lange nicht mehr lachen. Es ist wahr, dass meine Werke so teuer wie noch nie verkauft wurden. Von dem Geld werde ich aber nichts mehr haben.“ Der für die Kunstszene mäßig kritisierte Bildhauer nutzte die Gelegenheit, um sich ruhig und souverän zu verteidigen. Zu einer anderen Zeit wäre er gnadenlos von Kritikern und Kunstexperten in den Medien zerrissen worden. Derzeit lebte die Kunstwelt jedoch im Ausnahmezustand.
„Begründet werden die Vorwürfe damit, dass sie keine äußeren Anzeichen einer schweren Erkrankung aufweisen. Mediziner haben die neuesten Aufnahmen von Ihnen ausgewertet. Keiner hält Sie für todkrank. „Der Journalist ließ nicht locker und bohrte weiter: „Im Gegensatz zum 20. Jahrhundert sind alle Krebsleiden heilbar, Erbkrankheiten behandelbar. Woran leiden Sie?“
Der angesprochene Künstler ließ sich durch die Vorwürfe nicht aus der Ruhe bringen. Er atmete tief durch und sprach dann mit ruhiger, tiefer Stimme: „Morgen werden Sie es erfahren. Der heutige Abend ist etwas Besonderes. Ich kann mich nicht erinnern, dass eine Kunstausstellung schon einmal so viel Aufmerksamkeit erhalten hat.“ Er machte eine kleine Pause und signalisierte dem Journalisten, dass er noch weiterreden wollte.
„Es ist richtig, dass ich die vergangenen Tage sehr viel Geld verdient habe. Keines meiner Werke wurde für weniger als fünf Million Euro verkauft. Mit dem Erlös habe ich Rechnungen beglichen.“ Damit verabschiedete sich der im Mittelpunkt des nicht nur kulturellen Interesses Stehende, ohne zu erklären, welche Schulden er zu beglichen hatte. Unüblich war es nicht, dass erfolgreiche Künstler einem aufwendigen Lebensstil nachgingen.
Die Beamtin in der Kommunikationszentrale des Pariser Überwachungsdienstes hatte ihren ersten Arbeitstag. Sie hatte sich für den Innendienst beworben, nachdem sie im Frühjahr eine Fehlgeburt erlitten hatte und sich für den Streifendienst nicht mehr geeignet hielt. Sie war zuständig für die Entgegennahme und Verteilung von Nachrichten, die als vertraulich eingestuft waren.
Als Einstand für ihre neuen Arbeitskollegen hatte sie Obstkuchen mitgebracht. Während die Kaffeemaschine zischte und brodelte, schnitt sie den Kuchen auf. Gerade als sie das erste Stück auf einen der Teller legen wollte, begann das Faxgerät zu rattern und piepsen. Sekunden später wurde sie bleich. Das Kuchenstück viel zu Boden, gefolgt von zwei Tellern, die sie in ihrer Aufregung vom Tisch stieß. Sie hatte den Code auf dem Fax mit dem Code verglichen, der neben all den Empfangsgeräten in einer Folie eingeschweißt auf eine Schranktür geklebt war. Versehen mit dem Vermerk „Streng Vertraulich“, nur zugänglich für besonders ausgewähltes, vertrauenswürdiges Personal.
Zeitgleich mit einem Kollegen in Madrid las sie den Text: „Bilbao. Guggenheim-Museum. Gefährden Sie diesmal keine Menschenleben! Grosse Explosion um 23.30 Uhr Ortszeit. Bestätigungscode: OZSLJFU673X. Neuer Code: WSFEO)§“3746OLUW.“
Zeitgleich mit ihrem Kollegen in Madrid blickte sie auf die Uhr: 22.17 Uhr.
Die Meldung wurde unverzüglich durch den diensthabenden Direktor des Überwachungsdienstes an seinen Kollegen in Bilbao weitergegeben. Dieser hatte kurz zuvor die gleiche Warnung von seinem Vorgesetzten in Madrid erhalten und bereits den Notfallplan anlaufen lassen.
Als der Franzose den Hörer auflegte, fragte er den Beamten, der mit den Daten des Telefaxanschlusses in sein Büro stürmte: „Aus welcher gottverlassenen Gegend der Welt kam das Fax diesmal?“
Die Antwort war kurz und alles andere als erwartet: „Paris. Hier aus Paris.“
Fünfunddreißig Minuten später öffnete ein Sondereinsatzkommando einen blauen Lieferwagen in einer Tiefgarage im Zentrum. Das schnurlose Telefaxgerät wurde aufgrund seiner Mobilfunksignale in dem Mietwagen geortet. Die Spezialisten gingen äußerst vorsichtig vor, da Sprengstoffspürhunde das Vorhandensein von explosiven Stoffen anzeigten. Wie sich herausstellte, hatten die feinen Hundenasen winzige Spuren eines hochexplosiven Stoffes in dessen leerer Verpackung erschnüffelt.
Die Nachricht löste eine an Panik grenzende Hektik in Bilbao aus. „Das Museum und die Umgebung muss sofort und restlos evakuiert werden. Alle müssen das Gebäude räumen. Niemand darf zurückbleiben. Vermutlich ist eine halbe Tonne des fürchterlichsten nicht-nuklearen Sprengstoffes in dem Gebäude verteilt. Von den Tätern fehlt immer noch jede Spur.“
Der stellvertretende Direktor des Überwachungsdienstes lehnte sich in der Zentrale in seinen Sessel zurück, als er die Nachricht an seinen Vorgesetzten im Guggenheim-Museum übermittelt hatte. Er selbst war hier sicher und konnte derzeit nicht mehr tun als zu beobachten und bei Bedarf steuernd eingreifen. Und darauf zu warten, dass sein Team ihm die Nachrichten der eingesetzten Sicherheitskräfte zukommen ließen, die sie zuvor von Unwichtigkeiten gefiltert hatten.
Er konnte nicht mehr tun, als auf einer Vielzahl von Monitoren, die aufgrund der feierlichen Wiedereröffnung des Guggenheim in Bilbao eigens in seinem Büro aufgestellt wurden, die Räumung des Museums zu verfolgen. Die Sicherheitsleute gingen effizient und geschult vor, wirkten beruhigend auf die Menschen ein und unterbanden so von Anfang an Panik. Vor dem Gebäude wurden Schaulustige und Medienvertreter zum Verlassen der Umgebung des in bunten Lichts getauchten Metallkomplexes aufgefordert. Die Zeit drängte. Fieberhaft begannen Sprengstoffteams das Gebäude zu untersuchen. Immer in dem Bewusstsein, dass sie nicht mehr viel Zeit hatten.
Dabei wollte er nicht glauben, dass sich eine Bombe in dem Museum befand. Alles war genau untersucht worden. Jeder Besucher, jeder Lieferant, jeder Angestellte. Sprengstoffspürhunde suchten mehrmals jeden Winkel ab. Nichts. Er hätte es nicht für ernst genommen, nicht so ernst, wenn es nicht der Code gewesen wäre. Der Code! Der Code, welcher mit zwei bereits verübten spektakulären Attentaten warnte. Davor warnte, die Drohung nicht ernst zu nehmen.
„Ihr habt noch 19 Minuten. Um 23.20 Uhr muss jeder das Gebäude verlassen haben.“ Der stellvertretende Direktor sprach mit einem Zugführer, der ihm die Räumung der Sonderausstellung meldete. Als der Polizist schnellen Schrittes den Saal verließ und damit auch vom Monitor verschwand, zeigte die Kamera im Hintergrund das „Trojanische Pferd“.
Die Reaktion des Mannes vor dem Monitor war eine Mischung aus Schock und Entsetzen:„Oh, mein Gott!“
Die Dachterrasse der Königssuite bot einen herrlichen Blick auf das Guggenheim-Museum. Der silberne Gebäudekomplex mit seinen geschwungenen Flügeln und Ausläufern erstrahlte im Glanz zehntausender, teils farbiger Glühlampen und riesiger Scheinwerfer, die sich zum Teil überkreuzten und in grellen Säulen in den Himmel strahlten.
Thomas Jensen-Mendez zog die bereits geöffnete Champagnerflasche aus dem Eiskübel und goss die prickelnde Flüssigkeit in ein elegant geschwungenes Glas. Nach einem Blick auf seine Uhr, die 22.28 Uhr zeigte, trank er das Glas aus und füllte es erneut. Zwei blaue Tabletten, die neben dem Eiskübel auf dem Tisch lagen, nahm er auf und schob sie behutsam in seinen Mund. Dann spülte er die viereckigen Pillen mit einem kräftigen Schluck hinunter.
Der Knall der gewaltigen Explosion in dem Museum ließ die Scheiben der Dachterrasse erzittern, als er das Glas gerade ausgetrunken hatte. Kurz darauf breitete sich eine wohltuende Wärme in seinem Körper aus. Eine Wärme, die man allenfalls nachts im Schlaf, während besonderer Träume, spürt. Wenn man sich geborgen und wohl fühlt. Glücklich. Ohne Bedürfnisse. Eins mit dem Universum. Das Champagnerglas, welches aus seiner Hand rutschte und auf dem Fliesenboden der Terrasse zerschellte, nahm er nicht mehr wahr. Mit dem Verlöschen der Scheinwerfer schloss er die Augen.