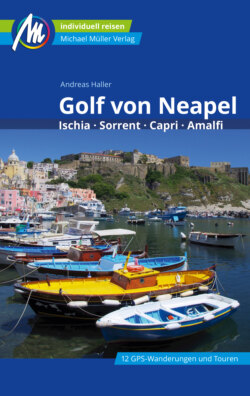Читать книгу Golf von Neapel Reiseführer Michael Müller Verlag - Andreas Haller - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеGesichter einer Stadt
Neapel sehen und sterben − keine noch so lange Abhandlung bringt die Magie der Stadt besser zum Ausdruck als dieses häufig zitierte geflügelte Wort. Wer die Schönheit und Anmut der Metropole am Golf in all ihren Facetten erleben will, sollte einige Tage oder besser eine ganze Woche in der Stadt verbringen. Hat man sich einmal mit den wichtigen Straßenzügen und Gebäudekomplexen vertraut gemacht, fällt die Orientierung leicht. Das Meer liegt stets in Reichweite, auch wenn man es merkwürdig selten zu Gesicht bekommt. Landeinwärts befinden sich die Hügel der Stadt, allen voran der Vomero mit dem Castel Sant’Almo auf der Spitze. Der Stadthügel ist bereits bei der Anfahrt mit dem Schiff gut zu erkennen und rückt nicht selten auch in den schnurgeraden Gassen der Altstadt ins Blickfeld. Dennoch präsentiert sich Neapel gerade Erstbesuchern alles andere als übersichtlich: Fassaden mit Patina, der Lärm der Straßenverkäufer, zum Trocknen aufgehängte Wäsche in den Gassen, Street-Art und knatternde Vespas sorgen für eine ständige Überforderung der Sinne − faszinierend und verstörend zugleich. Antike Artefakte sind ganz selbstverständlich ins Straßenbild integriert, als gehörten sie, wie der lautstark für seine Waren werbende Fischhändler, schon immer hierher. Und schließlich sind da noch die Baustellen, die seit gefühlten Ewigkeiten Straßen und Plätze blockieren. Zumindest dies hat Neapel mit den anderen Metropolen Europas gemein. Zahlreiche Reisegruppen besuchen die Stadt bevorzugt sonntags. Verständlich, weil es an diesen Tagen wesentlich ruhiger ist. Andererseits entfalten die Stadtbezirke gerade werktags ihr Flair am besten.
Die Altstadt ist ein unversiegbarer Born interessanter Dinge, von denen offizielle „Sehenswürdigkeiten“ nur einen geringen Teil ausmachen. Verschiedene Orte auf dem Boden der antiken Neapolis erlauben den Abstieg in die Unterwelt, den Bauch der Stadt. Ein Rundgang durch die Katakomben oder die urbanen Fundamente aus griechisch-römischer Zeit zählt zum Spannendsten, was man in der Mezzogiorno-Metropole unternehmen kann. Überdies bietet die Altstadt fantasievoll eingerichtete Ladengeschäfte, verführerisch duftende Restaurants, Bars und Konditoreien, romantische Hinterhöfe mit reichlich Kolorit und immer wieder Einblicke in den italienischen Alltag und in die neapolitanische Volksfrömmigkeit. Diese kreist um Blutwunder (→ Kasten) und um Aberglauben. Das in Läden und an Souvenirständen omnipräsente rote Hörnchen, corno genannt, ist ein Talisman, der vor dem bösen Blick schützt. Seine Wirkung entfaltet sich nicht, wenn man ihn für sich kauft - man muss ihn geschenkt bekommen!
Paradeblick am Abend vom Posillipo-Hügel
Nicht weniger attraktiv als die Altstadt ist die repräsentative Neustadt. Deren Herz ist die ein wenig an den Petersplatz in Rom erinnernde Piazza del Plebiscito mit dem Stadtpalais der Könige von Neapel und dem grandiosen Teatro San Carlo. Von hier führen innerstädtische Boulevards in zahlreiche Richtungen: Die Via Toledo streift das Spanische Viertel und nimmt Kurs auf das Nationalmuseum, während in der Gegenrichtung die von prächtigen Gründerzeitfassaden flankierte Uferpromenade, die Via Nazario Sauro, insbesondere sonn- und feiertags zum Flanieren einlädt. Außerdem verbindet eine Standseilbahn die Via Toledo mit dem Vomero-Hügel, von dem man einen hinreißenden Ausblick über die Stadt genießt. Ein weiterer Besichtigungshöhepunkt ist für Kunstliebhaber die Gemäldesammlung im Schloss Capodimonte. Sonst präsentiert sich Neapel landeinwärts nicht unbedingt von seiner Schokoladenseite: Beiderseits der Autobahn in Richtung Pozzuoli überwiegen gesichtslose Wohnsilos und freudlos vor sich hindümpelnde Industrieanlagen. Ein Lichtblick an der westlichen Peripherie ist das Science Centre im Industrievorort Bagnoli, das ein Stahlwerk an gleicher Stelle ersetzt. Zwischen Stadtzentrum und Bagnoli erstreckt sich der Posillipo mit dem mutmaßlichen Grab des römischen Dichters Vergil. Heute ist der Hügel eine bürgerliche Wohngegend mit stattlichen Villen und Gärten, in denen auf fruchtbarer Vulkanerde Zitrusfrüchte und Blattgemüse kultiviert werden.
Anime pezzentelle - Totenkult in Neapel
Die Untergründe der Millionenstadt bergen manch abgründiges Geheimnis. Eines davon ist der neapolitanische Totenkult, der bis in die 1970er-Jahre v. a. von Frauen praktiziert wurde. Bedeutende Stätten dieser „matrilokalen Kulte“ sind die Altstadtkirche Santa Maria delle Anime del Purgatorio oder auch der Cimitero delle Fontanelle im Stadtteil Sanità. Letzterer ist für den Totenkult von besonderer Bedeutung, weil das heutige Armenviertel just dort liegt, wo sich einst vor den Toren der antiken Neapolis die griechisch-römischen Katakomben befanden.
Die Sanità wurde erst im Verlauf des 16. Jh. besiedelt (der Name Fontanelle verweist auf den ehemaligen Quellenreichtum). Die turmhoch in den Berg getriebenen Tuffsteingrotten des Gottesackers entpuppen sich als titanisches Beinhaus mit regal-hoch gestapelten Knochen und Schädeln. Zur Blütezeit des Totenkults besuchten Frauen das unterirdische Beinhaus, wuschen die Schädel und beteten für ein günstiges Schicksal der Toten im Fegefeuer. Ein Akt mit doppeltem Nutzen, denn umgekehrt glaubten Praktizierende daran, dass sich die Seelen revanchierten: indem sie Kinder- oder Heiratswünsche erfüllen oder zur Krankheitsgenesung beitragen. Zumeist handelt es sich bei den Knochen um anonyme Tote, die während der verschiedenen Pest- und Choleraepidemien 1656 und 1836/37 hier eingelagert wurden. Andere fanden nach Auflösung innerstädtischer Friedhöfe den Weg hierher. Anime pezzentelle, „verlassene Seelen“ werden die namenlosen Toten genannt, die sich die Frauen im Zuge der Kulte aneigneten; sie gaben ihnen eine „Familie“ und enthoben sie somit ihrer Verlorenheit im Fegefeuer. Der Totenkult ist seit dem barocken Zeitalter der Gegenreformation belegt. Ein bischöfliches Dekret setzte der „heidnischen“ Volksfrömmigkeit 1969 ein Ende.
Weiterführende Literatur:
Ulrich van Loyen: Neapels Unterwelt. Über die Möglichkeit einer Stadt, Berlin 2018.
Totenköpfe als Kultobjekt auf dem Fontanelle-Friedhof
Geschichte Neapels
Antike Forumsreste im Untergrund
Die frühesten Siedlungsspuren befinden sich überraschenderweise nicht auf dem Boden der Altstadt, sondern auf dem Monte Ecchia (Pizzofalcone). Heute ist der Hügel hinter dem Castel dell’Ovo vollständig überbaut, weshalb man ihn gerne übersieht. In der Antike ragte er wie ein Sporn ins Meer, während das Kastell auf einer vorgelagerten Insel stand. Der Name der ersten griechischen Siedlung aus dem 7./6. Jh. v. Chr. lautete Parthenope − eine der drei Sirenen vor der italienischen Küste, an denen Odysseus im Verlauf seiner Irrfahrt vorbeisegelte. Der Sage nach sollen sich die sangesfreudigen Schönheiten ins Meer gestürzt haben. Die sterblichen Reste der Parthenope wurden auf der Insel Megaris (Megaride), Sitz der oben erwähnten Seefestung, angeschwemmt. Noch heute gilt die Sirene − neben Vergil und San Gennaro − als Schutzpatronin der Stadt. Die ersten Bewohner waren Griechen aus der nahe gelegenen Siedlung Cumae (→ Link); diese gründeten um 500 v. Chr. östlich der „alten Stadt“ (Palaepolis) eine neue Siedlung und nannten sie Neapolis. Die „Neustadt“ der Griechen lag exakt auf dem Boden der heutigen Altstadt; wer im Komplex San Lorenzo Maggiore die Treppen hinuntersteigt, kann noch die Ruinen aus griechischer und römischer Zeit besichtigen. Wie die meisten anderen griechischen Kolonien in Unteritalien, blieb Neapel auch während der römischen Herrschaft unabhängig. Als man sich aber in den römischen Bürgerkriegen im 1. Jh. v. Chr. auf die falsche Seite schlug, folgte die Strafe auf den Fuß: Nach dem Sieg Roms verleibte Sulla die Stadt am Golf dem wachsenden Imperium ein.
Im Mittelalter und in der Neuzeit verlief die Entwicklung Neapels im Rahmen der politischen Ereignisgeschichte Unteritaliens (→ Geschichte). Bis 1139 war Neapel Hauptstadt eines unabhängigen, mit Byzanz verbündeten Herzogtums. Eine neue Epoche begann danach mit den Normannen, welche die Stadt am Golf in ihr Königreich Sizilien integrierten. War in der normannischen Epoche die Hauptstadt noch Palermo, verschoben sich in der Folge die Gewichte nach Norden: Eine Zäsur bedeutete die Gründung der Universität 1224 durch Kaiser Friedrich II. − die erste nichtkirchliche Hochschule Europas! Nach der öffentlichkeitswirksamen Hinrichtung des blutjungen Staufersprosses Konradin auf der Piazza del Mercato verlegte Karl I. von Anjou seine Residenz von Palermo nach Neapel und läutete ein neues Zeitalter für die Stadt ein. In der angevinischen Epoche wuchs die Einwohnerzahl der Stadt rasant, begleitet durch eine fieberhafte Bautätigkeit: Am Hafen entstand der trutzige Maschio Angioino als neue Residenz (Castel Nuovo); in der Altstadt wuchsen die riesigen Klosterkomplexe Santa Chiara und San Lorenzo Maggiore in die Höhe; auf dem Hügel entstanden die Certosa di San Martino und mit dem benachbarten Castello Sant’Elmo die dritte große Anlage im Dreigestirn der neapolitanischen Festungen. Mit der Machtübernahme der Aragonier zu Beginn der Renaissance entfaltete sich in Neapel eine höfische Pracht, wie sie auch in anderen Residenzen üblich war: Ausdruck der städtebaulichen Veränderungen in jener Zeit ist das neue Triumphportal aus Marmor am Castello Nuovo. Die weitreichendsten Veränderungen im Stadtbild erfolgten jedoch im anschließenden Barockzeitalter. Ganze Straßen- und Gassenzüge wichen neuen Prachtboulevards, u. a. zerschnitt die Via Toledo die gewachsenen Wohn- und Arbeitsstrukturen. Zwischen dieser neuen Verkehrsachse und dem Vomero-Stadthügel entstand mit den Quartieri Spagnoli ein ganz neues Stadtviertel, das vorwiegend von spanischen Soldaten bewohnt wurde. Um der ständig wachsenden Bevölkerung Herr zu werden, wurde verstärkt in die Höhe gebaut. In der frühen Neuzeit galt Neapel geradezu als Stadt der Hochhäuser! Schließlich veränderten die Barockkirchen, die in fast aberwitziger Anzahl neu entstanden, das Aussehen der Stadt nachhaltig. In „der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts“, schrieb der Kulturhistoriker Dieter Richter, „zählt man 304 Kirchen und 144 Klöster mit fast 5000 Geistlichen.“
In der Neuzeit wurde die Stadt immer wieder von Katastrophen heimgesucht. Im Dezember 1631 brach, nach langer Ruhephase, der Vesuv aus. Das Unglück kostete ca. 3000 Menschen das Leben. Bei der anschließenden Choleraepidemie breitete erstmals der Stadtpatron, der hl. Gennaro, seine schützende Hand über die Neapolitaner aus (→ Kasten). 1647 setzte für kurze Zeit der Masaniello-Aufstand die bestehende Ordnung außer Kraft. Die Erhebung des Fischerhändlers namens Tommaso Aniello wurde blutig niedergeschlagen. Beteiligt waren an der Revolte auch zahlreiche Angehörige des neapolitanischen Pöbels, die berühmt-berüchtigten Lazzaroni (→ Kasten). Während der Herrschaft des Bourbonen Ferdinand IV. wurde im 19. Jh. die Wirtschaftskrise virulent, unterbrochen lediglich durch eine Reformphase unter dem Franzosen Joachim Murat. Aber nach der Niederlage Napoleons in der Schlacht von Waterloo 1815 kehrte der alte Schlendrian wieder in der Stadt am Golf ein, in der Ortsfremde sich nun zunehmend unwohl und unsicher zu fühlen begannen. Immer wieder wüteten Epidemien, die prekäre soziale Lage der Lazzaroni spitzte sich weiter zu. Nach der unità, dem Aufgehen des Königreichs beider Sizilien im neu vereinigten Königreich Italien, begann die längst überfällige Altstadtsanierung: Viele Häuser wurden erstmals ans Kanalisationsnetz angeschlossen, neue Straßenachsen und Repräsentativbauten veredelten um die Wende vom 19. zum 20. Jh. das Stadtzentrum, u. a. der Corso Umberto I oder die Galleria Umberto I mit ihrer weithin sichtbaren Glaskuppel. Die urbane Entwicklung im 20. Jh. ist auch von Versuchen gekennzeichnet, in der Peripherie Industrie anzusiedeln. Dabei führte die Errichtung neuer Wohnviertel an den Rändern zu einem Landschaftsfraß ungekannten Ausmaßes. In der Mussolini-Epoche füllten im Stadtzentrum neue Häuserblocks zwischen Via Toledo und Corso Umberto I die bestehenden Baulücken. In den 1980er- und 1990er-Jahren entstand nach Plänen des renommierten japanischen Architekten Kenzō Tange das Centro direzionale − urbane Hochhäuser mit Spiegelglasfassaden, die Reisenden bereits bei der Anfahrt mit der Eisenbahn ins Auge springen.
Die Lazzaroni − Pöbel unter dem Schlaraffenbaum
Eine wichtige stadtsoziologische Besonderheit Neapels waren die Lazzaroni − das urbane Lumpenproletariat. Die meiste Zeit des Jahres verbrachten die Bettler, Stadtstreicher, Tagediebe und Herumtreiber draußen in den Gassen oder lungerten in Hauseingängen herum. Nur im Winter zogen sie sich zum Schlafen in die unterirdisch gelegenen Katakomben zurück, in jenes Napoli Sotteranea, das heute zu den Touristenmagneten der Stadt zählt (→ Link). Zeitweilig sollen bis zu 60.000 Neapolitaner dieser Schicht angehört haben, deren Name sich vielleicht vom biblischen Lazarus oder aus dem spanischen lacería (Lepra) ableitet. Fest steht, die lazzari, wie sie auch genannt wurden, trugen ihren Namen mit Stolz. Zur kollektiven Identität trug auch deren rote Mütze bei, jene Kopfbedeckung, die durch die Französische Revolution 1789 als Phrygische Mütze oder Jakobinermütze berühmt wurde. Die meiste Zeit über ging es in den neapolitanischen Elendsvierteln trotz großer Armut recht friedlich zu. Dennoch war das Gewaltpotenzial der Lazzaroni in ganz Europa gefürchtet, seit sich die Armenschicht im legendären Aufstand unter Führung von Masaniello (→ Geschichte) kollektiv gegen die Steuerpolitik der spanischen Machthaber erhoben hatte. Viele Reiseberichte der Adeligen, Künstler und Intellektuellen im 18. und 19. Jh. illustrierten das große Unbehagen, sobald die Fremden mit dem Pöbel in Berührung kamen. Zahlreiche kulturelle Stereotype vom wilden, ungezügelten und wollüstigen „Volksgeist“ haben hier ihren Ursprung. Auf der anderen Seite zeigten sich Reisende von der brodelnden Volksseele Neapels fasziniert und brachen eine Lanze für die Unbekümmertheit und Leichtigkeit der Lazzaroni, wobei auch sie den herkömmlichen Klischees folgten.
Die wilde und leidenschaftliche Seite der Lazzaroni kam u. a. bei den großen Festivitäten zur Entfaltung, allen voran bei der jährlichen Blutsverflüssigung des hl. Gennaro. Ein weiteres wichtiges Ereignis war die Cuccagna, wo v. a. (aber nicht nur) Kinder auf einen „Schlaraffenbaum“ (albero della cuccagna) kletterten, um eine oben befestigte Speise herabzuholen. Der bourbonische König Ferdinand IV. galt bis zum Beginn der Französischen Herrschaft auch als Re Lazzarone. Der „Lazzaroni-König“ machte sich nicht selten mit dem Volk gemein und trieb diese proletarischen Spielchen auf die Spitze.
Phrygische Mütze:Ölgemälde im Palazzo Reale
Schließlich veränderte der zunehmende motorisierte Straßenverkehr das Gesicht der Stadt: Staus zur Rushhour gehören zum gewohnten Bild, derweil die neue Metro die Verkehrsströme unter die Erde verlegte. Krisen gehörten auch in der 2. Hälfte des 20. Jh. zum gewohnten Bild: 1972/73 wütete eine verheerende Choleraepidemie. Die Seuche forderte über 20 Menschenleben und bedeutete einen herben Rückschlag für die touristische Entwicklung Süditaliens. 2007 hielt die Müllkrise die Region in Atem. Müllhaufen verpesteten tage- und wochenlang die Straßen der Stadt und legten strukturelle Mängel bloß − es fehlte an Müllverbrennungsanlagen, illegale Deponien waren ein gefundenes Fressen für die örtlichen Camorra-Clans (→ Link), die sich an der Notlage bereicherten. Andererseits erlebte die Stadt durchaus erkennbare Fortschritte: Besonders unter dem Linksdemokraten Antonio Bassolino, der zwischen 1993 und 2000 als Bürgermeister die Geschicke der Stadt am Golf lenkte, erlebte Neapel eine wirtschaftliche, soziale und städtebauliche Renaissance. Die ansprechend gestaltete Uferpromenade zwischen der Piazza del Plebiscito und Mergellina geht u. a. auf seine Initiative zurück.
Neapel besichtigen
Hinsichtlich der Zahl an Sehenswürdigkeiten nimmt Neapel unbenommen einen Spitzenrang unter den europäischen Metropolen ein. Dazu gesellen sich diejenigen Attraktionen, die gegenwärtig nicht zugänglich sind − Baudenkmäler, an denen der Zahn der Zeit nagt und die dem vielerorts grassierenden Verfall anheimgegeben sind. Weil das Geld für die Restaurierung fehlt, werden die betreffenden Denkmäler kurzerhand geschlossen (→ Kasten). Die meisten Attraktionen liegen in der Altstadt und sind bequem zu Fuß vom Hauptbahnhof (Napoli Centrale) erreichbar. Auch die Sehenswürdigkeiten links und rechts der Via Toledo zwischen Piazza Dante und Piazza del Plebiscito werden am besten zu Fuß oder alternativ mit der Metrolinie 1 angesteuert. Gleiches gilt für das am Altstadtrand gelegene Archäologische Nationalmuseum (Linie 1 und 2). Wer indes einen größeren Radius wählt und sich für die Sehenswürdigkeiten auf den Hügeln sowie in der Peripherie interessiert, sollte am besten auf öffentliche Nahverkehrsmittel zurückgreifen. Eine Besonderheit sind die Standseilbahnen (funiculari), die an verschiedenen Stellen das Zentrum mit luftig gelegenen Aussichtspunkten auf den Hügeln verbinden. Die Fahrt allein ist bereits ein für jedermann erschwingliches Erlebnis!
Sehenswertes zwischen Hauptbahnhof und Dom
Das Bahnhofsviertel ist nicht gerade ein Vorzeigequartier − das verbindet die Stadt am Golf mit zahlreichen anderen Metropolen. Unglücklicherweise entpuppt es sich als das Stadtviertel, das Neuankömmlinge als Erstes zu Gesicht bekommen: Klischees einer dreckigen, chaotischen, lauten und vielleicht sogar unsicheren Metropole scheinen sich umgehend zu bestätigen, wobei der Bahnhofsvorplatz (Piazza Garibaldi) nach einem aufwändigen Facelifting die Vorurteile ausnahmsweise Lügen straft. Die moderne Shoppingpassage mit dem Zugang zur Metro ist vom Feinsten, der Individualverkehr wurde eingeschränkt, wovon die zahlreichen Gästehäuser und Hotels am Bahnhofsplatz profitieren.
Zwischen Hauptbahnhof und Altstadt liegen ärmlich wirkende Wohnquartiere mit nur geringer Aufenthaltsqualität, in denen zunehmend Migranten aus vieler Herren Länder den Ton angeben. Einzig der breite Corso Umberto I, der das Bahnhofsviertel mit dem Stadtzentrum verbindet, macht eine Ausnahme und bietet Neuankömmlingen die Option, schnurstracks die „besseren Gegenden“ der Stadt anzusteuern. Auf der anderen Seite versäumt man auf diese Weise das eine oder andere Juwel, das den Besuch lohnt: die Gemäldegalerie im Gebäude der sozial engagierten Bruderschaft Pio Monte della Misericordia, die grandiose Chiesa San Giovanni a Carbonara oder auch diverse Sehenswürdigkeiten hinter dem Dom, z. B. das Museum MADRE und das Kirchenschatzmuseum mit den zwei Kirchen Santa Maria Donnaregina. Weiteres Highlight ist der Fischmarkt, auf dem sieben Tage in der Woche eine hektische Betriebsamkeit herrscht.
Chiesa Santa Maria Donnaregina Nuova
Ein ganz besonderes Stadtviertel ist die „Gabel“ (forcella): Gleich einer Astgabel bilden hier die Gassen ein „Y“. Wegen der Camorra mieden einst Stadtführer das Quartier und nahmen auf dem Weg zum Dom lieber einen Umweg in Kauf. Heute scheint die Gefahr, wenn je eine bestanden hat, vorbei. Interessantestes Bauwerk hier ist ein ehemaliges Hospiz und Waisenhaus, das als Sammelbecken für Kinder diente, die von ihren Eltern ausgesetzt wurden. Aus der Not heraus bzw. aus Mangel an besserem Wissen erhielten sämtliche Waisenkinder den Einheitsnamen Esposito („Ausgesetzter“ bzw. „Ausgesetzte“). Noch heute hören auffallend viele Neapolitaner auf den Nachnamen „Esposito“ ...
Porta Nolana (Fischmarkt)
Direkt an der Endhaltestelle gleichen Namens der Circumvesuviana-Vorortbahn gelegen, ist das Stadttor aus dem 15. Jh. häufig das erste Bauwerk, das Tagesbesucher von Neapel zu sehen bekommen. In der frühen Neuzeit führte durch das robust gemauerte Tor die Ausfallstraße nach Nola. Direkt dahinter verbreitet der Fischmarkt Atmosphäre und Flair − und versorgt nebenbei die örtliche Gastronomie an sieben Tagen in der Woche mit frischen Muscheln und Meeresfrüchten. Außerdem gibt es hier Obst, Gemüse, Kleidung und CDs.
Stadtrundgang: Kurzvisite − Neapel an einem Tag
Startpunkt des Rundgangs ist die Piazza Garibaldi mit dem Hauptbahnhof. Vom jenseitigen Ende des Platzes biegen Sie, mit dem Rücken zum Bahnhof, halblinks in den Corso Umberto I ein. Danach folgen Sie der Straße, die das Bahnhofsviertel mit der repräsentativen Neustadt verbindet, bis zur achteckigen Piazza Nicola Amore. Hier halten Sie sich rechts und laufen auf der Via Duomo zum Dom San Gennaro (→ Link).
Nach der Dombesichtigung geht es auf besagter Via Duomo ein kurzes Stück zurück, bis die Via Tribunali rechts abzweigt. Bei der belebten Altstadtgasse handelt es sich faktisch um die antike Hauptstraße (decumanus maximus), wobei in der griechischen Epoche das Straßenniveau deutlich tiefer lag. Nach 250 Metern markiert eine Kreuzung mittelalterlicher Gassen, die Piazza San Gaetano, die Lage des einstigen antiken Forums (→ Link). Die unscheinbare Kreuzung ist das Herz der mittelalterlichen Altstadt Neapels. Von hier kann man in den in den Bauch der Stadt absteigen (Napoli Sotterranea) oder den Komplex San Lorenzo Maggiore mit den Überresten der griechischen Stadt erkunden.
Zentral: Piazza del Gesú Nuovo
Von der Via Tribunali zweigt nach links die berühmte Krippengasse ab und endet wenig später am Spaccanapoli. Dem „Spalt von Neapel“ folgen Sie nach rechts, vorbei an der Statue des Gottes Nil und an der gleichnamigen Bar mit dem Maradona-Altar gegenüber. An der antiken Nil-Skulptur wenden Sie sich auf der Via Nilo nach rechts und biegen bei erster Gelegenheit wieder links ab. Nach wenigen Schritten stehen Sie vor dem Eingang der Cappella Sansevero (→ Link).
Zurück am Spaccanapoli nehmen Sie die ursprüngliche Gehrichtung wieder auf und folgen dem „Gassenspalt“ bis zum Sakralkomplex Santa Chiara (→ Link). Hier empfiehlt sich die Besichtigung des Kreuzgangs, der sich gut mit einer WC- und Kaffeepause verbinden lässt. Danach setzen Sie den Weg auf dem Spaccanapoli bis zur Piazza del Gesù Nuovo fort.
Auf dem Platz mit dem 40 Meter hohen Obelisco dell’Immacolata (1747) befinden sich das Touristenbüro und der Eingang zur barocken Chiesa del Gesù Nuovo (→ Link). Nach dem Besichtigungsstopp verlässt die Route die Altstadt auf der halblinks bergab führenden Calata Trinità Maggiore und quert eine Hauptverkehrsstraße. Orientierung bietet der Brunnen auf der anderen Straßenseite, die Fontana di Monteoliveto. Dahinter führen Treppen zum Eingang der Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi (→ Link).
In Fortsetzung der bisherigen Gehrichtung gelangen Sie zur Via Toledo, auf der es links weitergeht. Die Geschäftsstraße passiert den Eingang zur Galleria Umberto I und endet auf der weitläufigen Piazza del Plebiscito im Herzen der repräsentativen Neustadt mit der Chiesa San Francesco di Paola, dem Palazzo Reale und dem Café Gambrinus. Von hier ist es nur ein kurzes Stück zur Piazza Municipio. Sie passieren die erwähnte Einkaufspassage (Galleria Umberto I) und das Teatro San Carlo, bevor das Castel Nuovo mit dem prächtigen Marmorportal (→ Link) abschließend ins Blickfeld rückt. Zurück zum Ausgangspunkt der Tour geht es mit der Metrolinie 1.
Porta Capuana
Das Stadttor aus dem Jahr 1484 wirkt wie ein Triumphbogen und stand ursprünglich einmal an einer anderen Stelle. Das eigentliche Portal in der Mitte ist ein Werk der Renaissance und besteht aus Carrara-Marmor. Das großformatige Bauwerk auf der anderen Straßenseite ist das Castel Capuano aus der normannischen Herrschaftsepoche. Heute beherbergt das trutzige Gebäude u. a. eine Bibliothek.
Chiesa San Giovanni a Carbonara
Das über eine Freitreppe erreichbare ehemalige Augustinerstift liegt auf halbem Weg zwischen Bahnhof und Nationalmuseum. Das Ensemble in wenig anheimelnder Umgebung enthält einige großartige Kunstschätze aus dem späten Mittelalter und der Renaissance, u. a. das monumentale Grabmal des Königs Ladislaus (1376−1414) aus dem Haus der Anjou. Das Kunstwerk im Stil eines Hochaltars wurde 1428 vollendet und ruht auf vier Figuren − allegorische Darstellungen der Tugenden Mäßigung, Stärke, Vorsicht sowie Großmut. Die Schöpfer des Grabmals stammten wohl aus der Lombardei oder der Toskana. Sehenswert sind ferner die Fresken aus der 2. Hälfte des 15. Jh. in der Cappella Carracciolo del Sole unmittelbar hinter dem Grabmal und die Marmorarbeiten aus der Renaissance in der Cappella Carracciolo di Vico. Zeitweilig diente der Sakralkomplex in der Renaissance als Zentrum des Humanismus und der Wissenschaften. Nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurden Kirchen und Kreuzgänge aufwändig restauriert und wiederhergestellt.
♦ Mo 9−13, Di 9−18 Uhr. Via Carbonara 4.
Pio Monte della Misericordia
Die renommierte Wohlfahrtsorganisation gründeten 1602 sozial engagierte Adelige. Heute ist der Stiftungssitz ein Museum: Das Hauptwerk in der Kapelle mit achteckigem Grundriss ist das von Caravaggio zu Beginn seines Neapelaufenthalts für die karitative Institution geschaffene Altargemälde „Sieben Werke der Barmherzigkeit“ (Sette opere di Misericordia). Die Galerie im Obergeschoss präsentiert Werke u. a. aus der Blütezeit des neapolitanischen Barocks.
♦ Mo-Sa 9-18, So 9-14.30 Uhr. 7 €, erm. 5 €. Via Tribunali 253, www.piomontedellamisericordia.it.
Duomo San Gennaro
Weil der in spiritueller Hinsicht wichtigste Sakralbau komplett in die Stadtlandschaft integriert ist, macht er von außen eher wenig her. Ein bescheidener Vorplatz gibt nur wenig Raum für die Freitreppe zum Eingangsportal. Innen sticht zunächst die Barockausstattung ins Auge, die in Neapel natürlich standesgemäß-üppig ausfällt. Aus kunsthistorischer und spiritueller Perspektive bedeutender sind die beiden Seitenkapellen, die hinsichtlich ihrer Dimensionen Querschiffen gleichen. Linker Hand gelangen Besucher in die Basilika Santa Restituta, die den Status einer eigenständigen Kirche im Domkomplex genießt. Tatsächlich handelt es sich um den Rest des 324 n. Chr. von Kaiser Konstantin gegründeten Vorgängerbaus. Noch heute befinden sich hier die Reliquien der hl. Restituta, die Urlauber aus Ischia möglicherweise als Inselpatronin wiedererkennen (→ Link). Um 1300 fiel der rückwärtige Teil des alten Doms dem Neubau zum Opfer. Eintrittspflichtig ist die von der Basilika zugängliche Taufkapelle San Giovanni in Fonte. Bemerkenswert ist die achteckige Trommelkuppel, die − wie die Mosaikreste − auf orientalische Einflüsse schließen lässt und aus dem 4. Jh. n. Chr. stammt.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Hauptschiffs befindet sich die Kapelle des hl. Januarius (Cappella del Tesoro di San Gennaro) mit der berühmten Phiole, die bei der jährlichen Blutwunder-Zeremonie ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt (→ Kasten). Die auch für neapolitanische Verhältnisse ungewöhnlich üppige Ausstattung finanzierte das städtische Bürgertum nach dem glücklichen Ende einer Pestepidemie. Für die Kunstwerke verpflichtete man die damalige Crème de la Crème und scheute dabei keinerlei Kosten. Herausragend sind die Fresken aus dem 17. Jh. von Domenichino und Giovanni Lanfranco und der Hochaltar von Francesco Solimena.
Übrigens: Wenn über Mittag der Dom geschlossen hat, ist die Kapelle weiter über die Domschatzkammer (→ unten) zugänglich.
♦ Dom: Mo−Sa 8.30−13.30 und 14.30−19.30, So 8−13 und 16.30−19.30 Uhr. Baptisterium: 9.30−12 und 16.30−19, So 8−12 Uhr. 1,50 €.
Duomo San Gennaro: Blutwunder oder Scharlatanerie?
San Gennaro, um 305 n. Chr. verstorbener Bischof und Märtyrer, ist gleichzeitig Patron der Kathedrale sowie Schutzheiliger der Stadt Neapel. Rationalisten mokieren sich in schönster Regelmäßigkeit über einen seltsamen Hype, der zwei- bis dreimal im Jahr veranstaltet wird und sich um den Heiligen als Hauptperson dreht. Besser gesagt: um ein paar Phiolen mit einer rostrot-braunen Substanz. Die Neapolitaner glauben, dass die sorgsam in einer Seitenkapelle des Doms verwahrten Ampullen das (eingetrocknete) Blut des hl. Januarius enthalten. Geht es der Stadt und den Bewohnern gut, dann verflüssigt sich das Blut im Zuge eines Kirchenrituals, das alljährlich am ersten Maiwochenende und am 19. September, dem Namenstag des Heiligen, stattfindet. Schwierig wird es dann, wenn das Wunder seine Schuldigkeit versagt und sich das Blut nicht verflüssigt. Jeder Neapolitaner weiß von Katastrophen zu berichten, bei denen dies geschah: Beim Erdbeben im Jahr 1980 starben über 2000 Menschen. Und wurde nicht 1988, inmitten der goldenen Jahre, der Fußballverein SSC Neapel nur Zweiter − hinter dem ungeliebten Rivalen Inter Mailand? Andererseits ist bei Neapolitanern das Schicksalsjahr 1631 fest im Gedächtnis verankert, als lediglich die auratische Kraft − und das Blut − des Heiligen die große Pestkatastrophe als Folge eines Vesuvausbruchs zu verhindern half. An das Ereignis gedenkt u. a. die Guglia di San Gennaro auf der Piazza Riario Sforza.
Im Zeitalter der heraufziehenden Naturwissenschaften haben immer wieder Menschen den Miracolo di San Gennaro als Scharlatanerie bezeichnet. Ein Chemiker verwies z. B. auf das Phänomen der Thixotropie, der zufolge feste Stoffe bei der Berührung mit bestimmten Substanzen ihre „Fließeigenschaft“ schlagartig verändern.
Museo del Tesoro di San Gennaro
Die Domschatzkammer birgt einige Highlights, u. a. das prächtige Juwelenkollier des hl. Januarius (Collana di San Gennaro), das 1679 der Künstler Michele Dato fertigte. Ein Blickfang ist auch die Bischofsmütze aus dem Jahr 1713 (Mitra Gemmata), die mit 198 Smaragden, 168 Rubinen sowie 3328 Diamanten bestückt ist. Der Museumsrundgang schließt auch den Besuch der Sakristei ein, außerdem ist die barocke Seitenkappelle des Doms mit der Blutphiole zugänglich.
♦ Mo−Fr 9−16.30, Sa/So bis 17.30 Uhr. 8 €. Via Duomo 149, www.museosangennaro.it.
Schatzkammer des hl. Januarius: Blick in die prächtige Kuppel
Complesso Monumentale Donnaregina (Museo Diocesano)
Zum versteckt hinter dem Dom gelegenen Sakralkomplex gehören zwei Kirchen: eine prächtig ausgestattete Kirche im Stil des Barocks (Donnaregina Nuova) sowie dahinter das ältere Gotteshaus im gotischen Stil mit Wandfresken, die zu den am besten erhaltenen in der ganzen Region zählen (Donnaregina Vecchia).
Die beiden Kirchen gehörten zu einem frühmittelalterlichen Nonnenkloster, das bei einem schweren Erdbeben 1293 zerstört und danach im gotischen Stil wieder aufgebaut wurde. Königin Maria d’Ungheria, Ehegattin Karls von Anjou, steuerte die finanziellen Mittel bei − ihr Grabmal zählt zu den künstlerisch hochwertigsten Marmorwerken aus der gotischen Epoche und befindet sich im Hauptschiff an der rechten Seitenwand. Ebenfalls sehenswert sind die Fresken aus dem 14 Jh. in der Cappella Loffredo. Diese befindet sich schräg gegenüber in der Nähe des Eingangs zur Linken. Vom einstigen Kreuzgang führt eine Treppe zur Chorempore mit weiteren Fresken (ebenfalls 14. Jh.), die bei einem Brand des Dachstuhls 1390 schwer beschädigt wurden. Dargestellt werden u. a. Szenen aus dem Jüngsten Gericht und aus der Passion Christi.
Der barocke „Neubau“ des Komplexes wurde 1617 begonnen und präsentiert sich heute im typischen Überschwang neapolitanischen Barocks. Namhafte Künstler wie Francesco Solimena oder Luca Giordano steuerten Werke zur Ausstattung bei. Den schönsten Blick auf den Innenraum genießt man oben von den Emporen, die gleichzeitig die wichtigen Kirchenschätze präsentieren (Museo Diocesano).
♦ Tägl. außer Di 9.30−16.30, So bis 14 Uhr. 6 €. Largo Donnaregina, www.museodiocesanonapoli.it.
Museo d’Arte Contemporanea Donna Regina (MADRE)
Das große Museum für Gegenwartskunst befindet sich unweit des Doms am Altstadtrand im Palazzo Donna Regina. Nach einer umfangreichen Kernsanierung präsentiert das Haus seit 2005 auf 8000 m2 Gemälde und Skulpturen ausgewählter Künstler der Moderne. Besondere Schwerpunkte sind die Konzeptkunst, die Avantgarde und die Arte Povera − eine in den 1960er- und 1970er-Jahren in Norditalien beheimatete Kunstrichtung, die für Installationen bevorzugt Alltagsmaterialien verwendete. Der erste Sammlungsbereich widmet sich Künstlern mit biografischem Bezug zur Stadt Neapel. Vorgestellt werden u. a. Arbeiten von Mimmo Paladino, Anish Kapoor, Sol LeWitt, Rebecca Horn und Jeff Koons. Ein zweiter Sammlungsbereich stellt Werke bekannter Künstler seit den 1950er-Jahren vor, z. B. von Gerhard Richter, Roy Lichtenstein und Andy Warhol. Angeschlossen sind ein Café, eine Mediathek sowie eine Kunstbuchhandlung.
♦ Tägl. außer Di 10−19.30, So bis 20 Uhr. 8 €, erm. 4 €. Via Settembrini 79, www.madrenapoli.it.
Sehenswertes in der Altstadt
Das mittelalterlich geprägte Stadtviertel zwischen Via Duomo und Piazza Dante bzw. zwischen Corso Umberto I und dem Archäologischen Nationalmuseum ist einerseits kompakt, andererseits ein komplexer Kosmos, der althergebrachte Seh- und Denkgewohnheiten zuweilen stark strapaziert. Letzteres macht den spezifischen Reiz der neapolitanischen Altstadt aus. Schnurgerade verlaufende Gassen erleichtern die Orientierung; sie ergeben ein Schachbrettmuster, das interessanterweise exakt dem Verlauf der antiken Straßenzüge entspricht. Die Hauptstraße (decumanus maximus) zur Zeit der griechischen Neapolis war die heutige Via Tribunali, die kerzengerade den Dom mit der Piazza Dante am anderen Ende des Quartiers verbindet. An der Abzweigung der Krippengasse lag in der Antike die Agora bzw. das Forum. Zwei Säulen des einstigen römischen Dioskurentempels schmücken die Renaissance-Fassade der Chiesa San Paolo Maggiore, die sich heute anstelle der antiken Forumsbauten an der Piazza San Gaetano erhebt. Namhafter als die Via Tribunali ist eine parallel verlaufende Gasse, die auf viele Namen hört, den meisten Neapolitanern jedoch als „Spalt Neapels“ (Spaccanapoli) ein Begriff ist. In der Tat spaltet diese Gasse das Altstadtquartier radikal in zwei Hälften. Am besten ist dieser Effekt vom Castel Sant’Elmo auf dem Vomero-Hügel zu erkennen. Wie populär der Name noch heute ist, zeigt u. a. die Tatsache, dass sich eine Tarantella-Musikgruppe nach dieser Gasse benannt hat. Die Hauptflaniermeile mit zahlreichen Geschäften, Bars, Restaurants und − natürlich − Sakralbauten präsentiert sich zu jeder Tages- und Nachtzeit für Ortsfremde wie Einheimische als hochattraktives Pflaster! Die berühmte Krippengasse verbindet den Spaccanapoli mit der anfangs erwähnten Via Tribunali.
Einigen Flaneuren ist vermutlich nicht bewusst, dass sich unter dem heutigen Straßenniveau die Überbleibsel aus der Antike befinden. Im Mittelalter setzten die Bewohner ihre Häuser schlicht auf die vorhandenen Fundamente; und bis heute benutzen sie die darunterliegende Bausubstanz aus griechisch-römischer Zeit als Keller. An mehreren Stellen gibt es die Möglichkeit, von der Moderne in die Antike hinabzusteigen: im Komplex San Lorenzo Maggiore oder im Rahmen einer Führung durch den Untergrund von Neapel (Napoli Sotterranea). Der berühmte „Bauch Neapels“ bietet jedoch weit mehr als Einblicke in antike Bausubstanzen, denn während des letzten Weltkriegs nutzten die Neapolitaner die Katakomben als Luftschutzbunker. Grandios ist das überwiegend aus der römischen Epoche stammende unterirdische Zisternensystem!
Bei den zahlreichen Besichtigungsoptionen sollte man nicht vergessen, dass die Altstadt mehr als Kirchen, Klöster und Kreuzgänge bietet. Das Quartier präsentiert sich als durchweg freundliches und stets stimmungsvolles Panoptikum des neapolitanischen Alltags mit alternativer Kunst im öffentlichen Raum, charmanten Hinterhöfen, frisch gewaschener Wäsche zwischen Wohnhäusern u. v. m. 1995 wurde die Altstadt zum Weltkulturerbe erklärt.
Antike Wasserversorgung
Napoli Sotterranea (Neapels Untergrund)
Die Führung durch den „Bauch Neapels“ konfrontiert Besucher mit der über 5000 Jahre währenden Geschichte Neapels, in der sich eine labyrinthische Parallelwelt unter Tage gebildet hat. Die Gesamtlänge des Systems aus Grotten und Tunnels unter der Altstadt beträgt über 100 km! Der eine Teil der geführten Tour begutachtet zunächst eine der berühmt-berüchtigten bassi − der fensterlosen, im Winter stets klammen Erdgeschosswohnungen der urbanen Unterschichten. Am museal hergerichteten basso lässt sich gut erkennen, dass man sozusagen Seite an Seite mit den antiken Ruinenresten lebte (und teilweise immer noch lebt), in diesem Fall den Resten des römischen Theaters aus dem 4. Jh. v. Chr. Angeblich trat der nach öffentlicher Zustimmung gierende Kaiser Nero hier vor Publikum auf! Beinahe noch interessanter ist der zweite Teil der Führung durch das v. a. in römischer Zeit gewachsene System unterirdischer Zisternen und Wasserleitungen. Die Besucher schieben sich, teilweise mit Kerzen in der Hand, durch Gänge in klaustrophobischer Enge, dann wieder weitet sich die Szenerie und der Blick fällt auf bizarre Tuffsteinkavernen. Wo die Einwohner im Zweiten Weltkrieg Schutz vor Bomben suchten, züchtet man heute Kräuter oder lagert Wein (Letzteren gibt es im Shop am Ausgang zu kaufen).
♦ Führungen tägl. 10−18 Uhr zu jeder vollen Std. (ital.), engl. Führungen um 10, 12, 14, 16 und 18 Uhr. 10 €, erm. 8 €, Kinder (5−10 J.) 6 €. Piazza San Gaetano 68, www.napolisotterranea.org.
San Lorenzo Maggiore
Der Komplex an der Abzweigung der Krippengasse von der Via Tribunali besteht aus drei Teilen: der Basilika, dem Kloster sowie den Ausgrabungen aus der Antike unterhalb des Gotteshauses. Kirche und Kloster gehörten im Mittelalter dem Franziskanerorden an, den Sakralbau im Stil der französischen Gotik initiierte König Karl von Anjou im letzten Drittel des 13. Jh. Das ungewöhnlich breit konzipierte Hauptschiff endet am architektonisch besonders schön gelungenen Chorumlauf. Ebenfalls im Chor ist an zwei Stellen mit Plexiglas das originale Bodenmosaik abgedeckt; es stammt von der frühchristlichen Vorgängerkirche aus dem 6. Jh., die dem hl. Laurentius geweiht war.
Lustiges Panoptikum: Neapels einzigartige Krippengasse
Das angrenzende Kloster mit dem freskenverzierten Refektorium (Sala Sisto V.) aus dem 17. Jh. und dem schmucken Kapitelsaal (Sala Capitolare) birgt den Zugang zu den Ausgrabungen aus griechisch-römischer Zeit. Zu sehen ist der ehemalige Cardo Maximus nebst angrenzenden Geschäften, u. a. mit Wäscherei, Bäckerei und einer Stoffhandlung. Eine stimmungsvolle Beleuchtung verleiht den erstaunlich gut konservierten Relikten aus der Antike einen ganz spezifischen Reiz. Der Rundgang endet schließlich im Museum, das in verschiedenen Räumen Fundobjekte aus der Antike, darunter Sarkophage und Keramiken, sowie sakrale Kunst präsentiert. Ein Modell veranschaulicht die exakte Lage des römischen Theaters (→ Link) in der heutigen Altstadt.
♦ Tägl. 9.30−17.30 Uhr. 9 €, erm. ab 6 €, Kombiticket mit Galleria Borbonica (→ unten) 15 €, erm. 10 €. Piazza San Gaetano, www.sanlorenzomaggiorenapoli.it.
Via San Gregorio Armeno (Krippengasse)
Was bei uns der Tannenbaum, ist für Neapolitaner die Krippe. Aus diesem Grund herrscht in den Kunsthandwerksboutiquen beiderseits der Krippengasse in der Vorweihnachtszeit der größte Trubel. Die neapolitanische Krippenkunst ist jedoch weit mehr als gelebte christliche Volksfrömmigkeit, denn wer genauer hinsieht, entdeckt in den Auslagen Figuren, die im Weihnachtskontext eigentlich nichts verloren haben: Politiker, Fußballspieler, Stars aus dem aktuellen Showbiz oder Prominente, die − aus welchen Gründen auch immer − im jeweiligen Jahr in die Schlagzeilen geraten sind. Manche verorten daher die Ursprünge dieser Tradition in vorchristlichen Zeiten. Das 18. Jh. brachte die Blüte der Krippenkunst: Während man im höfischen Kontext Figuren aus feinem Porzellan bevorzugte, war man beim einfachen Volk etwas sparsamer und formte die Figuren aus Holz-Draht-Gestellen, an die man Tonköpfe befestigte. Auf diese traditionelle Art entstehen die Figuren noch heute, wobei zunehmend Billigware aus Fernost den einheimischen Künstlern das Leben erschwert. Neben Krippenfiguren findet man in den Vitrinen häufig das rote Hörnchen (corno) − ein beliebter Glücksbringer (→ Link).
Chiesa e Chiostro di San Gregorio Armeno
Die Kirche und der Kreuzgang sind − über jeweils getrennte Treppenaufgänge − von der Krippengasse aus zugänglich und werden angesichts des Rummels rund um die Verkaufsstände gerne übersehen. Der Sakralbau entpuppt sich als typischer Vertreter neapolitanischer Barockkunst mit einer prachtvollen Freskenausstattung, die beinahe vollständig vom neapolitanischen Barockkünstler Luca Giordano stammt. Der wunderbar weitläufige Kreuzgang wiederum wirkt im Gegensatz zum Stadtgetümmel wie eine Oase. Ein Augenschmaus ist der marmorne Barockbrunnen in der Mitte mit allerlei verschlungenen Figuren und Meerestieren.
♦ Kirche: Mo−Sa 9−12, sonn- und feiertags 9−13 Uhr. Eintritt frei. Kreuzgang: Mo−Fr 9.30−13, Sa/So 9.30−13 und 15−18 Uhr. 4 €, erm. 3 €.
Marmorstatue für den Flussgott im Altstadtzentrum
Statua del Nilo
Auf einer Platzerweiterung am Spaccanapoli steht auf einem Marmorsockel die unscheinbare Statue des antiken Flussgottes Nil. Es handelt sich tatsächlich um ein Kunstwerk aus römischer Zeit, das in den Wirren der Völkerwanderungen verloren ging und erst im 12. Jh. wieder aufgefunden wurde. Der im Mittelalter fehlende Kopf wurde 1667 hinzugefügt. Die Bar gegenüber heißt standesgemäß Bar Nilo. Wer hineinschaut, entdeckt an der Wand einen Altar für Diego Maradona. Der argentinische Fußballprofi, bekannt durch die „Hand Gottes“ im Länderspiel 1986 gegen England, wurde 1987 und 1990 mit dem SSC Neapel italienischer Fußballmeister. Hiesigen Tifosi gilt er noch immer als sakrosankt.
Cappella Sansevero
Die Privatkapelle der Adelsfamilie Sansevero ist von außen unscheinbar, birgt aber ein bemerkenswertes Kunstwerk, das man sich nicht entgehen lassen darf. Es handelt sich um die Statue des Verhüllten Leichnam Christi (Cristo velato), die der neapolitanische Meister Giuseppe Sanmartino 1753 schuf. Von atemberaubender Anmut ist das Leinentuch aus Marmor, das auf die Betrachter der „Pietella“ wie ein transparentes Tuch wirkt, obwohl es in Wahrheit aus einem Stück mit dem Rest der Statue angefertigt wurde. Es handelt sich in der Tat um ein kolossales Meisterwerk der Barockkunst! Zudem beherbergt das Kirchlein zwei anatomische Modelle, die ein wenig an Gunther von Hagens und seine platinierten menschlichen Körper erinnern. Die „Skulpturen“ − es handelt sich um einen Mann und eine schwangere Frau − entstanden ebenfalls im 18. Jh. Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben 2008 die Echtheit der Skelette, das Netz der Blutgefäße hingegen ist künstlich und besteht aus Draht und farbigem Wachs. Die an ein Wunderkabinett gemahnenden Ausstattungsstücke gaben immer wieder zu Spekulationen Anlass, zumal der damalige Eigentümer der Privatkapelle Freimaurer war, dem man beste Beziehungen zur alchimistischen Szene nachsagte (→ Kasten, siehe unten).
♦ Tägl. außer Di 9−19 Uhr. 8 €, erm. 6 €. Via Francesco De Sanctis 19−21, www.museosansevero.it.
Freimaurer, Erfinder, Alchimist: Raimondo, Fürst von Sansevero
Raimondo di Sangrio (1710−1771), Fürst von Sansevero, war eine schillernde Figur im barocken Neapel. Der Soldat in Diensten der Bourbonen erhielt in Rom eine fundierte Jesuitenausbildung, bevor er sich in Neapel niederließ und in der Hauptsache wissenschaftliche Forschungen betrieb. Zahlreiche Freimaurersymbole in der Privatkapelle der Familie Sansevero (→ siehe oben) lassen vermuten, dass Raimondo Mitglied in den Geheimbünden der Freimaurer und Rosenkreuzer war. Im Lauf der Zeit stieg er sogar bis zum Logenmeister auf. Vielen Zeitgenossen, v. a. den Vertretern der Kirche, war das Treiben des Adeligen jedoch überaus suspekt. Den Gipfel der Absonderlichkeiten markierten die Skelette, die noch heute in der Kapelle ausgestellt sind. Hinter vorgehaltener Hand wurde gemunkelt, Raimondo habe lebenden Menschen eine Art alchimistisches Zauberserum injiziert, um das augenblickliche Erstarren des Gefäßapparates zu erwirken. Tatsächlich kaufte er eins dieser Modelle der menschlichen Anatomie einem Arzt aus Sizilien namens Giuseppe Salerno ab, nachdem er es auf einer öffentlichen Ausstellung entdeckt hatte. Das zweite Modell, die schwangere Frau, gab er danach bei dem Arzt in Auftrag.
Sant’Angelo a Nilo
Die Stiftskirche wäre eventuell kaum eines Blickes wert, wenn sich innen nicht ein ganz besonderes kunsthistorisches Kleinod befände. Es handelt sich um das Grabmal des Kardinals Brancaccio, weswegen das Gotteshaus auch als Cappella Brancaccio bekannt ist. Die sechs Skulpturen − fünf stehend, eine liegend − schufen mit Donatello und Michelozzo zwei bedeutende Renaissancebildhauer. Bemerkenswert sind die Faltenwürfe der Gewänder!
♦ Mo−Sa 8.30−13 und 16.30−18.30, So 8.30−13 Uhr. Eintritt frei.
San Domenico Maggiore
Karg wirkt die Fassade der Dominikanerkirche von außen, innen überwältigt üppiger Barock. Die prächtige Ausstattung erzeugt einen stimmigen Gesamteindruck und verhehlt dabei nicht, dass es sich ursprünglich um ein gotisches Bauwerk handelte. Übrigens studierte 1239−1244 Thomas von Aquin am Studium Generale der Universität von Neapel; der Dominikaner sollte in der Folge zu einem der bedeutendsten Kirchenlehrer des Mittelalters werden. Seltsamerweise führt vom Vorplatz am Spaccanapoli eine Treppe hinauf und in die Kirche, wobei man das Gotteshaus durch eine Türe direkt am Hauptaltar betritt! Im Kloster nebenan werden die Kirchenschätze ausgestellt, die sich bei einer Führung begutachten lassen.
♦ Kirche: Tägl. 10−19 Uhr. Eintritt frei. Kloster und Museum: Tägl. 10−18 Uhr. Führungen 5 €, erm. 4 € (kompakt), 7 €, erm. 5 € (ausführlich). Piazza San Domenico Maggiore 8a, www.museosandomenicomaggiore.it.
Santa Chiara
Der ehemalige Klarissinnenkonvent zählt zu den Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt. Die Fenster der riesigen Kirche im Zentrum des Klosterkomplexes lassen nur wenig Licht hinein, und auch sonst wirkt das hoch aufragende gotische Längsschiff auf den ersten Blick etwas karg. Eigenartigerweise verzichtet der Sakralbau auf Querhaus und Chor, was konzeptionelle Gründe hat: Der benachbarte Klarissinnenkonvent musste nämlich integriert werden, ein Problem, das die Architekten im 14. Jh. mit einem komplett vom Innenraum abgetrennten Nonnenchor lösten. Das Längsschiff wird auf beiden Seiten von Kapellen flankiert, die u. a. als Grabkapellen neapolitanischer Herrscher fungierten. Das kunsthistorisch bedeutendste Grabmal befindet sich hingegen am Hochaltar. Hier ruhen die sterblichen Reste Roberts von Anjou, Mitte des 14. Jh. schufen die florentinischen Künstler Giovanni und Pacio Bertini das Monumentalgrab. Ein Bombenangriff am 4. August 1943 richtete schwere Zerstörungen in der Kirche an.
Sehenswert ist auch der Kreuzgang südlich der Kirche. Einzigartig sind die Säulen, Balustraden und Sitzbänke, die mit farbigen Majolikaplatten gefliest sind. Der spielerisch-leichte Gesamteindruck will so gar nicht zur monastischen Strenge passen, schließlich leben heute noch immer einige franziskanische Minderbrüder in dem Kloster. Den Majolikakreuzgang schuf 1739 der bedeutende neapolitanische Maler und Rokokobildhauer Domenico Antonio Vaccaro. Den Umbau der mittelalterlichen Klosteranlage im Stil des Barock sponserte u. a. die Königin Maria Amalia von Sachsen, Frau des Bourbonenkönigs Karl III., mit nicht geringen finanziellen Mitteln. Vom Seitenflügel des Kreuzganges ist ein übersichtliches, aber sehenswertes Museum zugänglich (Museo dell’Opera): Die gezeigten Exponate illustrieren Aspekte der Baugeschichte und stammen aus unterschiedlichen Epochen von der Gotik bis zum Barockzeitalter. Außerdem sind vom Museum die freigelegten Reste einer Therme aus römischer Zeit zugänglich. Es handelt sich um die größte bislang entdeckte Thermenanlage im Stadtgebiet; die wichtigsten Funde aus dem Grabungsareal werden ebenfalls nebenan im Museum präsentiert.
♦ Kirche: 7.30-13 und 16.30-20 Uhr. Kloster: Mo−Sa 9.30−17.30, So 10−14.30 Uhr. 6 €, erm. 4,50 €. Via Santa Chiara 49c, www.monasterodisantachiara.it.
Oase der Ruhe: Der Majolika-Kreuzgang von Santa Chiara
Chiesa Gesù Nuovo
Von außen ist dieses Gotteshaus aus gutem Grund nicht als ein solches erkennbar: Denn ursprünglich befand sich hinter der Diamantquaderfassade mit den Pyramidenspitzen aus Stein der Palazzo der Adelsfamilie Sanseverino. Im Zeitalter der Renaissance entwickelte sich der Palast zu einem der bedeutendsten kulturellen Zentren der Stadt. Nach der gescheiterten Revolte Ferrante Sanseverinos gegen die spanischen Herrscher wurde das Familieneigentum beschlagnahmt; es handelte sich um eben jene Ereignisse, die u. a. Torquato Tasso dazu zwangen, seine Heimat Sorrent zu verlassen (→ Link). Als man zur Förderung der Gegenreformation nach einem geeigneten Ort für die Jesuiten suchte, baute man 1584−1601 das Profananwesen in einen Sakralkomplex um. Nachdem 1688 die Kuppel nach einem Erdbeben eingestürzt war, verpasste man der Kirche ein barockes Kleid, das an Prunk und Protz schwerlich zu übertrumpfen ist. Im Eingangsportal ist das Konterfei des 1987 heiliggesprochenen Wunderdoktors Giuseppe Moscati eingelassen. Der fromme Arzt half u. a. 1906 bei einem Vesuvausbruch den betroffenen Menschen.
Im Zentrum der Piazza Gesù Nuovo steht eine üppig ausstaffierte Mariensäule aus weißem Marmor (Obelisco dell’Immacolata). Das Barockkunstwerk ersetzte Mitte des 18. Jh. ein Reiterstandbild an gleicher Stelle zu Ehren des spanischen Königs Philipp V.
Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco
Im Volksmund heißt der Sakralkomplex an der Via dei Tribunali „Kirche der Totenköpfe“. Und in der Tat zieren die barocken Memento mori nicht nur die Balustrade vor dem Portal. Bis ins letzte Drittel des 20. Jh. hinein war die Unterkirche, das heutige Hypogäum, ein wichtiges Epizentrum des neapolitanischen Totenkults (→ Kasten). Die enge Verflechtung des Sakralbaus mit dem Totenkult wird schon bei der Gründung 1616 durch die Bruderschaft Opera Pia del Purgatorio ad Arco sichtbar: Deren Aufgabe war, bei Begräbnissen mittelloser Menschen finanzielle Hilfe zu leisten. In der Folge fungierte die Kirche als Ort, an dem für die Seelen im Fegefeuer gesorgt wurde. Das Hypogäum unterhalb der barocken Kirche stand dabei symbolhaft für das Purgatorium. Die Besucher werden von einem abgedunkelten Sakralkomplex, in dem eine moderne Installation auf den Totenkult einstimmt, empfangen. Eine Treppe führt von der Oberkirche zum eigentlichen „Friedhof“ darunter. In der Sakristei befindet sich ein bescheidenes Kirchenschatzmuseum.
♦ Jan. bis März tägl. 10−14, Sa bis 17 Uhr, April bis Dez. Mo−Sa 10−18, So bis 14 Uhr. Führungen fakultativ möglich. 6 €, erm. 5 €. Via dei Tribunali 39, www.purgatorioadarco.it.
Sehenswertes in der Neustadt
„Neustadt“ ist nicht ganz zutreffend, denn zu ihr gehören Geschäfts- und Wohnquartiere aus unterschiedlichen Epochen: vom ausgehenden Mittelalter bis zum 20. Jh. Beispielhaft dafür steht das zwischen der Via Toledo und den Abhängen des Vomero-Hügels gelegene Spanische Viertel (Quartieri Spagnoli). Obwohl in der Tat neuzeitlichen Ursprungs, wirkt es aber atmosphärisch wie eine übergangslose Fortsetzung der eigentlichen „Altstadt“ nach Südwesten.
Santa Maria del Purgatorio: Rauminstallation zum Totenkult
Gegründet wurde das Viertel Mitte des 16. Jh. unter der Ägide der spanischen Vizekönige als Heimat der Soldaten von der iberischen Halbinsel. Heute sticht die beeindruckende Höhe der Gebäude ins Auge, und tatsächlich handelt es sich um eines der am dichtesten besiedelten Viertel in der ohnehin unter notorischem Platzmangel leidenden Stadt. Noch immer werden Fremde zuweilen davor gewarnt, diese Gassenschluchten bei Dunkelheit zu betreten, obwohl die Zeiten längst vorbei sind, in denen ein Besuch dieses Viertels gefährlich war. Bewohner aus zweifelhaften Milieus und Zuwanderer aus aller Herren Länder sorgten für eine vergleichsweise hohe Kriminalitätsrate. Allerdings wurde dieser Trend inzwischen gestoppt.
Das Herz der repräsentativen Neustadt ist die Piazza del Plebiscito. Der entfernt an den ungleich berühmteren Petersplatz in Rom erinnernde, 25.000 m2 große Platz erhielt zur Zeit der Franzosenherrschaft sein heutiges Gesicht. Namentlich gemahnt sie an die Volksabstimmung am 21. Oktober 1860, in deren Folge das Königreich beider Sizilien ins vereinigte Königreich Italien inkorporiert wurde. Eingerahmt wird der verkehrsberuhigte Platz von der Basilica San Francesco di Paola auf der einen und vom Palazzo Reale auf der anderen Seite. Nur einen Steinwurf entfernt moderiert ein weiterer wichtiger Kulminationspunkt, die Piazza del Municipio, den Übergang zum Hafenbereich. Auch hier ziehen zwei wuchtige Gebäuderiegel die Blicke auf sich: der Maschio Angioino (Castello Nuovo) mit seinen charakteristischen Rundtürmen und auf der anderen Seite der neoklassizistische Palazzo San Giacomo, der heute das Rathaus beherbergt. In der Epoche der griechischen Besiedelung lag genau an dieser Stelle der Hafen, was mittelbar die seit Jahren existierende Baustelle erklärt: Denn bei Grabungsarbeiten für die Metro entdeckte man Überreste aus der Antike, die sorgfältig zu einem neuen Stadtbahn-Haltestellenmuseum hergerichtet werden. Architektonisch ebenfalls bemerkenswert ist der Hafenterminal aus der Epoche des Faschismus (Stazione Marittima). Der 1934−1936 erbaute Komplex gilt als exzellentes Beispiel für den Italienischen Realismus (razionalismo italiano) und fungiert heute als Entree für Kreuzfahrtgäste, die hier an Land gehen. Neapel zählt heute zu den zehn wichtigsten Kreuzfahrtdestinationen im Mittelmeerraum.
Andere wichtige Plätze sind die Piazza Dante und die Piazza Bellini. Sie liegen nur einen Steinwurf voneinander entfernt und markieren die Schnittstelle zwischen Neu- und Altstadt. Während die Piazza Dante wegen der verkehrsgünstigen Lage ein häufig gewählter Treffpunkt ist, konzentriert sich rund um die Piazza Bellini das Nachtleben.
Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi
Die der hl. Anna geweihte Kirche liegt am Übergang der Altstadt zur Neustadt und gilt als bestes Beispiel toskanischer Renaissance in der Stadt am Golf. 1411 begonnen, fungierte der Sakralkomplex in der Folge als eine Art „Hofkirche“ der Aragonier unter Leitung der Olivetaner (ein benediktinischer Zweigorden). Im Zweiten Weltkrieg wurde der Komplex durch Bomben stark beschädigt. Unter den namhaften Künstlern, die hier ihre Spuren hinterließen, ist v. a. Giorgio Vasari zu nennen, dessen 1550 erschienene „Vite“ (Künstlerbiografien) bis heute als Standardwerk der Kunstgeschichte gelten. In der Sakristei schuf der Maestro 1544 die Wandgemälde. Die schmucken Intarsienarbeiten wiederum stammen von Fra Giovanni da Verona. Sehenswert ist auch das Oratorium mit der Cappella del Compianto aus dem Jahr 1492. Die Skulpturengruppe aus Cartapesta mit Jesus Christus, Maria, Evangelisten und Heiligen stammt von Guido Mazzoni aus Modena. Auch die Seitenkapellen des Hauptschiffs lohnen einen ausführlicheren Blick.
♦ Kirche: Mo−Fr 8.30−19, Sa 9−19, So 9.30−13 und 15−19 Uhr. Kloster und Museum: Tägl. außer So 9.30−18.30 Uhr. 5 €, erm. 3 €. Piazza Monteoliveto.
Stazioni dell’arte
Auf dem Weg von der Piazza Garibaldi zum Nationalmuseum nimmt die Metrolinie 1 nicht direkten Kurs, sondern macht um die Altstadt einen weiten Bogen. Viele Attraktionen der repräsentativen Neustadt sind über die Metrostationen auf diese Weise gut zu erreichen. Ein weiterer Anreiz, der für die Benutzung der U-Bahn spricht, sind die kunstvoll gestalteten Haltestellen. Für das Projekt Stazioni dell’arte gewann die Schirmherrin, die Region Kampanien, seit 2006 namhafte Architekten und Designer. Die Vorgabe lautete, dass die Kunst stets den Kontext zum jeweiligen Stadtviertel suchen muss, in dem sich die Metrohaltestelle befindet. 2012 kürte der britische „Daily Telegraph“ die Station „Toledo“ − zugänglich von der Via Toledo − zur schönsten U-Bahn-Haltestelle Europas. Ebenfalls einen Besuch wert sind die Haltestellen „Università“, „Museo“ und „Materdei“.
Via Toledo: Kunst in der Metro
Palazzo Zevallos Stigliano
Das imposante Barockpalais ließ Mitte des 17. Jh. der spanische Kaufmann Giovanni Zevallos erbauen, der zuvor für das Filetgrundstück die damals beachtliche Summe von 12.500 Dukaten berappen musste. Heute ist das Haus im Besitz des Bankhauses Intesa Sanpaolo, das im Obergeschoss eine Galerie eingerichtet hat. Herausragendes Gemälde unter den Schätzen vom 17. bis frühen 20. Jh. ist das „Martyrium der hl. Ursula“ (Martirio di Sant’Orsola). Es handelt sich mutmaßlich um das letzte Bildnis aus der Hand des Barockmalers Caravaggio. Der Besuch lohnt sich auch wegen der vorbildlich restaurierten Prunksäle. Sehenswert im Erdgeschoss ist zudem der glasüberdachte Innenhof.
♦ Di−Fr 10−19, Sa/So bis 20 Uhr. 3 €, bis 18 J. frei. Via Toledo 185, www.gallerieditalia.com.
Galleria Umberto I
Die Passage zwischen Via Toledo und Teatro San Carlo gehört zum Pflichtprogramm jedes Sightseeing-Programms. Sie entstand 1887−1890 nach dem stilistisch-architektonischen Vorbild der Galleria Vittorio Emanuele II in Mailand. Voraus ging ein 1985 verabschiedetes Stadterneuerungsgesetz, das nach neun Choleraepidemien endlich die unhaltbaren hygienischen Zustände zu eliminieren helfen sollte. In den Innenfassaden sind hin und wieder Symbole der Freimaurer zu erkennen, im Fußboden sind unterhalb der Glaskuppel Mosaike mit Darstellungen der Tierkreiszeichen eingelassen. Managementfehler führten dazu, dass − trotz der ausgezeichneten Lage − einige Geschäfte und Büros in der Passage nicht vermietet sind.
Basilica San Francesco di Paola
Die Fertigstellung der Piazza Plebiscito (→ Link) erlebte Joachim Murat nicht mehr. Dessen Nachfolger und Vorgänger, der Bourbone Ferdinand IV., ließ auf dem planierten Grundstück, auf dem zuvor ein in der Franzosenzeit geschleiftes Kloster gestanden hatte, die Kirche im klassizistischen Stil errichten. 1836 weihte der Papst eigenhändig den Sakralbau ein, der ein wenig an das Pantheon in Rom erinnert. Die monumentale Größe der Kuppel erschließt sich Betrachtern am besten von innen; schlanke Säulen mit korinthischen Kapitellen säumen die Rotunde.
♦ Tägl. 8.30−12 und 16−19 Uhr. Piazza Plebiscito.
Galleria Borbonica
Den Abstieg in den „Bauch Neapels“ bietet nicht nur die Altstadt, sondern auch die Neustadt − und zwar an gleich mehreren Stellen. Hauptsehenswürdigkeit ist ein 430 m langer Fluchttunnel aus bourbonischer Zeit vom Stadtpalast nach Santa Lucia. Er liegt 25 m unter der Erde und sollte ein rasches Entkommen der Könige in der notorisch unruhigen Epoche politischer Umwälzungen ermöglichen. Während des Zweiten Weltkriegs wurden einige Teile des Gangs zu Hallen erweitert, um der Bevölkerung Schutz vor Bomben zu bieten. Als echter Hingucker erweisen sich obendrein ausrangierte Autos und Motorräder aus der Nachkriegszeit. Die betagten Karossen sind über und über mit Staub bedeckt und zeigen, dass die Grotten, bevor sie 2005 wiederentdeckt und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden, als Parkplatz dienten.
♦ Fr−So 10−17 Uhr. Zugänglich im Rahmen einer Führung (ital./engl.) um 10, 12, 15 und 17 Uhr. Reservierungen sind zu empfehlen! Es gibt Führungen unterschiedlicher Länge und Dauer, die an unterschiedlichen Orten beginnen, es lohnt deshalb vorab der Blick auf die Homepage! Ein günstiger Einstieg für die Standard-Tour liegt an der Via Gennaro Serra (5 Min. vom Palazzo Reale, der Weg ist ausgeschildert). 10 €, erm. 5 €, Kombiticket mit San Lorenzo Maggiore (→ Link) 15 €, erm. 10 €. Vico del Grotone, www.galleriaborbonica.com.
Palazzo Reale
Maßgeblicher Architekt der bourbonischen Stadtresidenz war der 1543 im Tessin geborene Renaissancekünstler Domenico Fontana. Zu einem Zeitpunkt, als das Königreich Neapel im Zuge der Unità längst im vereinigten Königreich Italien aufgegangen war, ließ der Savoyer Umberto I. (nach ihm sind der Corso Umberto und die Galleria Umberto benannt) in den Fassadennischen zur Piazza Plebiscito die Königsstatuen aufstellen, auf die örtliche Stadtführer bei ihren Touren gerne hinweisen. Es handelt sich nacheinander um den Normannen Roger II., den Staufer Friedrich II., Karl von Anjou, Alfons V. von Aragon, Karl V., Karl VII., den Franzosen Joachim Murat sowie Vittorio Emanuele II. von Piemont-Savoyen. Die Besichtigung der historischen Säle im 1. Stockwerk lohnt sich v. a. dann, wenn die Zeit für einen Abstecher zum Bourbonenschloss in Caserta nicht ausreicht. Neben den prunkvoll ausgestatteten Gemächern der Beletage ist das 1768 vom florentinischen Architekten Ferdinando Fuga geplante Hoftheater erwähnenswert. Ein weiterer Höhepunkt ist abschließend die königliche Hofkapelle (Cappella Palatina) mit einem wunderbaren Barockaltar aus dem Jahr 1674, in dem u. a. vergoldete Bronze, Achat, Jaspis, Amethyst sowie Lapislazuli verarbeitet sind. Außerdem beherbergt der Palazzo Reale die Nationalbibliothek (Biblioteca Nazionale).
♦ Tägl. außer Mi 9−19 Uhr. 6 €, erm. 4 €. Piazza del Plebiscito 1.
Teatro San Carlo
Das königliche Theater ist eine neapolitanische Institution und zählt zu den Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt. Eine Führung sollte man sich nicht entgehen lassen, denn der Zuschauersaal ist schlicht eine ästhetische Sensation. Lange war das 1735 in der Rekordzeit von nicht einmal sechs Monaten vollendete Opernhaus mit 3300 Plätzen das größte in der Welt. Die Liste namhafter Künstler, die auf diesen Brettern als Komponisten oder Sänger große Erfolge feierten, ist lang: Franco Corelli, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini oder der 1873 aus Neapel gebürtige Enrico Caruso. Unter den legendären Tenören des 18. Jh. mit engelsgleichen Stimmen waren auch einige Kastraten, z. B. Farinelli (eigentlich Carlo Broschi) oder Caffarelli (Gaetano Majorano). Selbst ein Kulturbanause wie König Ferdinand IV. war Stammgast im „San Carlo“, wobei er es allerdings nicht weit in die Loge hatte: Das Bühnenhaus ist nämlich mit dem benachbarten Palazzo Reale (→ Link) verbunden und fungiert architektonisch als Flügel des Stadtschlosses.
♦ Führungen tägl. 10.30−16.30, auf Engl. 11.30 und 15.30 Uhr (ca. 45 Min.). 9 €, erm. 7 €. Via San Carlo 98f, www.teatrosancarlo.it.
Maschio Angioino: Renaissanceportal zwischen mittelalterlichen Türmen
Maschio Angioino (Castel Nuovo)
Das „Neue Schloss“ mit seinen zinnenbewehrten Türmen ist ein Wahrzeichen Neapels und stammt aus dem 13. Jh. Der Grund, warum es als „neu“ bezeichnet wird, liegt an der Existenz des noch etwas älteren Castel dell’Ovo (→ Link). Nachdem Karl I. von Anjou seine Residenz im Anschluss an die Sizilianische Vesper 1282 von Palermo nach Neapel verlegt hatte, suchte er einen standesgemäßen Herrschersitz in der Stadt. Den geeigneten Platz fand er auf der heutigen Piazza Municipio (→ Link) − fast in Sichtweite zu dem Ort, an dem 1268 sein Widersacher Konradin der Staufer unter dem Fallbeil starb. Besondere Beachtung verdient der prächtige Triumphbogen aus Marmor. Das bedeutendste profane Renaissancewerk der Stadt schuf der Bildhauer und Maler Francesco Laurana 1453−1464. Dargestellt wird der triumphale Einzug des Königs Alfons V. von Aragon, der eine Zeitenwende in der politischen Ereignisgeschichte Unteritaliens einläutete. Bis 2006 tagte im Maschio Angioino das Regionalparlament Kampaniens. Der Kauf der Eintrittskarte lohnt sich v. a. wegen des grandiosen Saals der Barone (Sala dei Baroni), der 1330 von Giotto mit Fresken ausgeschmückt wurde, die leider nicht mehr erhalten sind. Doch auch ohne Wandbemalung ist der Blick ins 28 m hohe Deckengewölbe auf jeden Fall sein Eintrittsgeld wert. Giotto soll auch in der benachbarten Cappella Palatina im Stil der französischen Gotik künstlerisch tätig gewesen sein, allerdings zerstörte 1456 ein Erdbeben die Ausstattung vollständig. Nur an den Chorfenstern sind noch wenige Reste der ursprünglichen Bemalung erkennbar.
♦ Tägl. außer So 8.30−18.30 Uhr, im Winter bis 18 Uhr. 6 €, erm. 3 €. Piazza Castello.
Blick von Mergellina auf das Castel dell'Ovo am Abend
Castel dell’Ovo
Die „Ei-Festung“ ist die älteste Befestigungsanlage Neapels und verdankt ihren Namen einer Legende: Der Dichter Vergil, der angeblich in Neapel auf den Hügeln begraben liegt, schenkte einst den Stadtvätern ein Ei. Er prophezeite, dass Neapel solange bestehen bleiben würde, wie dieses Ei unversehrt bliebe. Darauf schichtete man meterhohe Mauern um das kostbare Stück, und siehe da: Über die Jahrhunderte ist die Stadt trotz vieler Katastrophen niemals zerstört worden! Wahrscheinlich diente die Halbinsel aus Tuff mit dem Namen Megaris, auf dem die Festung errichtet wurde, schon zur Zeit der Magna Graecia als Handelsplatz. In der römischen Kaiserzeit wurde sie erstmals befestigt; im hohen Mittelalter residierte hier der Normannenkönig Roger II. Karl von Anjou verlegte im 13. Jh. wiederum seinen Amtssitz ins neu errichtete Castel Nuovo (→ Link). Die heutige Bausubstanz stammt aus aragonesischer Zeit. Im 15. Jh. liegen auch die Ursprünge der kleinen Fischersiedlung unterhalb des Kastells (Borgo Marinai). Wer länger bleibt, sollte hier unbedingt einmal die schmackhaften Fischspezialitäten kosten! Eine Besichtigung des Kastells ist möglich, von den oberen Terrassen eröffnen sich hübsche Blicke auf die Stadt.
♦ Mo−Sa 9−19, So bis 13.30 Uhr, im Sommer werktags abends 1 Std. länger. Eintritt frei.
Villa Comunale (Stadtpark)
Als kleine Oase der Erholung inmitten hektischer Urbanität und breiter Straßenschneisen erweist sich das schmale Parkareal am Lungomare Caracciolo. Im Zentrum der Anlage steht das Gebäude einer der ältesten biologischen Forschungsstationen weltweit. Die Stazione Zoologica wurde 1872 vom deutschen Zoologen Anton Dohrn gegründet, einem Brieffreund Darwins und Erforscher der Phylogenese (stammesgeschichtliche Entwicklung aller Lebewesen). Das Aquarium im Haus kann gegenwärtig nicht besichtigt werden, Informationen unter www.szn.it.
Villa Pignatelli
Einst residierte in der blendend weißen Prachtvilla Ferdinand Dalberg-Acton, Sohn des Marinekommandeurs und Diplomaten britischer Abstammung John Acton. Letzterer stieg unter der Ägide Ferdinands IV. bis zum Finanzminister auf, was eventuell den fast verschwenderischen Prunk der Räumlichkeiten erklärt. Die Vorzeigeimmobilie ging danach durch verschiedene Hände, bis sie 1867 nach Zwangsverkauf an einen Spross der Familie Pignatelli-Cortés überging (ein Vorfahr war Hernán Cortés, der Eroberer Mexikos). Highlight des Rundgangs ist der Salon im neopompejanischen Stil mit halbkreisförmigem Grundriss und farbigen Wandmalereien. Im Nebenhaus befindet sich eine ansehnliche Sammlung von Kutschen, Droschken, Reitpeitschen und Geschirr (Museo delle Carrozze).
♦ Museum: Tägl. außer Di 8.30−17 Uhr. 5 €, erm. 2,50 €. Park: Der Park öffnet auch Di vormittags. 2 €. Via Riviera di Chiaia 200.
Palazzo delle Arti (PAN)
Der gediegene Palazzo im Stadtteil Chiaia war im 17. Jh. die Stadtresidenz des Fürsten Francesco di Sangro aus San Severo. Im einstigen Adelspalais befindet sich heute ein Mehrsparten-Kulturzentrum mit Archiv, Bibliothek sowie hochkarätigen Wechselausstellungen zur modernen Kunst.
♦ Tägl. 9.30−19.30 Uhr. Eintrittspreis abhängig von Wechselausstellungen. Via dei Mille 60.
Pulcinella: neapolitanischer Komiker mit Narrenfreiheit
Die heitere Figur mit der schwarzen Maske und dem weißen Gewand ist aus dem Straßenbild Neapels schwerlich hinwegzudenken. Sie entstammt dem süditalienischen Volkstheater und hat ihren Weg bis zur Commedia dell’arte Norditaliens gefunden. Il pulcinella verkörpert den bauernschlauen Tölpel − um keine witzig-intelligente Antwort verlegen und stets in der Lage, sich aus prekären Situationen herauszumanövrieren. Logisch, dass sich v. a. die Lazzaroni (→ Kasten) mit dem Charakter identifizierten. Aber auch im Marionettentheater im Palazzo Reale brachte der Narr unter johlendem Beifall des Hofstaats seine Späße unter die Leute. 15 km nördlich von Neapel gibt es in Acerra ein Pulcinella-Museum (Informationen im Internet unter www.pulcinellamuseo.it).
Gutbürgerliche Wohngegend zwischen Lungomare und Vomero
Sehenswertes auf den Hügeln
Wer sich auf die Hügel begibt, erlebt auf einen Schlag ein völlig anderes Neapel. Wie unschwer zu erkennen, wohnt hier meistenteils das gehobene Bürgertum. Gepflegte Wohnhäuser sowie Villen mit Gärten bestimmen das Bild, in den Straßen schlägt spürbar ein ruhigerer Takt. Immer wieder fällt der Blick von Aussichtsterrassen über die Stadt und auf den Golf. Die schönsten Rundblicke genießt man vom Parco Virgiliano, vom Castel Sant’Elmo oder von der Certosa San Martino. Die beiden letztgenannten Attraktionen sind relativ bequem vom Stadtzentrum aus mit Standseilbahnen (funicolari) erreichbar (→ Unterwegs in Neapel), während man für die eher abgelegenen Ziele nicht selten längere Fußmärsche in Kauf nehmen oder mit dem öffentlichen Bus fahren muss.
Der Vomero ist der Hügel, den Neapelbesucher in der Regel als Erstes zu Gesicht bekommen. Er wird vom mächtigen Castel Sant’Elmo gekrönt, das wie kaum ein zweites Bauwerk die Silhouette der Stadt prägt. Direkt unterhalb, von unten erst auf den zweiten Blick erkennbar, befindet sich mit der Certosa San Martino eine bedeutende Sehenswürdigkeit, die man keinesfalls verpassen sollte! Der Vomero ist ein eigenständiger Stadtteil und wurde erst im 19. Jh. überbaut. Heute leben hier ca. 50.000 Menschen.
Westlich des Vomero schließt sich der 6 km lange Tuffsteinrücken des Posillipo an. Er verdankt seinen Namen einer Römervilla, die von ihrem Eigentümer elegisch Pausilypon, „Villa Sorgenfrei“, getauft wurde. Wegen der vielen Spuren aus der Antike wurde der „Posillip“ im 18. und 19. Jh. nachgerade zur Chiffre für die Italien- und Antikensehnsucht der prominenten Reisenden der Grand Tour. Ob sich jedoch das viel gepriesene Grab des Vergil (Tomba di Virgilio) tatsächlich hier oben befindet, ist mehr als zweifelhaft. Vom Jachthafen bzw. Regionalbahnhof Mergellina führt eine schmale Zufahrt zur vermeintlichen Ruhestätte des Dichters (Mitte Okt. bis Mitte April tägl. außer Di 10−14.50 Uhr, sonst 9−19 Uhr). Stadtauswärts fällt der Hügel zum Capo Posillipo und zur Insel Nisida am Übergang zum Golf von Pozzuoli ab. Ziemlich weit weg von Neapel wähnt man sich auch im kleinen Fischerdorf Marechiaro mit seinem kleinen Naturhafen sowie einer Handvoll einfacher Restaurants.
In die Gegenrichtung blickt man vom Vomero auf den dritten Stadthügel mit dem ehemals königlichen Jagdschloss Capodimonte. Der Bauboom im 20. Jh. überrollte diesen Hügel und verschlang die bourbonischen Jagdgründe. Einzig der Park hinter dem Schloss zeugt noch vom einstigen Idyll. Heute beherbergt das Schloss die bedeutendste Gemäldegalerie Süditaliens. Zwischen Capodimonte und Vomero breitet sich der faszinierende Bezirk Sanità aus. Nirgends ist Neapel so neapolitanisch wie in diesem vernachlässigten Wohnviertel, das Ortsfremde häufig schon nach kurzer Zeit wie den guten Freund von nebenan willkommen heißt. Wo einst frühchristliche Friedhöfe lagen, schlägt heute das spirituelle Herz Neapels. Mit dem Cimitero delle Fontanelle befindet sich in der Sanità noch heute eine bedeutende Stätte des neapolitanischen Totenkults (→ Kasten). Das atmosphärisch reiche Quartier lag in der Antike außerhalb der griechischen Neapolis und beherbergt überdies einige sehenswerte Katakomben. Sie belegen, dass zu jener Zeit stets die Toten vor den Toren der Stadt bestattet wurden. Dass heute die Attraktionen des Stadtviertels zugänglich sind und sich Ortsfremde hier sicher bewegen können, ist zu einem großen Teil der privaten Stiftung L’Altra Napoli („Das andere Neapel“) Ernesto Albaneses zu verdanken. Der in der Sanità geborene und heute in Rom lebende Impressario setzte sich für die sozial benachteiligten Heranwachsenden ein und gab ihnen in der Tourismusbranche eine Perspektive − das Privatquartier im Kloster an der Basilica di Santa Maria della Sanità (→ Übernachten) ist ebenfalls das Resultat eines Stiftungsprojekts!
Galleria Nazionale Capodimonte
Als König Karl VII. von Bourbon das Kunststück gelang, den Löwenanteil der berühmten Farnesischen Sammlungen zu erben, betraute er 1738 den Architekten Giovanni Medrano mit dem Bau eines Schlosses, das künftig Teile der Sammlung beherbergen sollte. Medrano hatte zuvor bereits an der Errichtung des Teatro San Carlo mitgewirkt. Seit 1957 ist das Schloss Capodimonte ein Museum, das mit ca. 150.000 Besuchern jährlich zu den bedeutenden Attraktionen der Stadt zählt. Die erwähnte Sammlung Farnese nimmt 30 Räume im 1. Obergeschoss ein, zu ihr gehören berühmte Meisterwerke bildender Kunst wie z. B. Giorgio Vasaris „Allegorie der Gerechtigkeit“, Raffaels Porträt des Kardinals Farnese oder Tizians „Danaä“ (weitere Gemälde aus der bekannten Serie des Malers hängen im Prado sowie im Kunsthistorischen Museum Wien). Im gleichen Stockwerk befinden sich zudem die Prunkräume der Beletage mit Lüstern, Antiquitäten sowie zahlreichen historischen Gemälden. Etwas weniger prunkvoll und hochkarätig bestückt nimmt sich das 2. Obergeschoss aus. Die 40 Räume präsentieren Gobelins, Ölgemälde, Altarbilder u. v. m. aus unterschiedlichen Epochen vom Mittelalter bis ins 18. Jh. Sie stammen aus dem Bestand der Galleria Napolitana, der ehemaligen Gemäldesammlung der Bourbonen. Das 3. Obergeschoss wiederum widmet sich Werken zeitgenössischer Kunst. Ein Highlight hier ist u. a. das Pop-Art-Gemälde von Andy Warhol mit dem feuerspeienden Vesuv. Weitere Künstler der Moderne sind Joseph Beuys, Mimmo Paladino, Sigmar Polke und Hermann Nitsch. Dem letztgenannten österreichischen Aktionskünstler und schrillen Provokateur ist übrigens in Neapel noch ein eigenes Museum gewidmet (www.museonitsch.org)!
♦ Tägl. außer Mi 8.30−19.30 (1. Stockwerk), 9.30−17 Uhr (2./3. Stockwerk). 12 €, erm. 6 €, unter 18 J. frei. Via Miano 2 (Stadtbus ab Piazza Dante und mit Hop-On-Hop-Off-Bus von der Piazza Municipio), www.museocapodimonte.beniculturali.it.
Eindrucksvoller Friedhof unter Tage: Die Katakomben des Hl. Januarius
Catacombe San Gennaro
Der Zugang zu dieser beeindruckenden Welt unter Tage befindet sich etwas unterhalb der monumentalen Kuppelbasilika unweit des Schlosses Capodimonte. Im 2. Jh. n. Chr. befand sich hier lediglich die Grabstelle eines römischen Ehepaars. Die Ausweitung des Areals begann im 4. Jh., als hier die sterblichen Reste des sechsten Bischofs von Neapel Agrippinus beigesetzt wurden. Aufgrund diverser kolportierter Wundertaten wurde der Stadtpatron von der Kurie später heiliggesprochen. Als obendrein auch noch die verehrten Knochen des San Gennaro hierher überführt wurden, nahm der Zustrom der Pilger fortwährend zu. Das unterirdische Areal wurde auf zwei Etagen ausgebaut und umfasste nun eine Gesamtfläche von 5000 m2. Der allmähliche Verfall des Höhlenheiligtums begann nach dem Diebstahl der Reliquien des für Neapel so wichtigen Patrons (→ Kasten).
♦ Stdl. Führungen (engl./ital.) Mo−Sa 10−17, So bis 13 Uhr. Kombiticket mit Catacombe San Gaudioso (→ unten) 9 €, erm. ab 5 €. Via Capodimonte 13, www.catacombedinapoli.it.
Cimitero delle Fontanelle
Der nur zu Fuß erreichbare Friedhof im Stadtteil Sanità ist nichts für Zartbesaitete. Die monumentale Grotte aus Tuffstein entpuppt sich als ein Beinhaus aus dem 16. Jh., in dem sich Schädel und Knochen stapeln. Als die verheerende Pestepidemie 1665 über die Hälfte der neapolitanischen Bevölkerung dahinraffte, wurde die Friedhofshöhle aus der Not heraus zum Massengrab. In der Folge ließen eine Hungersnot und eine Choleraepidemie die Zahl der anonym hier Bestatteten weiter anwachsen. Bis ins letzte Drittel des 20. Jh. hinein fungierte der Friedhof als Epizentrum des hiesigen Totenkults (→ Kasten). Zahlreiche Spuren der christlich-heidnischen Frömmigkeit − z. B. geschmückte Holzkästchen mit Schädeln „adoptierter“ Seelen − sind bis heute zu sehen. Der Name Fontanelle verweist im Übrigen auf den einstigen Quellenreichtum der Gegend!
♦ Tägl. 10−17 Uhr. Eintritt frei. Führungen nach telefonischer Vereinbarung über die Kooperative Insolitaguida (kostenpflichtig). Via Fontanelle 80, Tel. 338-9652288, www.cimiterofontanelle.com.
Catacombe San Gaudioso
Der bedeutendste Friedhof Neapels aus frühchristlicher Zeit befindet sich unter der Basilika Santa Maria dell Sanità im Herzen des Viertels Sanità. Angeblich lebte im 5. Jh. n. Chr. der gebürtig aus Nordafrika stammende hl. Gaudiosus in den vermutlich auf griechisch-römische Zeit zurückgehenden Katakomben, wo er nach seinem Tod bestattet wurde. Nachdem die Katakomben im Mittelalter der Vergessenheit anheimgefallen waren, wurden sie im Zuge der Stadtexpansion über die Grenzen der Stadtmauern Neapels hinaus im 16. Jh. wiederentdeckt. Wie der Cimitero delle Fontanelle (→ Link) dienten die Katakomben im Zeitalter diverser Katastrophen später als Massengrab. Nur ein Teil der großen unterirdischen Stadt ist heute im Rahmen einer Führung zugänglich. Der Rundgang beginnt und endet in der auch ohne Katakombenbesuch überaus interessanten Kirche.
♦ Stdl. Führungen (engl./ital.) tägl. 10−13 Uhr. Kombiticket mit Catacombe San Gennaro (→ oben) 9 €, erm. ab 5 €. Piazza Sanità 14, www.catacombedinapoli.it.
Spanische Baukunst in Neapel: der Palazzo Spagnolo
Palazzo Spagnolo
Bester Ausgangspunkt für einen Rundgang durch das Stadtviertel Sanità sind die Piazza Cavour und das Archäologische Nationalmuseum. Das erste Gebäude von Rang, auf das die Tour trifft, ist der „Spanische Palast“ aus dem Jahr 1738 in der Via Vergini 19. Vom frei zugänglichen Hof fällt der Blick auf ein monumentales Doppeltreppenhaus, das für die zivile Barockarchitektur in Neapel typisch ist. Beispiele findet man auch andernorts im Stadtzentrum, doch nirgendwo sonst in solch ästhetischer Vollendung!
Castel Sant’Elmo
Bevor im 14. Jh. Robert von Anjou die Spitze des Vormero-Hügels befestigte, befand sich an dieser Stelle eine Kapelle, die dem hl. Erasmus geweiht war. Der Volksmund wandelte in der Folge den Namen des Heiligen zu Elmo ab. Während der Masaniello-Revolte (→ Geschichte) verschanzte sich hier der Vizekönig und wartete die Niederschlagung des Aufstands ab. Heute bietet die sternförmig angelegte Festung mit ihren Bastionen den vielleicht schönsten Rundblick auf Neapel. Außerdem beherbergt das Kastell das Museo del Napoli Novecento mit Gemälden und Skulpturen unterschiedlicher Stilrichtungen des 20. Jh.
♦ Tägl. 8.30−18.30 (Kastell), tägl. außer Di 9.30−17 Uhr (Museum). 5 €, erm. 2,50 €. Via Tito Angelini 22 (10 Min. von der Funiculare-Bergstation Morghen).
Prachtblick vom Belvedere der Certosa di San Martino
Certosa di San Martino
Einen schönen Ausblick auf Neapel vor dem Hintergrund des Vesuvs bietet sich vom Belvedere der Kartause. Einst, als hier noch Kartäusermönche wohnten, gebührte dieses Privileg dem Prior, heute sind die Panorama-Terrassen allen zugänglich, die am Eingang ein Ticket für das Museo Nazionale di San Martino gelöst haben. Der Komplex aus dem 14. Jh. profitierte vom Schutz durch das benachbarte Kastell (→ oben), erfuhr im Zuge der Gegenreformation ab 1589 eine umfangreiche Generalüberholung und Erweiterung im barocken Geschmack der Zeit und wurde schließlich anlässlich des Heiligen Jahres 2000 grundlegend saniert. Für die Besichtigung der Anlage mit ihren zahlreichen Kunstschätzen sollte man genügend Zeit einplanen. Vom lang gestreckten ersten Hof gelangt man zunächst in die Klosterkirche, die mit Kunstwerken des 17. Jh. prachtvoll dekoriert ist. Für die Anfertigung der Gemälde wurde die damalige Crème de la Crème der Barockmeister betraut (u. a. Battistello Caracciolo und Guido Reni). Vom Parlatorium bzw. von der Sakristei gelangt man anschließend in den weitläufigen Kreuzgang. Das kulturhistorische Museum mit seinen teils hochkarätigen Exponaten − u. a. einer wertvollen Krippenpräsentation − ist wiederum vom ersten Hof erreichbar. Die Museumsräume öffnen sich auf der anderen Seite schließlich zur eingangs erwähnten Aussichtsplattform.
♦ Tägl. außer Mi 8.30−19.30 (letzter Einlass 18.30 Uhr). 6 €, erm. 3 €. Largo San Martino 5 (15 Min. von der Funiculare-Bergstation Morghen).
Grotta di Seiano: antike Ingenieurskunst vom Feinsten
Villa Floridiana (Museo Duca di Martina)
Die Villa im neoklassizistischen Stil auf dem Vomero-Hügel ist von einem englischen Landschaftspark umgeben und blickt auf den Golf von Neapel. Sie beherbergt ein hochkarätig bestücktes Porzellan- und Keramikmuseum. Die rund 200 Exponate stammen aus unterschiedlichen Ländern, eine große Abteilung widmet sich dem Porzellan aus Ostasien. Holzintarsienmöbel und andere Antiquitäten runden den Sammlungsbestand ab.
♦ Park: April bis Okt. tägl. 8.30−19, Nov. bis März 8.30−17 Uhr. Eintritt frei. Museum: Tägl. außer Di 8.30−17 Uhr (letzter Einlass 16.15 Uhr). 4 €, erm. 2 €. Via Cimarosa 77 (10 Min. von den Funiculare-Bergstationen Fuga und Cimarosa).
Parco Archeologico di Posillipo
Die Villa des begüterten Römers Publius Vedius Pollio aus dem 1. Jh. v. Chr. (Villa Pausilypon) gehört trotz der nicht einfachen Erreichbarkeit zu den lohnenswerten Zielen am Posillipo-Hügel. Einen Paukenschlag landet gleich zu Beginn ein 770 m langer Zugangstunnel − die Grotta di Seiano. Er bildet den einzigen Zugang zum antiken Areal, das auf diese Weise entrückt den Golf von Neapel überblickt. Neben Grundmauern von Wohnhäusern sind Reste eines Theaters zu begutachten, das einmal rund 2000 Zuschauer fasste. Nach seinem Tod vererbte der Eigentümer die Villa „Sorgenfrei“ dem Kaiser Augustus. Heute ist der Landschaftspark ein integraler Bestandteil des Parco Sommerso di Gaiola, der die Küste unterhalb der Villa unter gesonderten Schutz stellt. Das Küstenschutzgebiet umfasst auch die Unterwasserfauna und -flora, zudem fand man Spuren römischer Hafenanlagen am Meeresgrund. Ein Besucherzentrum organisiert Bootstouren und Schnorchelexkursionen (→ Aktivitäten).
♦ Zugang im Rahmen einer Führung nach Voranmeldung (1:30 Std.). Di−Fr 12, So 10, 11 und 12 Uhr. 6 €, erm. 3,50 €. Unbedingt den Personalausweis mitbringen! Discesa Coroglio 36 (ANM-Bus C 1 vom Bhf. Campi Flegrei), Tel. 328-5947790, www.gaiola.org.
Città della Scienza
Das verwahrloste Industrierevier am Rand der Bucht von Pozzuoli wäre normalerweise keinerlei Erwähnung wert − gäbe es da nicht das Science Center, das auf die Zielgruppe Familie mit Kindern zugeschnitten ist. Ausstellungen und interaktive Mitmachstationen regen an, über die Themen Meeresbiologie, Klimawandel, Licht, technische Innovationen made in Italy sowie die menschliche Anatomie nachzudenken. Ein Planetarium, Events und ein ohne Ticket zugängliches Café-Restaurant runden das Angebot ab.
♦ Mo−Sa 9−17, So 10−18 Uhr. 10 €, erm. 7 € (Science Center), 5 € (Planetarium). Via Coroglio 57−104 (Bus 607 oder C 1 vom Bhf. Campi Flegrei), www.cittadellascienza.it.
Archäologisches Nationalmuseum
Der wuchtige Palazzo am Rande der Altstadt wurde 1585 vom spanischen Vizekönig als Reiterkaserne geplant und diente in der Folge zunächst als Internat der Universität Neapel (Palazzo degli Studi). Ende des 18. Jh. betrauten die Bourbonen Ferdinando Fuga mit dem Umbau des Gebäudes zum Universalmuseum.
Antikes Medusenhaupt als Mosaik
Heute beherbergt der Palazzo eine der bestbestückten Antikensammlungen der Welt und ist deshalb eine Pflichtanlaufstelle kulturinteressierter Reisender. Wer die Skulpturen, Mosaike und anderen Exponate, die auf einer Fläche von über 12.000 m2 präsentiert werden, in gebotener Tiefe betrachten möchte, sollte für den Besuch einen kompletten Tag einplanen! Der gezeigte Bestand speist sich aus zwei historischen Sammlungen: zum einen der Sammlung Farnese im Erdgeschoss, zum anderen den Funden aus den bekannten Ausgrabungsstätten Pompeji und Herculaneum, die im Obergeschoss präsentiert werden. Beide Etagen sind durch eine doppelläufige Treppenhausempore (Scalone monumentale) miteinander verbunden. Ebenfalls vom Treppenhaus zugänglich ist das Zwischengeschoss mit den römischen Mosaiken. Außerdem befinden sich hier Exponate aus dem sog. Geheimkabinett (Gabinetto segreto): Mosaike, Fresken und Figuren mit erotischen Darstellungen, die überwiegend aus Pompeji stammen.
Sammlung Farnese: Den Sammlungsbestand, der im Kern über 400 antike Skulpturen umfasste, trug die römische Adelsfamilie Farnese seit dem 16. Jh. zusammen. Nach dem Aussterben der männlichen Erblinie fiel ein großer Teil der damals schon weltberühmten Sammlung ans Königreich Neapel, wo sie zunächst im Schloss Capodimonte Aufnahme fand. Dass die Stadt am Golf seit dem 18. Jh. zum Ziel zahlreicher Bildungsreisender wurde, verdankte sie u. a. auch dem exzellenten Ruf der Kunstwerke. Zu den bekanntesten Monumentskulpturen zählen der Farnesische Herkules sowie der Farnesische Stier. Beide stammen aus den Caracalla-Thermen in Rom, wurden Mitte des 16. Jh. bei Ausgrabungen entdeckt und der Farnesischen Sammlung einverleibt. Als Hingucker erweist sich ferner die Statue der Venus Kallipygos, die kokett über die Schulter ihren wohlgeformten Allerwertesten einer eingehenden Betrachtung unterzieht.
Detail aus der Alexanderschlacht im Archäologisches Nationalmuseum
Römische Mosaikabteilung/Gabinetto Segreto: Bevor die besten in Pompeji und Herculaneum zutage geförderten Schätze 1822 nach Neapel wanderten, wurden sie unweit von Herculaneum auf dem königlichen Landsitz in Portici (Reggia di Portici) der staunenden Weltöffentlichkeit präsentiert. Allerdings längst nicht alle, denn die pompejanischen Statuen, Malereien, Mosaiken und diversen Alltagsaccessoires mit eindeutig erotischen sowie obszönen Motiven trieben den gestrengen moralischen Sittenwächtern des 18. und 19. Jh. die Schamesröte ins Gesicht. Betreffende Erotika betrachtete man daher als Verschlusssache und steckte sie ins Geheimkabinett, wo sie ausschließlich jene zu sehen bekamen, deren „sittliche Eignung“ unzweifelhaft war. Inzwischen steht das Kabinett allen Besuchern offen; zu den bekanntesten und meistabgebildeten Darstellungen zählt der Hirtengott Pan, der ungeniert mit einer Ziege kopuliert. Auch die angrenzende Abteilung römischer Mosaike bietet etliche Highlights, u. a. natürlich das großartige Mosaik der Alexanderschlacht (→ Foto, s. oben). Es stammt aus dem Haus des Fauns in Pompeji.
Antikenfunde aus den Großgrabungen (Fresken, Vasen, Bronzen): Das 1. Obergeschoss bietet eine Fülle wertvoller Gegenstände aus griechischer und römischer Zeit, allen voran die Prunkstücke aus der legendären Villa dei Papiri in Herculaneum. Ihre Erforschung seit der Mitte des 18. Jh. löste einen ungeahnten Hype des europäischen Bildungsbürgertums aus, denn etwa 1800 verkohlte Schriftrollen, die man in der Villa fand, riefen die Sehnsucht der Aufklärung wieder wach, endlich einer antiken Bibliothek teilhaftig zu werden. Leider erfüllte sich der Wunsch nicht, die Villa selbst ist mittlerweile nicht mehr zugänglich. Einen Schwerpunkt bilden darüber hinaus römische Fresken, u. a. wunderbare Darstellungen vom Isis-Tempel in Pompeji. Wer dann noch nicht genug hat, widmet sich der antiken Kleinkunst in Vitrinen: hochwertige Keramik, Münzen, ziselierter Silber- und Goldschmuck oder Vasen, deren Außenflächen mit Farbschichten aus Schmuckstein reliefartig verziert sind. Diese Kameo-Technik wird noch heute von Kunsthandwerkern aus Torre del Greco unterhalb des Vesuvs praktiziert (→ Einkaufen).
♦ Tägl. außer Di 9−17.30 Uhr. 15 €, erm. 13 €, unter 18 J. frei. Aufgrund des Andrangs empfiehlt es sich, Eintrittstickets über die Museumshomepage zu reservieren! Piazza Museo 19, www.museoarcheologiconapoli.it.
Giambattista Vico (1668−1744) und die Biblioteca Girolamini
Manchmal ist die Erwähnung einer Sehenswürdigkeit auch dann erhellend, wenn es streng genommen nichts zu besichtigen gibt. In diesem Fall geht es um eine Bibliothek, die zweitälteste Italiens, die sich nur einen Steinwurf weit vom Dom entfernt befindet. Allerdings weist kein Wegweiser auf dieses Kleinod der bibliophilen Kultur hin, das 1586 von Mönchen aus dem Orden der Oratorianer ins Leben gerufen wurde. Den klerikalen Büchersammlern ist es zu verdanken, dass die heiligen Hallen wertvolle Erstdrucke u. a. von Galileo, Kopernikus und Kepler enthalten. Zu den Beständen zählt auch der Nachlass des italienischen Philosophen Benedetto Croce. Ein Grund für die überaus vorbildliche Bestückung der Institution lag v. a. am Engagement des Humanisten Giambattista Vico. Der Verfasser der Scienza Nuova („Prinzipien einer Neuen Wissenschaft über die gemeinsame Natur der Völker“) wohnte praktischerweise gleich nebenan und kümmerte sich mit Verve und Leidenschaft ums Büchermekka.
Im 21. Jh. wurden die hehren Hallen zum Schauplatz eines Schurkenstücks, das am Ende fast nur Verlierer kannte: Der inzwischen verurteilte vormalige Bibliotheksdirektor Marino Massimo De Caro hatte sich nämlich 2011/12 systematisch an den Beständen vergriffen und viele der wertvollen Exponate gewinnbringend verhökert. Pikant war überdies, dass De Caro als Duzfreund und Zögling des Berlusconi-Vertrauten Marcello dell’Utri gilt, dem wiederum gute Verbindungen zum organisierten Verbrechen nachgesagt werden. Die Bibliotheksbestände sind gegenwärtig von der Staatsanwaltschaft konfisziert und können daher nicht besichtigt werden.
Basis-Infos
Information Das Infobüro befindet sich an der Piazza Gesù Nuovo in der Altstadt. Mo−Sa 9.30−17, So bis 13 Uhr. Tel. 081-5512701, www.visitnaples.eu.
Weitere Infopoints gibt es am Airport in der Ankunftshalle, im FS-Bahnhof Napoli Centrale (Nähe Gleis 24), im Maschio Angioino (Castel Nuovo) sowie vor dem Archäologischen Nationalmuseum.
Neapel-App. Praktische Informationen zum Stadtbesuch, einen interaktiven Stadtplan und einen ÖPNV-Verbindungsrechner liefert der „Naples Pass“ (ital./engl.). Die App ist zwar nicht kostenlos, enthält jedoch zahlreiche Ermäßigungen sowie kostenlose Eintritte. Basisversion für 3 Tage 19 €, Luxusversion mit freier Fahrt im städt. ÖPNV und freiem Eintritt in Museen 42 €. Die App gibt es für Android und iOS. Information im Internet unter www.naplespass.eu.
„Gira Napoli“ von Lumilab ist eine nützliche ÖPNV-App für Neapel − für Android, iOS und Windows.
Gepäckaufbewahrung Im Airport (1. OG des Abflugterminals) und im Hauptbahnhof (Napoli centrale).
Ärztliche Versorgung Pronto Soccorso (Krankenwagen/Erste Hilfe): Tel. 118 oder Tel. 081-7528282.
Ospedale Cardarelli. Das Krankenhaus befindet sich außerhalb des Stadtzentrums und ist u. a. mit der Metrolinie 1 erreichbar (Haltestelle Policlinico). Via Antonio Cardarelli 9, Tel. 081-7471111, www.ospedalecardarelli.it.
Anreise
Pkw. Vierspurig ausgebaute Zubringer verbinden die Autobahn A 1 (von/nach Rom) bzw. A 3 (von/nach Salerno) mit dem Stadtzentrum. Die „Tangenziale“ ist die Stadtautobahn (Maut durch Münzeinwurf), die vom Flughafen in westlicher Richtung zu den Phlegräischen Feldern führt.
Flugzeug. Busse und Taxis verbinden den Internationalen Flughafen Capodichino mit dem Zentrum von Neapel (→ Link). Die Metro vom Airport ins Zentrum verkehrt frühestens ab 2022.
Bahn. Die meisten Fernzüge aus Rom oder Reggio di Calabria steuern den Hauptbahnhof Napoli Centrale an (→ Unterwegs in Neapel), einige wenige Regionalzüge halten auch an den Bahnhöfen Mergellina und Montesanto.
Schiff. Kreuzfahrtschiffe legen an der zentralen Stazione Marittima an. Am benachbarten Porto di Massa starten und enden die Autofähren (traghetti) nach Sardinien, Sizilien, Ischia, Procida, Capri und Sorrent. Am Molo Beverello legen Schnellboote (aliscafi) nach Procida, Ischia, Capri und Sorrent an. Auch von Mergellina starten und enden Schnellboote (aliscafi) nach Ischia, Capri und Sorrent. Die Ticketschalter befinden sich an den Anlegestellen.
Unterwegs in Neapel
Infos/Tickets Informationen zum Nahverkehr liefern die Internetseite der Azienda Napoletana Mobilità unter www.anm.it sowie die Gratis-App „Gira Napoli“.
Tickets Sie werden am Schalter oder Automaten gelöst und vor Fahrtantritt entwertet. Die Billets erlauben die Fahrt mit verschiedenen Verkehrsmitteln, z. B. Metrolinie 1, Bus und Funiculare. Für Vorortbahnen und FS-Züge müssen Extratickets gelöst werden. Die einfache Fahrt im Stadtgebiet kostet 1,10 €, ein Tagesticket 3,50 €, das Wochenticket 12,50 €.
Bus/Tram Bus. Das dichte Busnetz ist alles andere als leicht zu durchschauen, in vielen Fällen helfen jedoch die Beschriftungen außen. Wichtige und günstig gelegene Halte- und Umsteigepunkte sind die Piazza Garibaldi (Stazione Centrale) und die Piazza Dante. Eine Übersicht der Buslinien finden Sie im Internet unter www.anm.it.
Capo Posillipo. Die Buslinie 140 verbindet Mergellina mit abgelegenen Zielen an der Küste westlich von Neapel.
Tram. Die Straßenbahnlinie 1 verbindet den Hauptbahnhof mit dem Hafen und dem Teatro San Carlo. Vor Taschendieben wird auf dieser Strecke allerdings gewarnt!
Funiculare Vier Standseilbahnen verbinden die tiefer gelegenen Gefilde mit den Hügeln, allein drei führen auf den Vomero hinauf, die vierte verbindet Mergellina mit dem Posillipo. In mehrfacher Hinsicht verkehrsstrategisch günstig ist die Funiculare Centrale von der Via Toledo auf die Spitze des Vomero-Hügels. Der gewöhnliche ÖPNV-Fahrschein ist auch für die Standseilbahnen gültig.
Metro Linie 1. Es handelt sich bislang um die einzige effizient nutzbare Linie. Sie verbindet die Piazza Garibaldi mit der nördlichen Stadtperipherie und soll frühestens 2022 bis zum Airport weitergeführt werden. Bemerkenswert im Stadtzentrum sind die künstlerisch hochwertig gestalteten Haltestellen (→ Link).
Bahn Napoli Centrale. Am Hauptbahnhof (FS) starten und enden die meisten Fern- und Regionalzüge. Umstieg in die Metro (Linie 1), in die Circumvesuviana (z. B. nach Sorrent) und in die Busse zum Flughafen vom Bahnhofsvorplatz (Piazza Garibaldi).
Regionalbahnhöfe. Einige Regionalzüge (u. a. nach Caserta oder Salerno) halten zudem in den Bahnhöfen Montesanto und Mergellina.
Vorortbahnen Circumvesuviana. Züge in Richtung Vesuv, Pompeji und Sorrent beginnen an der Porta Nolana und halten im Tiefgeschoss des FS-Bahnhofs. Für die meisten Reisenden dürfte die Linie nach Sorrent von Interesse sein, denn auf ihr befinden sich wichtige Ziele wie Ercolano und Pompei.
Circumflegrea. Die Züge verbinden den Regionalbahnhof Montesanto mit Ortschaften im Einzugsbereich der Phlegräischen Felder.
Linea Cumana. Startpunkt der Züge ist ebenfalls der Regionalbahnhof Montesanto, Ziel ist die Gegend rund um Bacoli und Capo Miseno. Günstig gelegene Haltestelle in Pozzuoli in der Nähe des Fährterminals nach Ischia und Procida.
Linie 2. Bei der Linie, die den FS-Bahnhof mit Pozzuoli verbindet, handelt es sich um eine Bahnstrecke, die zwischen Neapel und Pozzuoli zur Metro umdefiniert wurde. Sie wird daher folgerichtig von der staatlichen Eisenbahngesellschaft Trenitalia betrieben. Am Hauptbahnhof fahren die Züge von den tiefer gelegten Gleisen 1 und 4 ab.
Linie 6. Diese Linie befindet sich noch im Bau und soll zukünftig Mergellina mit dem Stadio San Paolo, Spielstätte des SSC Neapel, und in der Gegenrichtung mit der Piazza Municipio (Umstieg zur Linie 1) verbinden. Der Eröffnungstermin stand zum Zeitpunkt der letzten Recherche 2019 noch nicht fest, erfolgt jedoch frühestens 2020.
Pkw Der Verkehr ist gewöhnungsbedürftig und Parkplätze sind chronisch knapp. Daher sollte man das Autofahren in Neapel möglichst vermeiden. Alternative: Das Fahrzeug am Flughafenparkplatz (P 1) abstellen und mit dem Bus (5 €) ins Zentrum fahren.
Parken im Zentrum. Die blau gekennzeichneten Parkplätze sind zumeist gebührenpflichtig (Parkscheinautomaten). Gebührenpflichtiger Zeitraum i. d. R. 8−24 Uhr. 2,50 €/Std. Parkhäuser in Neapel ähneln eher winzigen Parkgaragen, häufiger gibt es sie zwischen Hauptbahnhof (Piazza Garibaldi) und Porta Capuana. Relativ gut vom Lungomare Caracciolo aus erreichbar ist das Parkhaus Quick Morelli. 24 Std. offen, 4−5 €/Std. (Via Domenico Morelli 40, www.quickparking.it).
Taxi Tel. 081-8888, www.taxinapoli.it. Preise nach Taxameter, Aufschläge für Fahrten in der Nacht und großes Gepäck. Taxistände befinden sich u. a. am Airport, am FS-Bahnhof (Piazza Garibaldi), an der Piazza Dante und am Castel dell’Ovo.
Mietfahrzeuge Pkw. Um den Stadtverkehr zu vermeiden, sind die Autovermietungen am Flughafen vorzuziehen (→ Link). Die Counter der einschlägigen Verleihfirmen befinden sich aus Platzgründen nicht in der Ankunftshalle, sondern außerhalb (10 Min. Fußweg, kostenloser Shuttlebus).
Fahrräder. E-Bikes für 5 €/Std. oder 20 € am Tag verleiht die Firma Neapoli Solare in der Nähe der Piazza del Gesù Nuovo. Auch geführte Stadttouren mit dem Fahrrad. Via Domenico Capitelli 31, Tel. 081-0127430, www.neapolisolare.it.
Aktivitäten
Fahrrad Der einzige ausgewiesene Radweg in Neapel führt am Lungomare entlang und verbindet die Piazza del Plebiscito mit dem Hafen Mergellina. Wer möchte, kann oberhalb der Küste zum Fischerdorf Marechiaro oder zum Parco Virgiliano weiterradeln (→ Mietfahrzeuge, oben).
Biketour Naples. Das junge Unternehmen organisiert Stadttouren sowie Ausflüge an die Küste westlich von Neapel mit dem Drahtesel. Auch Kajak-Touren entlang der Küste unterhalb des Posillipo-Stadthügels. Tel. 335-1525480, www.biketournapoli.com.
Sightseeing Hop On-Hop Off. Die offenen roten Busse fahren das ganze Jahr über auf zwei Linien durch die Stadt, man kann für eine Besichtigung aussteigen und danach mit dem nächsten Bus weiterfahren. Auch Shuttlebusse nach Caserta und Pompeji. Zentrale Abfahrtsstelle am Teatro San Carlo. 23 €, erm. 11,50 €. Das Ticket ist 24 Std. gültig. Tel. 335-7803812, www.napoli.city-sightseeing.it.
Sprachschule Centro Italiano. Die renommierte Sprachschule hat ihren Sitz in der Nähe der Universität. Italienischkurse für alle Leistungsstufen, auch Business-Italienisch und verschiedene kulturelle Aktivitäten. Vermittlung von Quartieren für Studierende. Vicolo Santa Maria dell' Aiuto 17, Tel. 081-5524331, www.centroitaliano.it.
Wassersport Parco Sommerso di Gaiola. Nicht weit von der Villa Pausilypon (→ Link) bietet das Besucherzentrum des Unterwasser-Küstenschutzgebietes Bootstouren an. Der Glasboden erlaubt einen Blick auf die Küstenflora und -fauna und auf die archäologischen Relikte am Meeresboden. Wer einen Tauchschein besitzt, kann zudem Tauchgänge unternehmen, auch Schnorcheln ist im Angebot. Interessenten melden sich im Centro Visite. Besser vorher anrufen! April bis Sept. tägl. 10−16 Uhr, Okt. tägl. außer Mo 10−14 Uhr, Nov. bis März Di, Do und Sa 10−14 Uhr. Discesa Gaiola (keine Zufahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln), Tel. 081-2403235, www.areamarinaprotettagaiola.it.
Einkaufen
Einkaufsstraßen Die Via San Gregorio Armeno ist das Bermudadreieck der Krippenkunst (→ Link). In der Via Santa Maria di Costantinopoli wiederum sind Restauratoren und Antiquare zu Hause. Bücher kauft man am besten in der Via Port’Alba oder an der Piazza Dante. Die Via Toledo und das Viertel Chiaia eignen sich ebenfalls für eine Shoppingtour. Gediegen geht es auf der Via Chiaia zwischen Via Toledo und dem Rione Chiaia zu. Im Viertel Chiaia wiederum sind die einschlägigen internationalen Marken vertreten. Schick präsentiert sich die Via Carlo Poerio nebst Querstraßen − mit edlen Boutiquen, Galerien und Antiquitätengeschäften.
Besondere Gechäfte Feltrinelli. Größte Buchhandlung der Stadt und in ganz Italien vertretene Kette. Auch Musik, wenige Wanderkarten sowie fremdsprachige Literatur. Im gemütlichen Lesecafé werden kleine Snacks serviert. Mo-Fr 9−21 Uhr, Sa bis 22, So 10−14 und 16−22 Uhr. Via Santa Caterina (Via Chiaia 23), Tel. 029-194 7777, www.lafeltrinelli.it.
Gerolomini Gallery. Das Zentrum des seit der Antike praktizierten Kameo-Kunsthandwerks (→ Link) befindet sich zwischen Dom und Krippengasse (ein weiteres Kameo-Geschäft liegt auf dem Vomero-Hügel Nähe Castel Sant’Elmo). Bildschöne und auch erschwingliche Schmuckstücke, der Herstellungsprozess wird auf Nachfrage erläutert. Via Tribunali 116, Tel. 081-0332576, www.gerolominigallery.it.
Einkaufstempel: Galleria Umberto I
Libreria Neapolis. Die winzige, edel bestückte Buchhandlung von Annamaria Cirillo ist eine Institution in Neapel. Ausnahmsweise befindet sie sich nicht in der Büchergasse, sondern in der Krippengasse. Via San Gregorio Armeno 4, Tel. 081-5514337, www.librerianeapolis.it.
Giuseppe e Marco Ferrigno. Hinter dem Familiennamen steckt eine ganze Dynastie von Krippenbaumeistern, eine echte Institution in Neapels berühmter Krippengasse (seit 1836). Im bunt dekorierten Geschäft befindet sich auch ein kleiner Vorführtisch. Via San Gregorio Armeno 8, Tel. 081-5523148, www.arteferrigno.com.
M. Cilento & Fratello. Die Familienschneiderei (seit 1780) war schon in bourbonischer Zeit ein angesehener Betrieb. Heute präsentiert sich die Boutique beinahe schon als Museum. Die Kernkompetenz sind edle, handgenähte Krawatten, es gibt jedoch auch Handtaschen, Ledergürtel, Regenschirme und Schuhe. Riviera di Chiaia 203 (neben der Villa Pignatelli), Tel. 081-5513363, www.cilento1780.it.
Wochenmärkte Mercato di Porta Nolana. Der Umgangston ist rau, der Besuch dennoch ein Erlebnis: Meeresfrüchte satt, Obst und Gemüse, auch Kleidung und Tonträger. Hinter der Porta Nolana. Mo−Sa 8−18, So bis 14 Uhr.
Mercato Borgo Sant’Antonio Abate. Einer der traditionsreichsten Straßenmärkte Neapels findet tägl. auf der 800 m langen Via Sant’Antonio Abate nördlich der Piazza Garibaldi statt. Unersprießliche Umgebung, herbe Freundlichkeit, gemischtes Sortiment.
Mercato Rione Sanità. Stimmungsvoll und mit reichlich Lokalkolorit präsentiert sich der tägl. stattfindende gemischte Markt zwischen der Metrostation Piazza Cavour und dem Palazzo Spagnolo an der Via Fuori Porta San Gennaro.
Königsloge im Teatro San Carlo
Veranstaltungen
Information Über aktuelle Veranstaltungen informieren Tageszeitungen und das Internet unter www.napolidavivere.it oder www.napolitoday.it/eventi. Tickets sind u. a. in der Feltrinelli-Buchhandlung (→ Einkaufen) oder online unter www.azzurroservice.net erhältlich. Das Magazin „Qui Napoli“ enthält ebenfalls Veranstaltungstipps, dazu weitere Infos wie Öffnungszeiten, Metro- und Schiffsfahrpläne (www.inaples.it).
Feste & Festivals Maggio dei Monumenti. Das größte kulturelle Festival bietet Veranstaltungen und Events − mit Konzerten, Lesungen und Führungen. Das Motto wechselt jährlich, einige Sehenswürdigkeiten sind kostenlos zugänglich. Ende April bis Anfang Juni. www.comune.napoli.it.
Napoli Pizza Village. Für eine Woche verwandelt sich der Lungomare Caracciolo in ein großes Pizzadorf. Es handelt sich um eines der größten Volksfeste Süditaliens: Pizzabäcker aus vielen Ländern zeigen auf 30.000 m2 ihre Künste, erwartet werden ca. 1 Mio. Besucher, Konzerte, Ausstellungen und Pizza-Backkurse runden das Programm ab. Mitte Juni. www.pizzavillage.it.
Patronatsfest San Gennaro. Das wichtige Blutwunderereignis (→ Kasten) des neapolitanischen Patrons San Gennaro wird in der ganzen Stadt enthusiastisch gefeiert. 19. Sept.
Notte Bianca. Festlich beleuchtete Gassen und Häuser, Geschäfte haben bis zum frühen Morgen geöffnet, obendrein treten Musiker und Straßenkünstler auf. Jedes Stadtviertel hat seine eigene „Weiße Nacht“, z. B. Vomero (Ende Okt.) oder Sanità (Mitte Dez.).
Silvester. Großes Festival auf der Piazza del Plebiscito mit Feuerwerk; Konzerte und Partys auf der angrenzenden Via Caracciolo. 31. Dez.
Bühnen Teatro San Carlo. Das wichtigste Opernhaus Süditaliens (→ Link) ist ein Muss für alle Kulturinteressierten. Opern- und Konzertkarten sind, je nach Vorstellungslänge, ab ca. 25 € zu haben. Ticketoffice: Mo−Sa 10−21, So 10−18 Uhr. Via San Carlo 98f, Tel. 081-7972331, www.teatrosancarlo.it.
Teatro Bellini. Die populäre Bühne zwischen Piazza Dante und Nationalmuseum steht stellvertretend für die rund 20 Theater Neapels. Ticketoffice: Mo−Fr 10.30−13.30, Sa 10.30−13 Uhr. Via Conte di Ruvo 14, Tel. 081-5499688, www.teatrobellini.it.
ÜbernachtenKarte
Empfehlenswerte Unterkünfte in Nähe des Hauptbahnhofs sind rar gesät. Wer indes mit öffentlichen Verkehrsmitteln Abstecher ins Hinterland oder an die Golfküste unternimmt, wohnt andererseits hier logistisch überaus günstig. Bei Altstadtquartieren sollte man sich ggf. bei der Buchung nach einer Parkmöglichkeit erkundigen. Ein Campingplatz befindet sich in Pozzuoli (→ Link).
***** Grand Hotel Vesuvio 28 Renommiertes Traditionshotel an der Küstenpromenade gegenüber Castel dell’Ovo, zahlreiche Hollywoodgrößen nächtigten hier. Auch Enrico Caruso war ein regelmäßiger Gast, nach dem weltberühmten Tenor ist das Gourmetrestaurant benannt. 160 Zimmer und 21 Suiten, Innenpool, Dachgarten mit Aussichtsterrasse. DZ ab 290 €. Via Partenope 45, Tel. 081-7640044, www.vesuvio.it.
**** Palazzo Caracciolo 5 Komforthotel in einem Palazzo mit arkadengesäumtem Hof zwischen Hauptbahnhof und Nationalmuseum. 159 Zimmer, die ruhigeren liegen zum Hof. Restaurant mit mediterraner Küche, Bar, Hotelparkplatz gegen Aufpreis. DZ ab 160 €. Via Carbonara 112, Tel. 081-0160111, www.sofitel.com.
**** Hotel Una 7 Repräsentatives Stadthotel in einem Palazzo an der Piazza Garibaldi, innen überwiegt hochwertiges modernes Design mit frischen Farben. Die Hotelkette betreibt Häuser in 14 weiteren italienischen Städten. 89 komfortable Zimmer, Restaurant, Bar und Aussichtsterrasse. DZ ab 145 €. Piazza Giuseppe Garibaldi 9/10, Tel. 081-5636901, www.gruppouna.it.
Mein Tipp *** Hotel Piazza Bellini 10 Modernes, freches Design im historischen Ambiente, obendrein perfekt gelegen, ruhig und von jungen Inhabern außergewöhnlich gut geführt. Quartier in der oberen Mittelklasse, 48 Zimmer. Kein Restaurant, aber mit genügend Ausgehoptionen in der Nachbarschaft. Standard-DZ ohne Balkon ab 100 €. Via S. M. di Costantinopoli 101, Tel. 081-451732, www.hotelpiazzabellini.com.
*** Hotel Toledo 18 Günstig im Spanischen Viertel gelegenes Hotel in einem Palazzo aus dem 18. Jh. Ruhige Seitengasse, 19 wohnliche Zimmer, ständig besetzte Rezeption, bei gutem Wetter wird auf der bepflanzten Dachterrasse gefrühstückt. Kein Restaurant. DZ ab 95 €. Via Montecalvario 15, Tel. 081-406800, www.hoteltoledo.com.
*** Hotel La Stazione 6 Ordentliches Logis in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof. Junge Betreiber, minimalistisches Hotelkonzept ohne Frühstück, 20 blitzsaubere Zimmer in der 1. Etage, zugänglich vom Hinterhof, teils mit kleinem Balkon. Idealer Standort für einen Kurzbesuch! DZ ab 90 €. Piazza Garibaldi 60, Tel. 081-19005517, hotellastazione@libero.it, Reservierung über die gängigen Buchungsportale.
B&B Piazza Dante 13 Familiäre, gut geführte Privatunterkunft in Toplage direkt an der Piazza Dante. 4 Zimmer, 2 nach vorne raus zur Piazza − hell, allerdings nicht unbeeinträchtigt vom Verkehrslärm. Überdurchschnittliches Frühstück mit vielen hausgemachten Spezialitäten. DZ ab 75 €. Vico Mastellone 16, Tel. 081-0153543, www.bbdante.it.
B&B Casa del Monacone 2 Die schön gestaltete Privatunterkunft befindet sich im ehemaligen Kloster neben der Basilica S. Maria della Sanità im Herzen des gleichnamigen Stadtteils und wird von der Cooperativa La Paranza betrieben, die die Führungen in den Katakomben koordiniert. 6 geräumige Zimmer im 2. Stock, ausgestattet mit Antikmöbeln und moderner Kunst, Terrasse, Blick auf den Kreuzgang. DZ ab 73 €. Via Sanità 124, Tel. 081-7443714, www.casadelmonacone.it.
Hostel of the Sun 19 Ausgezeichnet geführte Privatherberge in Hafennähe, junges Publikum, gesellige Atmosphäre. Doppel- und Mehrbettzimmer in den beiden obersten Etagen teilen sich gemeinsame Bäder, einige Doppelzimmer mit privatem Bad. Frische Farben, angenehmes Ambiente. Platz im Mehrbettzimmer ab 20 €, DZ ab 60 €. Via G. Melisurgo 15, Tel. 081-4206393, www.hostelnapoli.com.
BenBo (Bed’n Boarding) 1 Auf den ersten Blick krudes Übernachtungskonzept direkt am Airport. Winzige Schlafkapseln mit einer Liege, Gemeinschaftsbäder, die Rezeption ist durchgängig besetzt. Modern gestaltet und sauber, ideal für eine späte Ankunft am Flughafen oder bei einem frühen Rückflug. Schlafkapsel 35 €. Viale F. Ruffo di Calabria, Tel. 081-19730800, www.bednboarding.com.
Essen & TrinkenKarte
Zi Teresa 29 Alteingesessenes Restaurant mit Pizzeria am Borgo Marinai. Fein eingedeckte Tische am stimmungsvollen Hafen, köstliche Früchte des Meeres in allerlei Varianten, Beilagen- und Nachtisch vom Büfett, knusprige Pizza aus dem Holzofen. Menü ab 45 €, Pizza ab 8 €. Mo Ruhetag. Via Borgo Marinari 1, Tel. 081-7642565, www.ziteresa.it.
Osteria Da Carmela 9 Ganz in der Nähe der Piazza Bellini kann man den Köchen durch die Glasscheibe bei der Arbeit zuschauen. Lokaltypische Küche mit Niveau, der Schwerpunkt liegt auf der Cucina di Mare. Appetitliche Vorspeisen, leckere Dolci, fein gedeckte Tische. Menü um 40 €. So abends geschlossen (außer Mai und Dez.). Via Conte di Ruvo 12, Tel. 081-5499738, www.osteriadacarmela.it.
Taverna dell’Arte 17 Kultivierte Einkehr (wie der Name nicht anders vermuten lässt) im Studentenviertel. Gesamtitalienische Küche mit dezenten internationalen Anleihen, höflicher Service, geschmackvolles Interieur. Menü um 35 €. Tägl. außer So ab 19 Uhr. Rampe San Giovanni Maggiore 1a (etwas versteckt), Tel. 081-5527558, www.tavernadellarte.it.
Mein Tipp Antichi Sapori Partenopei 25 Auf neapolitanische Küche spezialisiertes Restaurant, erlesene Cucina di Mare e Terra. Wohnzimmeratmosphäre, nur wenige Tische drinnen und auf dem Trottoir. Freundlicher und verbindlicher Service, hier stimmt einfach alles! Ausgezeichnete Weinauswahl. Menü ab 30 €. Tägl. mittags und abends geöffnet. Via Chiaia 124, Tel. 081-0383493.
A’ Cucina Ra Casa Mia 22 Urgemütliche Trattoria in der Nähe der Piazza Plebiscito bzw. am Übergang zum Spanischen Viertel. Ruhige Seitengasse, zünftige Ausstattung, traditionelle neapolitanische Küche (Fisch- und Fleischgerichte). Menü um 30 €. Di zu. Via Carlo de Cesare 14, Tel. 081-4976297, www.acucinaracasamia.it.
Cantina del Gallo 3 Typisch neapolitanische Nachbarschafts-Trattoria im Stadtteil Sanità mit relaxtem Service, nichts für Italienanfänger! Pizzaofen brennt bereits am Mittag, Antipasti mit viel Frittiertem, Makkaroni mit Bohnen aus dem Ofen, nur Innenplätze. Menü um 20 €, Pizza um 5 €. Tägl. geöffnet. Via A. Telesino 21 (auf dem Weg zum Cimitero Fontanelle), Tel. 081-5441521, www.cantinadelgallo.com.
Locanda dei Borboni 20 Bodenständiges und familiäres Lokal im Spanischen Viertel. Rustikal gestalteter Innenraum mit wenigen Tischen, die Außenplätze in der Gasse sind wegen der Mopeds weniger zu empfehlen. Typische neapolitanische Küche, auf der Speisekarte überwiegen Fischgerichte. Am Abend kommen ab und an Straßenmusiker vorbei. Menü um 25 €. Tägl. mittags und abends geöffnet. Vico Lungo del Gelso 42, Tel. 081-0480861.
Tandem 14 Ragù lieben die Neapolitaner fast noch mehr als Pizza, weshalb sich das Altstadtlokal über mangelnden Zuspruch nicht zu beklagen braucht. Kredenzt wird Pasta mit Soße in allerlei Varianten, auch Weinbar, nur wenige Tische innen und draußen. Ragù ab 8 €, Menü um 20 €. Tägl. außer Mo mittags und abends (für den Abend besser reservieren). Mehrere Standorte, u. a. Via Paladino 51 (Tel. 081-19002468) oder Piazza del Gesù Nuovo (Tel. 081-19133823), www.tandem.napoli.it.
Brandi 23 Es handelt sich um die Traditionspizzeria schlechthin! 1780 ist erstmals eine Pizzeria an diesem Ort aktenkundig, 1889 kreierte man hier die Pizza Margherita! Eine Tafel an der Gasse weist auf das bewegende kulinarische Momentum hin. Ein freundlicher Promitreff, alles was Rang und Namen hat, kehrte hier ein. Mo und Di mittags zu, sonst mittags und abends geöffnet. Salita S. Anna di Palazzo 1/2, Tel. 081-18087926, www.brandi.it.
Di Matteo 8 Traditionspizzeria der einfachen Art: volkstümlich, lokaltypisch, und die Pizzas sind sehr lecker! Wenige Tische im Hinterzimmer, weitere Sitzplätze im Obergeschoss. Nichts für einen längeren Aufenthalt! Auch Pizza außer Haus. Pizza 4−7 €. So Ruhetag. Via Tribunali 96, Tel. 081-455262, www.pizzeriadimatteo.com.
O’ Scugnizzo 4 Alteingesessenes Pastalokal mit angeschlossener Pizzeria (seit 1949), wenige Schritte vom Hauptbahnhof entfernt. Volkstümlich, bodenständig, typisch neapolitanisch, kommunikativ. Hausgemachte mediterrane Gerichte, alles kommt frisch auf den Tisch, wenige Freiplätze auf der Veranda. Menü ab 15 €, Pizza ab 4,50 €. So Ruhetag. Corso Novara 15−19, Tel. 081-206867.
La Vela 30 Das authentische Fischlokal befindet sich im abgelegenen Fischerdorf Marechiaro (→ Link) und ist ausnahmsweise nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der Seniorchef verbrachte 3 Jahre in Nürnberg. Schmackhafte Fischgerichte, bodenständiges Ambiente, Hafenblick von der verglasten Veranda. Menü 30−35 €. Tägl. ab 12 Uhr geöffnet. Calata Ponticello di Marechiaro, Tel. 081-5751095.
Cafés/NachtlebenKarte
Die erste Anlaufstelle für Nachtschwärmer ist die Piazza Bellini in der Altstadt. Ein weiteres Bermudadreieck ist der Rione Chiaia hinter der Piazza dei Martiri. Rund um die Via Belledonne lockt die Konzeptgastronomie ein junges, betuchtes Publikum an. Studentisch geprägte Szenekneipen befinden sich zwischen der Piazza Bovio und dem Spaccanapoli.
Bar Nilo 12 Grundsolide Kaffeebar am Spaccanapoli gegenüber der Nil-Skulptur. Wenige Tische, WC außerhalb, brühheißer Kaffee. Das Besondere ist der Maradona-Altar mit Anspielung an die „Hand Gottes“. Der geniale Argentinier spielte jahrelang für den Fußballclub SSC Neapel. Tägl. ab 7.30 Uhr geöffnet, So ab 16.30 Uhr zu. Via San Biagio dei Librai 130, Tel. 081-5517029.
Gambrinus 24 Das bekannteste Kaffeehaus Neapels mit Traumlage an der Piazza Plebiscito ist die ultimative Antwort der Golfmetropole auf die Kaffeehauskultur Wiens. Das fürstliche Ambiente schuf 1890 der Architekt Antonio Curri; Gemälde, Skulpturen sowie Accessoires lieferten namhafte Künstler − alles in allem ein wunderbares Museum des Fin de Siècle. Auch feine Konditorei, das Ambiente bezahlt der Gast, der Espresso kostet 3,50 €! Tägl. ab 7 Uhr bis in die Nacht hinein. Via Chiaia 1, Tel. 081-417582, www.grancaffegambrinus.com.
Liquid Spirit 15 Die gediegene Wein- und Cocktailbar versteckt sich ein wenig in der 2. Reihe hinter dem Spaccanapoli. Hübsche Sitzplätze im Untergeschoss zwischen restaurierten Mauern aus griechischer und römischer Zeit. Am Wochenende Konzerte (Jazzmusik). Via Pallonetto (Via Santa Chiara 14b), Tel. 081-19506951, www.liquidspirit.it.
Das „Gambrinus“ ist das Vorzeige-Kaffeehaus Neapels
Intramoenia 11 Nettes und kultiviertes Lesecafé an der Piazza Bellini, beliebter Treff für einen Aperitif. Tische und Stühle auf der Piazza, haufenweise Grünpflanzen sorgen drinnen für Wintergartenatmosphäre. Bruschette und andere Snacks setzen keine Maßstäbe, jedoch leckerer hausgemachter Kuchen. Tägl. 10−2 Uhr. Piazza Bellini 70, Tel.081-451652, www.intramoenia.it.
Enoteca Belledonne 27 Volkstümliches Weinlokal, Tapasbar und Ristorante mitten im Ausgehbezirk Chiaia. Große Auswahl kampanischer und gesamtitalienischer Weine, Biere, italienisch-spanisch-mediterrane Küche im gemütlichen Nebenraum. Snacks (7−10 €) sowie vollwertige Gerichte (um 15 €). Mo ab 16.30 Uhr, Di−Sa mittags und abends geöffnet, So ab 19 Uhr. Via Belledonne a Chiaia 18, Tel. 081-403162, www.enotecabelledonne.it.
Gran Caffè Cimmino 26 Klassische italienische Kaffeebar in Chiaia, beliebter Vorabendtreff mit Sitzplätzen im Zeltpavillon in der Gasse. Verführerische Süßwarentheke, auch leckeres Eis. Tägl. 7−24 Uhr. Via Gaetano Filangieri 13, Tel. 081-418303.
Pasticcerie/Gelaterie Gay Odin 16 Die Traditions-Schokoladenmanufaktur (seit 1800) ist in der Stadt mit mehreren Filialen vertreten, u. a. am Spaccanapoli sowie am Ausgang der Galleria Umberto zur Via Toledo mit leckerem Eis. Qualität garantiert, auch wenn es etwas teurer ist! Tägl. 9.30−20, So ab 10 Uhr. Via Benedetto Croce 61 (Spaccanapoli), Tel. 081-5510794, www.gay-odin.it.
La Sfogliatella Mary 21 Ein guter Platz, um unkompliziert die neapolitanischen Sfogliatelle zu probieren. Ideale Lage am Ausgang der Galleria Umberto I zur Via Toledo, keine Sitzplätze. Tägl. 8−20.30 Uhr. Galleria Umberto I 66, Tel. 081-402218.
Chalet Ciro 31 Am Hafen von Mergellina verabredet sich vorzugsweise ein junges Publikum zum Eisessen und genießt dabei den abendlichen Prachtblick auf Castel dell’Ovo vor dem Hintergrund des Vesuvs. Hochwertiges Speiseeis, eine Spezialität ist Eiskonfekt in vielerlei Varianten, auch Pasticceria und kleine Snacks. Tische und Stühle draußen. Tägl. ab 7 Uhr bis tief in die Nacht hinein. Via Caracciolo, Tel. 081-669928.