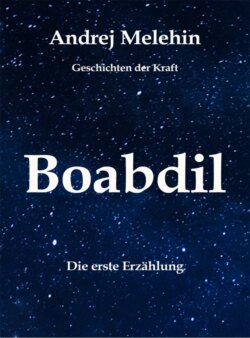Читать книгу Boabdil - Andrej Melehin - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDer dritte Tag
Morgen
Das Licht im Tunnel breitete sich aus und mein Gefühl für den Körper kam langsam zurück, begleitet von einem Schmerz, der mich zu einem Schrei zwang und dann in lautes Heulen überging. Ich schrie nach meiner Mutter, betete, dass sie käme. Nichts außer einem Echo antwortete mir. Weder meine Mutter, die mehr als fünftausend Kilometer entfernt lebte, noch sonst jemand würde mich hier hören. Berge sind Orte der Einsamkeit und Stille. Hier kann man sich nur auf sich selbst verlassen und hält – auch um seine Kräfte zu sparen – lieber den Mund. Ich untersuchte meine rechte Körperseite mit keinem guten Ergebnis. Ich konnte weder meine Hand noch das Bein bewegen. Jeder Versuch endete mit kalten Schweißperlen auf meiner Stirn. „Verdammt“, dachte ich, „Verdammt.“
Die Situation war ernst. Mein Pferd, ein Hengst, den ich gerade erst erworben hatte, war mitsamt allen Vorräten verschwunden. Ich lag mit gebrochenen Knochen irgendwo in den Dreitausendern. Aufgewacht war ich in einer Spalte zwischen großen Gesteinsplatten, wo mein Fuß noch immer eingeklemmt war. Stück für Stück wurde mir das Geschehen wieder bewusst: Der Steinschlag auf einem der vielen Felsen, der meinen Boabdil erschreckt hatte. Der Seilknoten, der eigentlich nichts auf meinem kleinen Finger zu suchen hatte. Es geschah alles ganz schnell. Ich verfing mich mit der Leine an einem Pferd, das in vollem Galopp durch die zerklüftete und wilde Landschaft zu flüchten versuchte. Zuerst blieb ich mit meinem rechten Handgelenk irgendwo hängen, danach mit meinem Fuß. Zweimal hörte ich es deutlich knacken. Als Letztes sah ich noch, wie der Knoten sich löste. Dann wurde es dunkel.
„Zum Glück ist der Finger nicht abgerissen“, dachte ich. Allerdings konnte ich bis auf den Knochen sehen, dort, wo Haut und Fleisch durchgescheuert waren. Heftiger Schmerz erfüllte mich. Mein Körper bestand nur noch aus abertausend brennenden, gespannten Fäden. Die kleinste Bewegung wurde unerträglich. Mühsam zog ich meine Glieder aus der Spalte und legte mich zwischen die Steine. Sie hatten scharfe Kanten und unterschiedene Muster, die ich auf diese Entfernung gut erkennen konnte. Und ich hatte Zeit, unendlich viel Zeit, dazuliegen und nachzudenken. Ich schloss meine Augen und ließ mich fallen. Jetzt hatte ich keine Eile mehr, irgendwo hinzugelangen. Dieser Seilknoten, der nur für einen Augenblick auf meiner Hand ruhte, während ich den Proviant am Sattel befestigte, hatte mich aus meinen Plänen gerissen. Vielleicht sogar aus meinem ganzen Leben. In den unwegsamen Weiten eines Hochgebirges braucht es nicht viel, um zu sterben. Schon eine kleine Unachtsamkeit kann den sicheren Tod bedeuten.
Und so lag ich da und sah vor mir das Gesicht eines Freundes, mit dem zusammen ich auf einem Trakehner-Gestüt unweit von Eckern-förde in Schleswig-Holstein gearbeitet hatte. „Lass nie einen Knoten oder eine Schlinge auf deinen Händen. Nie!“, hatte er damals zu mir gesagt. Jahrelang hatte ich seinen Rat getreu befolgt. Aber dieses eine Mal machte ich eine unerklärliche und folgenschwere Ausnahme. „Das ist nur für einen Moment“, dachte ich, als ich den Knoten um meinen Finger sah. Genau da polterten die Steine herunter und mein Pferd ging durch. Zu spät. Die unwiderrufliche Erkenntnis saß so tief, dass meine Seele und die Schmerzen auf seltsame Weise zur Ruhe kamen.
Ich lag still und schaute auf die Welt der Ameisen unter mir. Auf diese kurze Entfernung wirkten sie größer als sonst. In Erinnerung an die Geschichte von Gulliver in Lilliput lächelte ich. „Die sind ganz schön fleißig“, dachte ich bei mir, als ich die Tierchen auf ihren Wegen beobachtete. Sie trugen schwere Lasten auf ihren Rücken, deutlich größere als sie selbst. Die Ordnung, die auf ihren Pfaden herrschte, beeindruckte mich. Für sie gab es keine unüberwindbaren Hindernisse. Nicht alles fiel ihnen leicht. Man sah ihnen an, dass sie sich anstrengen mussten. Aber ihr Wille war stärker. „Nicht die Umstände, der Wille ist entscheidend“, schoss es mir durch den Kopf. Dann betrachte ich wieder den Himmel. Viel bewegen konnte ich mich nicht, also schaute ich in den Himmel. Blau und weit, wie er war. Sehr weit. Er war einfach da, und ich hatte Zeit, ihn anzusehen. Das gab mir innere Ruhe. Meine Gedanken ordneten sich, und die Frage, wie lange mein Körper wohl ohne Wasser und Essen durchhalten würde, ängstigte mich nicht mehr so sehr. Es war vielmehr die Feststellung, dass wir alle sterblich sind, und auch mein letzter Tag, der gestern noch so unendlich weit entfernt schien, unerwartet schnell anbrechen könnte. Schreien war sinnlos, Gehen konnte ich nicht. Also betrachte ich den Himmel. In mir öffneten sich die Tore in die Vergangenheit.