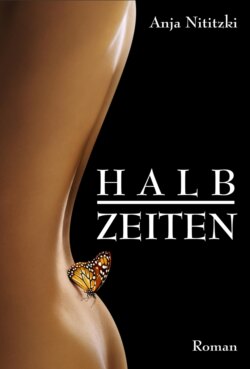Читать книгу Halbzeiten - Anja Nititzki - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 6 … Opfer und Täter
ОглавлениеFeierabend. Heute war ich eher zu Hause als Spiderman, wartete auf ihn. Gelegentlich streunte ich zu den Katzen ans Fenster, blickte zur Bebelstraße hinaus, um zu schauen, ob er sich näherte. Er war spät dran. Ich war es gewohnt, auf Spiderman zu warten, aber heute erschien mir sein Fernbleiben besonders lang. Ich neigte mich am Fenster nach vorn, sodass mir die Zimmerpflanze, die im Fensterbrett wucherte, in die Nase pieckste. Ich zuckte, aber so konnte ich sehen, was sich auf dem Fußweg vor unserer Haustür abspielte.
Ein weinroter Opel Kadett älteren Baujahres parkte dort. Auf dem Fahrersitz saß mein Freund, ich konnte ihn deutlich erkennen. Nur das Auto kannte ich nicht. Was machte er auf dem Fahrersitz eines fremden Wagens? Am Morgen war Spiderman mit seinem Mountainbike in die Redaktion gefahren. Wie war es möglich, dass er am Abend mit einem fremden Auto nach Hause kam? Ich war verwirrt. Wer neben ihm saß, konnte ich nicht erkennen. Ich sah nur, dass der oder die „Jemand“ eine hellblaue Jeans trug. Die beiden gestikulierten, mein Freund beugte sich gelegentlich zu seinem Beifahrer oder zu seiner Beifahrerin hinüber. Mein Herz klopfte bis zum Hals. War Spider etwa so unvorsichtig, direkt vor meiner Haustür mit seiner Geliebten im Auto zu knutschen? Das konnte nicht wahr sein! Mir wurde schlecht, ich konnte meinen Blick nicht von dem weinroten Kadett und seinen beiden Insassen lassen. Alle meine Sinne waren geschärft. Ich dachte schon darüber nach, was ich zu ihm sagen würde, wenn sich mein Verdacht bestätigte. Wäre das das Ende? Hatte ich mir meine Frist gar umsonst gesetzt?
Endlich ging die Fahrertür auf. Mein Freund stieg aus. Nächste Tür. Ein Junge stieg aus. Er sah aus wie der Sohn des Dönermannes um die Ecke, hatte dunkles Haar, braune Haut, braune Augen, billige Kleidung. Die beiden redeten immer noch. Der Junge schlug mehrfach die Hände über seinem Kopf zusammen oder faltete sie vor der Brust. Ich beobachtete die beiden gebannt, bis Spider zum Telefon griff. Mein Freund blickte nach oben in Richtung Wohnzimmerfenster und bat mich telefonisch herunterzukommen. Meine Neugier wuchs ins Unermessliche. Was war da los? Schnell schlüpfte ich in meine Clogs, die ich immer anzog, wenn ich den Müll herauszubringen hatte.
Draußen angekommen erwarteten mich ein aufgeregter Junge aus dem Kosovo und ein vergleichsweise tiefenentspannter Spiderman. „Guck mal!“, sagte er, während er die Heckklappe des Kadetts öffnete und die Reste seines Mountainbikes aus dem Kofferraum klaubte. „Hettem hat mich umgekarrt, das Fahrrad hat einen Totalschaden und mein Schienbein hat neue Form und neue Farbe.“ Er hatte ein Hosenbein hochgekrempelt. Blut rann unterhalb einer blau umrandeten Platzwunde herab. Ich starrte ihn immer noch ungläubig an, der Gesamtzusammenhang wollte sich mir partout nicht erschließen. Mein Freund schwieg, bis Hettem das Wort ergriff: „Ich habe ihn umgefahren, bitte keine Polizei, keine Versicherung!“ Ich wollte meinen Ohren nicht trauen. Mir war in dem Moment klar, dass mein Freund sein Rad niemals ersetzt bekommen würde. „Ich bin Flüchtling, keine Polizei, keine Versicherung, bitte!“ Der Junge flehte, stellte sich mit vollständigem Namen vor und reichte mir dabei seine verschwitzte, zitternde Hand „Hettem Parassa“, entnahm ich seinem Wortpüree. „Und warum hast du das Auto gefahren?“, fragte ich meinen Freund. „Ich konnte nicht mehr fahren, war so aufgeregt“, winselte Hettem Parassa, bevor der Gefragte antworten konnte. Ich schaute Spiderman an, als wäre er eine Erscheinung. „Das ist nicht dein Ernst, oder?“ Er hatte Mitleid gehabt oder sich von Hettem einlullen lassen. Mein Verdacht war, dass der Junge hier ein ganz gemeines Spiel spielte, auf die Mitleidstour machte, um nicht bei der Polizei aufzufallen. Dafür hatte ich Verständnis, aber eine ehrliche Ansage wäre mir lieber gewesen. „Haben Sie was zu Trinken für mich, ich bin so aufgeregt. Einen Tee?“, fragte er. Spiderman machte Anstalten, ihn mit nach oben in unsere Wohnung zu nehmen. Schnell kam ich ihm zuvor und flitzte die Treppen hinauf. Ich holte eine Tasse von dem frischen Grünen Tee, den ich gerade aufgebrüht hatte. Hettem bedankte sich freundlich und er wollte mehr. Er wollte Geld. Denn sein Benzin würde durch den Umweg, den sein Unfallopfer mit seinem Kadett fahren musste, um das Schrottfahrrad und sich selbst nach Hause zu bringen, nicht mehr bis in den Stadtteil reichen, in dem er wohnte. Ich starrte ihn schockiert an. Ein bisschen Frechheit darf sein, aber das war zu viel! Was für eine Dreistigkeit! Mein Freund hatte sich bereits aus dem Gespräch herausgelöst und überließ mir die Verhandlungen. Ich verweigerte die Spende und verstand die Welt nicht mehr. Hettem zeigte kein Unrechtsbewusstsein. Er hatte gerade meinen Freund überfahren und wollte nun Geld für seine Heimreise. Ausgeschlossen! Er sah mir wohl an, dass ich nicht spendenwillig war und versuchte etwas Neues: „Können Sie mich nach Hause fahren, ich bin zu aufgeregt, um noch selber zu fahren“, schob er schnell nach. Ich war sprachlos. Mein Freund hatte Mitleid und schlug vor, den Jungen zu fahren. So viel Nächstenliebe hatte ich ihm nicht zugetraut. Stockholm-Syndrom? Das Opfer nähert sich freundschaftlich dem Täter? Ich sollte mich mit meinem Auto anschließen, damit sich mein Freund kein Taxi für die Heimfahrt nehmen musste. Ich reagierte nicht mehr auf diesen Vorschlag, drehte mich wortlos auf dem Absatz um und überließ Unfallopfer und Unfallverursacher das Feld. Das war zu viel! War das mein Mann? War ich seine Frau oder seine Mama? Bis Weihnachten wollte ich entscheiden, ob ich wirklich einen Mann brauchte, der mich so sehr braucht. Aber nach diesem Auftritt war ich geneigt, mir für mich eine Fristverkürzung zu beantragen. Ich zog mich mit Bärbel und Tarzan in mein Zimmer zurück, überließ Hettem Parassa und Spiderman ihrem Schicksal und ahnte, dass die beiden noch lange miteinander verbunden sein würden, wenn auch nicht durch eine Freundschaft.
Für den Rest des Tages verließ ich mein Zimmer nicht. Ich wollte, dass mein Freund allein klar kommt. Ich hörte wie der Opel nach einer guten halben Stunde startete und Spiderman zurück in die Wohnung kam. Er hatte sich also dazu durchgerungen, den jungen, nach eigenen Angaben nicht fahrtüchtigen Mann, allein nach Hause zu schicken. Er selbst leckte seine Wunden, pflegte sein deformiertes Schienbein.
In mein Notizheft schrieb ich mein Wort des Tages: „Hettem“. Ein Name, der immer irgendwie „gehustet“ klang, wenn ich ihn in meinen Gedanken aussprach. Hettem hatte mich auf bizarre Weise beeindruckt, meine Besonderheit des heutigen Tages!
Am nächsten Morgen war ich noch nicht bereit meinem Mitbewohner zu begegnen, drehte noch ein paar Runden in den Kissen, bis ich aus meinem Zimmer trat und feststellen musste, dass sich meine beiden Katzen sofort unterm Sofa versteckten. Sie mussten etwas gesehen haben, was sich meinem Blick noch verbarg. Ich ging vorsichtig ins Wohnzimmer. Jetzt sah ich es auch. Der Balkon. Er sah aus wie ein Schlachtfeld. Der Wäscheständer mit Spiders Fallschirmspringeranzug und seinen Socken war zusammengebrochen, er sah aus wie ein versteinerter Krake. Die Blumentöpfe waren von der Brüstung auf den Teak-Holzboden gestürzt und zerschlagen. Hatte ich einen Nachtsturm verpasst? Ich stieg vorsichtig über die Schwelle der Balkontür nach draußen und stakste durch das Trümmerfeld, lehnte mich über die Abgrenzung, blickte nach unten. Nichts. Drehte mich, schaute nach oben, um zu sehen ob der Balkon über unserem auch verunstaltet worden war. Ich blickte direkt ins Gesicht meiner Obermieterin. Mit ihrer Wuschelfrisur sah sie von unten betrachtet aus wie ein geföhnter Königspudel auf der Flucht. Sie legte ihren rechten Zeigefinger auf die Lippen, bedeutete mir damit, still zu sein, nichts zu sagen. „Pssst!“ Mit der anderen Hand winkte sie mich nach oben, tat geheimnisvoll. In Socken tippelte ich durchs Treppenhaus. Sie stand bereits in ihrer Wohnungstür, winkte mich hinein und schloss ganz langsam und leise von innen ab, so vorsichtig dass der Schlüssel nicht ans Holz schlug und keine klappernden Geräusche verursachte. Sie zog ihn ab und verstaute ihn in ihrer Jeans. Jetzt wich meine Neugier der Unruhe. Was hatte sie vor? Wollte sie sich mit mir zusammen einsperren? Warum? Ich folgte ihr ins Wohnzimmer, das Zimmer mit dem Balkon. Leise und bedächtig, als würde darin ein Baby schlafen, öffnete sie die Tür wie einen Schrein. Und dahinter schlief tatsächlich jemand. Ein Junge, der so ähnlich aussah wie Hettem Parassa der Fahrradkiller, nur etwas jünger. Er hatte noch nicht einmal einen Bart. Er lag längs auf dem Sofa meiner Nachbarin und schlief. Auf dem Couchtisch vor ihm lag ihre Geldbörse. Fein säuberlich ausgeräumt und eine halb leere Flasche Amaretto. Jetzt begriff ich, was das zu beuten hatte!
Meine Nachbarin hatte einen Schläfer! Auf seinem Weg in ihre Wohnung hatte er den Weg über meinen Balkon genommen, beim Aufstieg in die Belle Etage meine Blumentöpfe und Spiders Wäschespinne umgelegt. Und dann war der Knabe nach einer halben Flasche ihres Amaretto-Likörs wohl über dem Begutachten seiner Beute eingeschlafen. Wir schauten uns belustigt, aber auch besorgt in die Augen. Was sollten wir nun mit ihm machen?
Sie holte ihr Handy aus der Hosentasche. Der Schläfer schlummerte noch immer süß, bis das Klicken der Fotokamera ihn aus dem Schlaf riss und in Alarmbereitschaft versetzte. Er sprang sofort auf und rannte zum Balkon, vergaß dabei die Beute seines Raubzuges auf dem Couchtisch. Panisch machte er auf dem Absatz kehrt, die Belle Etage von oben nach unten zu verlassen schien ihm wohl zu gefährlich, zumindest, wenn es schnell gehen musste. Er rannte zurück, an uns vorbei, durch die Wohnung auf der Suche nach dem Ausgang. Fehlanzeige. Die Wohnungstür war verschlossen, der Schlüssel steckte in der Hosentasche meiner Nachbarin. Ihm blieb nichts weiter übrig, als gesenkten Hauptes zu uns in Wohnzimmer zurückzukommen. „Bitte keine Polizei, ich bin Flüchtling aus Kosovo … meine Familie ist hier, ich muss arbeiten.“ Ich staunte! Ein Déjà-vu? Schon der zweite Flüchtling innerhalb von 24 Stunden? „Setz dich hin!“, bestimmte die Nachbarin und zog mich aus dem Wohnzimmer. „Was machen wir mit ihm?“, fragte sie mich auf dem Flur. „Wenn wir die Polizei holen, steht er nächste Woche wieder in deinem Wohnzimmer. Das macht er noch ein paar Mal, bis sie ihn schnappen und er eine Jugendstrafe bekommt. Auf Bewährung versteht sich, oder er muss einige wenige Sozialstunden ableisten, bevor er abgeschoben wird. Das bringt alles nichts. Ich habe eine Idee!“, grinste ich. „Was hältst du davon, wenn er heute hier bei uns bleibt und sozialen Dienst leistet? Direkt nach dem Verursacherprinzip. Er kann seinen Fehler dort wiedergutmachen, wo er ihn verursacht hat.“ Sie sah mich ungläubig an. „Wie?“ Ich war nicht nur sauer auf ihn, er tat mir auch leid. Immerhin war er ein Kriegsflüchtling, der in seiner Heimat alles stehen und liegen gelassen hatte. Flüchtlinge brauchen eine Zuflucht, Kriegsverfolgte brauchen Schutz. Doch unser junger Schläfer hatte bereits Schutz und Obdach gefunden. Hierzulande verfolgte ihn kein Krieg, vielmehr war er Opfer einer schnöden Finanznot. Sie hatte ihn in das Wohnzimmer der Nachbarin getrieben. Dennoch: Man klaut nicht! Das hatte man ihm sicher vermittelt. Also, wie sollten wir mit dem Jungen umgehen?
Ich freute mich über meine eigene Idee: „Er bringt meinen Balkon, den er wie ein Schlachtfeld hinterlassen hat, wieder in Ordnung, dazu putzt er in deiner und in meiner Wohnung rundherum alle Fenster. Ich habe frei heute, ich kann auf ihn aufpassen.“ Ich hob meine Rechte, auf dass sie abklatschen konnte und das tat sie auch mit fröhlicher Genugtuung. Wir brachten dem Jungen einen Wischeimer, Fensterputzmittel und alte Zeitungen. Er sollte beim Putzen auch ein wenig leiden. Kein Mensch polierte seine Fenster mehr mit Zeitungspapier trocken. Er schon. Die Nachbarin öffnete eine Flasche Sekt für uns beide. Wir schlürften genüsslich, während „Hettem Nr. 2“, wie ich ihn getauft hatte, die Scheiben blank putzte. Das nenne ich gepflegte Selbstjustiz! Er würde in unsere beiden Wohnungen nie wieder einbrechen. Bevor er ging, bedankte er sich überschwänglich bei uns beiden.
Als ich am nächsten Tag aus der Redaktion nach Hause kam, war es still im Palazzo, aber es duftete extrem gut nach Essen.
Spiderman lag in eine warme Decke eingehüllt auf dem Sofa. Es war die dickste Kuscheldecke, die wir besaßen, er hatte sich darin eingerollt, mitten im Sommer. Es war sogar eine Komfort-Kuscheldecke mit Ärmeln, die Spiderman quasi angezogen hatte wie einen Pullover. Bärbel lag wie ein Sahnehäubchen obenauf, schnurrte auf seiner Hüfte und Tarzan hatte es sich in seiner Kniebeuge bequem gemacht. Er öffnete nicht einmal ein Auge, als ich hinzukam.
„Meine Stunden sind gezählt“, ächzte mein Freund. Farblich sah Spider wirklich danach aus, also ob es bald mit ihm zu Ende ginge. Sein Oliv harmonierte mit dem Braun der Komfortdecke. Ich kniete mich an sein Krankenlager, setzte mein Betroffenheitsgesicht auf und fragte den Leidenden, was los war.
„Ich war laufen an der Costa Cospuda, als es über mich kam. Ich hatte „Blischnu“. Blischnu – das hieß, der schnell voranschreitende Krankheitsverlauf hatte ihn zu mehr Geschwindigkeit und Abkürzung der Worte gezwungen und stand für „Blitzschnurze“. „Muss wohl am Frühstück gelegen haben. Ich habe vor dem Start nur einen Apfel gegessen“, jammerte er. „Selbst schuld!“, war meine erste Reaktion. Ich stöhnte, konnte Spider sich denn nicht einmal ohne fremde Hilfe laufgerecht ernähren? Nun hatte er sich nicht einmal einlaufen können, sondern hatte sich quasi einen Einlauf von innen verpasst. „Ich habe es nicht mehr ausgehalten, bin in die Büsche gerannt und habe nach Rhabarberblättern gesucht. Waren aber keine da, was da wuchs war zu klein!“ Ich bekam einen Lachanfall, Spider durfte nicht lachen, es bestand schließlich akute Gefahr für ihn und seine Umwelt. Mir liefen die Tränen vor Lachen, denn ich stellte mir vor, wie er durchs Gehölz kroch in der Hoffnung auf eine taugliche Pflanze, die ihn retten könnte. „Ich fand nichts, also entblößte ich mich im Gebüsch, wie ein Triebtäter kam ich mir vor. Hängte die Laufhose an einen Ast, der wippte. Meine teure Unterhose habe ich benutzen müssen und danach allein im Wald zurückgelassen. Mir war alles egal in dem Moment.“ – „Und?“, stellte ich unter Tränen meine Sparfrage, die immer mit vielen Worten bezahlt wurde. „Bin wieder in meine Stretchhose gestiegen und nach Hause getrabt. Fragte mich die ganze Zeit, ob die Spaziergänger mir ansahen oder anrochen, dass ich nicht ganz vollständig bekleidet unterwegs war. Zum Glück hatte ich Musik auf den Ohren, sodass ich ihre Kommentare nicht hören konnte. Schleppte mich nach Hause.“ Ich konnte nicht aufhören zu lachen, stellte mir vor wie er in seiner hautengen, froschgrünen, leicht glänzenden Stretchlaufhose ohne Untergewand durch die Straßen lief und witternd in die Umgebung spähte. Ich dachte unweigerlich an einen Gülle-Schlepper. „Und wieso riecht’s hier so? Du kannst in deinem Zustand nicht essen, was du hier in der Küche fabriziert hast!“, belehrte ich den Schwerstkranken. „Ich habe für dich gekocht, Elfie, nach Kochbuch.“ Ich wusste, was das bedeutete. Mein Freund konnte eigentlich nicht kochen, er konnte nur Nudeln oder Eier heiß machen. Er musste bereits vor seinem Lauf in den Morgenstunden zum Kochbuch gegriffen haben, denn wer nach Bildern kochte brauchte Zeit. Er hatte sich mariniertes Flusskrebsfleisch auf gebratenem Spargelsalat herausgepickt und so lange gewerkelt, bis das Essen genauso aussah, wie das perfekte Gericht auf dem Foto im Kochbuch. Seine größte Herausforderung musste es gewesen sein, im Supermarkt eine Kumquat ausfindig zu machen. Die kleine Bitterorange zierte den erkalteten gebratenen Spargel, über den ich mich genüsslich hermachte. Irgendwie war ich gerührt, manchmal war Spiderman doch zu etwas zu gebrauchen. Zufrieden grinsend fütterte ich mein Worte-Buch mit „Blischnu“.
Am nächsten Morgen spazierten wir gemeinsam in die Redaktion, weil sein Fahrrad nicht mehr zu reparieren war. Ich zeigte mich solidarisch und begleitete den Siechenden ebenso zu Fuß. An der Freakshowtafel gab es keine News. Napoleon war nicht im Aquarium, hatte aber per E-Mail meine Tatort-Gucker-Arten-Studie gesegnet, sodass ich mich an die dritte Kolumne machen konnte: „Mörder-Raten“. Ich hatte in der Tatortkneipe beobachtet, dass punkt 21 Uhr viele der Gäste zum Handy griffen und SMS oder WhatsApp-Nachrichten verschickten. Paul hatte in seinem Tresengespräch auch herausgefunden, was dahintersteckte. Um 21 Uhr war der Kommissar längst mehreren falschen Spuren gefolgt, der bunte Strauß an Verdächtigen aufgeblüht, das Opfer schon lange tot, aber für die Tatortfans war erst jetzt Deadline. Um 21 Uhr wurden die Killerprognosen an die Lieben daheim, an Freunde und Verwandte geschickt. Wer hatte recht? Meistens war der Killer eine Figur, die im Film nur am Rande auftauchte, eine Nebenrolle, mit deren großem Auftritt als Mörder niemand rechnen würde. Gern waren auch Familienangehörige des Opfers im engsten Kreis der Verdächtigen versteckt. Langsam begriff ich warum die Tatort-Nörgler sich so oft über sich immer ähnelnde Storys beklagten. Ein Wunder, dass sie sich überhaupt noch zur 21-Uhr–Prognose, zum „Mörder-Raten“ hinreißen ließen. Ich schickte SMS an meine Freunde und an Kollegen, mit der Aufforderung, an diesem Sonntagabend mitzuraten. Da musste sich ein hübscher Text daraus machen lassen, mit dem Napoleon zufrieden sein konnte. Auch Pauls Nummer hatte ich aus dem Redaktionssystem gefischt und ihn mit meiner Bitte versorgt. Er bekam meine SMS während er mir gegenüber am Schreibtisch saß, sah meine Nummer aufblitzen und grinste, ohne den Text überhaupt gelesen zu haben. Er tippte etwas in sein Handy, und schon hatte ich eine Antwort. Sehr schlauer Bursche, der Tatort war noch nicht einmal gesendet und er wollte schon seine Prognose abliefern. „eta prestupnika“, blitze es in kyrillischen Buchstaben auf meinem Display auf. Verdammt, er wollte mich herausfordern, ein wenig necken! Kyrillische Buchstaben! „Es ist eine TäterIN“, hatte er geschrieben und wohl nicht damit gerechnet, dass ich bereits so betagt war, dass sieben Jahre Russisch-Unterricht in der DDR nicht spurlos an mir vorbeigegangen waren. „durak!“, erwiderte ich: Dummkopf! 1:1, das hieß Gleichstand. Ich beschloss, das Spiel nicht weiterzubetreiben.