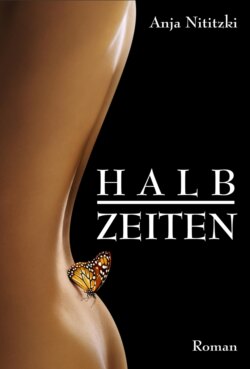Читать книгу Halbzeiten - Anja Nititzki - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1 … Timoschenko und der Graue Wolf
ОглавлениеDer Graue Wolf war mir zugelaufen. Er wurde ausgesetzt, kurz vor Heiligabend. Plötzlich war er ohne festen Wohnsitz. Seine Verflossene hatte über Nacht ein neues Türschloss in sein Haus einbauen lassen. Warum? Weil er mich kennengelernt hatte! Wobei das nicht ganz korrekt ist, denn er und ich kannten uns bereits seit Jahren. Wir waren und sind Kollegen. Wir arbeiten bei der Zeitung. Ich schreibe die Artikel, er macht die Fotos dazu.
Nun stand er vor meiner Tür, ausgestattet mit zwei blauen Müllsäcken, die er bedeutungsschwer vor sich her trug. Seine Ex hatte ihm auf diese Weise so liebevoll wie deutlich „Lebe wohl“ gesagt, ihm seine Kleidung portioniert. Gelegentlich wurde die Empfangsdame an der Rezeption in der Redaktion Teil der Schlüpfer-Logistik zwischen ihr und ihm, weil seine Ex ihm dort die blauen Müllsäcke zu deponieren pflegte.
Ich nahm ihn bei mir auf und führte fortan ein sehr ruhiges Leben. Was für mich als Frühaufsteherin, Schnelldenkerin, Blitz-Entscheiderin und „Immer zu wenig Zeit-Haberin“ eigentlich jenseits meiner Vorstellungskraft lag.
Mit dem Grauen Wolf an meiner Seite verbrachte ich fünfzig Prozent meines Beziehungslebens damit zu warten.
„In Hektik passieren Fehler“ war einer seiner Leitsätze, gefolgt von „Eile macht den Weg nicht kürzer“. Ich liebte ihn für jeden dieser Sätze, er brachte Ruhe in meinen Alltag und ich genoss die Zweisamkeit, gewährte ihm und seinen blauen Schlüpfersäcken Asyl auf unbestimmte Zeit, schuf bald Platz in meinen Schränken und in meinem Bett. So schlich er sich peu à peu in mein Leben, langsam, beharrlich, unaufgeregt, leise.
Mein Kollege aus der Foto-Abteilung hatte mir schon immer gefallen. In der Redaktion wirkte er meist wie lebendiges Inventar. Man hörte ihn nie, er bewegte sich bedächtig. Ein grauhaariger Schleicher, der seine Telefonate im Flüsterton abhielt. Immer umwehte ihn der Ruch des Geheimnisvollen, vielleicht sogar des Verbotenen, Unbekannten, weil er so unglaublich leise war. Für mich machte ihn genau das interessant.
Für mich – die „Timoschenko“. Das ist mein Spitzname. Die Redaktion hat ihn mir für meine Timoschenko-Frisur verliehen, ein Kunstwerk, was für meinen Freund so beeindruckend war wie ein Weltwunder, das jeden Morgen aufs Neue entstand. Ich selbst hatte Jahre damit verbracht, mir mein Haar bis zum Hosenansatz wachsen zu lassen und Monate dafür, das Binden des Zopfkranzes zu üben. Die ukrainische Ex-Regierungschefin hatte dafür bestimmt eine Zofe.
Und eines Morgens, als sich dank der Schlüpfer-Logistik herumgesprochen hatte, dass die Timoschenko und der Graue Wolf ein Paar waren, fand ich ein „Rotkäppchen und der Wolf“-Plakat an der Wand rechts neben meinem Schreibtisch angepinnt. Dazu ein paar Flaschen Rotkäppchen-Sekt und meine feierlaunigen Kollegen, die mit den Gläsern klirrten.
Unser grauer Redaktions-Wolf bekam nach dem Umbau im Großraumbüro ein neues Revier zugewiesen. Zusammen mit den anderen beiden Bilderfängern bezog er seinen Arbeitsplatz am Ende des schlauchförmigen Büros. In einem Anflug von Zuneigung heftete ich ein Plakat über seinen Schreibtisch. Die Naturschutzbehörde rief dazu auf, den Wolf zu schützen. „Rettet Isegrim“, prangte in roten Lettern unter dem Porträt eines grauen Wolfes. Das hatte zur Folge, dass die Fotografen-Lounge in „Wolfsschanze“ umgetauft wurde. Über die alte Diskussion, ob man über derlei verbale Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg Witze machen durfte oder nicht, waren die Journalisten in unserer Redaktion längst erhaben. Alle konnten darüber schmunzeln, nur einer nicht: Napoleon, unser Chef.
Der kleine Diktator residierte am gegenüberliegenden Ende des Großraumschlauches in seinem Aquarium. So nannten wir sein Büro – ein Glaskasten, in dem sich der kleine Mann nicht vor uns neugierigen Spähern verbergen konnte, nur vor unseren Lauschangriffen. Das Aquarium war schalldicht, aber nicht blickdicht. Nicht einmal ohne Aufsicht in der Nase bohren, konnte er, kein versonnenes Ohrenschmalzschürfen blieb ungeahndet, kein vergeistigtes Haaresortieren blieb ungesehen, kein Zurechtrütteln seines verklemmten Gemächts unbeobachtet, kein gieriges Verschlingen von Keksresten unbemerkt. Eigentlich hatte er es schwer, unser kleiner Diktator. Aus humanitären Gründen hätte man ihm Jalousien vor die Glaswände seines Aquariums hängen können, auch für uns Außenstehende wäre das ein Gnadenakt der Menschlichkeit gewesen. Doch Mitleid hatte sich unser Chef bislang noch nicht verdient!
Im Verlauf seiner journalistischen Karriere durfte jeder von uns Mitarbeitern Napoleons Chef-Aquarium nur in den seltensten Fällen betreten. Eigentlich nur einmal zum Einstellungsgespräch oder zur Verabschiedung. Der Chef war in seinen Entscheidungen unberechenbar, willkürlich, eben ein zu klein gewachsener Mann! Unvorstellbar, dass es Menschen geben konnte, die ihn mochten. Aber es musste sie geben. Unsere Büroputzfrau war die Einzige, die in sein Aquarium hinein durfte, wenn er nicht darin saß. Sie hatte eines Tages herausgeplaudert, dass er einen besonders hübschen Bildschirmschoner hatte. Das schöne Wort „Schubberbär“ zog auf dem Monitor Kreise und veränderte in regelmäßigen Abständen seine Farbe. Dass er ihn sich selbst geschrieben hatte, schien mir unwahrscheinlich und die Putzfrau war es sicher auch nicht.
Eines Morgens bat er mich per E-Mail in sein Büro. Kommunikation war nicht seine Stärke, denn er hätte mich auch direkt einladen können, als er mir auf Brusthöhe im Fahrstuhl gegenüberstand und es verkniffen vermied, zu mir aufzuschauen. Ich war keine besonders große Frau, Napoleon jedoch ein besonders kleinwüchsiger Mann. Vermutlich fühlte er sich besser, mir von seinem Bürosessel aus eine Audienz aufzuzwingen, als meine Brust zu besprechen. Mir sackte sofort das Herz in die Magengrube, ich bekam trockene Lippen und schiere Angst machte sich breit, Aufruhr in der Kehlkopfgegend!
Ich hob mich schwerfällig von meinem Bürostuhl, mit dem sicheren Wissen, dass es das letzte Mal war, dass ich ihn als Inventar der Redaktion allein an meinem Schreibtisch zurückließ. Meine Kollegen wussten Bescheid, ich hatte Napoleons Einladung gleich per E-Mail an alle weitergeleitet. Ihre Blicke sprachen Bände: Angst, der Nächste zu sein, Mitleid, Unverständnis. Selbst aus der Wolfsschanze vom anderen Ende des Büroschlauches vernahm ich ein gespanntes Knistern. In den Augen meines Grauen Wolfes sah ich Rebellion. Er würde mich rächen oder Napoleon den Krieg erklären, wenn der mir den Kampf ansagte. Ich lief mit klopfendem Herzen den Bürogang entlang, der mir heute besonders endlos erschien, schritt wie Jeanne d’Arc zum Scheiterhaufen, wie Marie Stuart zu ihrem Henker.
„S sss ch Timo!“ Der vollständige Satz: „Setzen Sie sich, Timoschenko“, war Napoleon wohl zu persönlich und zu verschwenderisch. In der Redaktion musste gespart werden, auch an Worten. Meine Position sollte sich schlagartig verbessern, denn sobald ich saß, hatte Napoleon die Chance, mir auf Augenhöhe zu begegnen.
Ich ließ meinen Blick nicht von dem Kleinen, positionierte mich aufrecht ihm gegenüber, nahm die Schultern zurück, drückte meine Brust heraus, das Kinn leicht angehoben, die Augen starr auf mein Gegenüber geheftet. Ich wollte in Würde geköpft werden. Ich sinnierte krampfhaft, welchen Fehler ich begangen hatte, welcher Fauxpas mir diesen Gang zum Schafott beschert hatte.
„Timo, Sie sind vorlaut, sarkastisch und bisweilen zynisch. Sie machen mir hier zu viel Stimmung. Das gefällt mir nicht, aber dadurch sind Sie eine für die ganz harten Nüsse und für die abwegigsten Geschichten. Können Sie sich vorstellen für unser Blatt jeden Montag eine „Tatort-Kolumne“ zu schreiben? Das Volk guckt jeden Sonntag um 20.15 Uhr geschlossen den Tatort in der ARD. Am nächsten Tag ist Volkes Stimme auf sämtlichen Plattformen zu lesen, nur nicht in unserer Zeitung. Ändern Sie das! Versuchen Sie aus Blut und Sperma irgendwas Nettes, Aufrichtiges zu machen. Ich will beim Lesen schmunzeln können – mindestens!“ Der Chef hatte nicht zum Köpfen ausgeholt, sondern zu meinem Ritterschlag und zum Übertragen einer schweren Bürde auf meine Schultern: Was Nettes machen – aus Blut und Sperma!