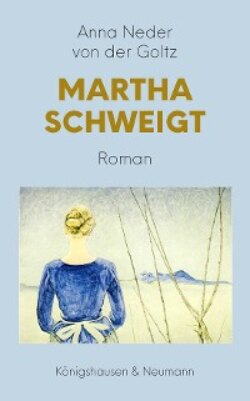Читать книгу Martha schweigt - Anna Neder von der Goltz - Страница 15
Оглавление6 Der Fluch
Sein Blick vom Schreibtisch aus fiel durchs Fenster in den Garten. Die Schulhefte stapelten sich an beiden Seiten. Ich werde den Fehlern der bildungsunwilligen Dorfkinder nie Herr werden, dachte er und fragte sich, wie lange er noch das Stöhnen und Jammern seiner kranken Frau, das durch die geöffnete Tür des angrenzenden Schlafzimmers zu hören war, ertragen werde können. Er war nicht wirklich froh darüber, wieder vom Krieg heimgekehrt zu sein. Sie hatten monatelang gehungert, gefroren und jeden Tag um ihr Leben gekämpft. Aber was ihn hier erwartete, welches Leben sollte das sein?, dachte Friedrich. Und der Hof, ein Gutshof, von dem er so geträumt und den man ihm nach dem Endsieg versprochen hatte, war für alle Zeiten verloren. So einen Hof, wie ihn Vater hatte, im Nachbarort mit Pferdeställen, Vieh auf der Weide, Scheunen und Weinkeller, und den sein jüngerer Bruder, sein behinderter Bruder geerbt hatte – der ein Krüppel war.
Schorsch, sein älterer Bruder, wäre der rechtmäßige Hoferbe gewesen. Friedrich nahm das gerahmte Foto von ihm, das seit vielen Jahren auf seinem Schreibtisch stand, verblichen vom einfallenden Licht der Sonne, in beide Hände.
*
Sechzehn Jahre war Schorsch damals alt, mit seinen blonden Locken, den strahlend blauen Augen und dem verschmitzten Lächeln in seinem Gesicht, den Kopf leicht abgewandt, immer im Gehen begriffen, immer unterwegs.
„Kommst du mit?“, rief er fröhlich, schnappte sich das Moped vom Vater, fuhr die Feldwege entlang und quer die Wiesenhänge hinab. Friedrich musste sich beeilen, wenn er mit dem dunkelroten Damenfahrrad seiner Mutter hinterherkommen wollte. Schorsch schnitt ihm den Weg ab, fuhr Zickzack, wenn sie um die Wette die staubige Dorfstraße entlangfuhren, und lachte laut, während seine blonden Haare nach hinten flogen. Ab und zu nahm er Friedrich auf dem Gepäckträger mit. Er musste sich immer enger an den Rücken seines großen Bruders klammern, während sie den Wiesengrund hinunter holperten, wo sie das Moped ins Gras warfen und sich raufend auf dem Boden wälzten. Ihre Wangen waren erhitzt, wenn sie ihre von Schweiß und Staub klebenden Hemden über den Kopf streiften, die Hosen auszogen und in den Karpfenweiher sprangen, in dem es verboten war zu baden. Dort am Ufer unter der Trauerweide lagen sie stundenlang im Gras, träumten von Mädchen und davon, wie ihr Leben wohl einmal aussehen würde.
Vater war Bürgermeister im Ort gewesen. An Kirchweih durften sie immer in einer Kutsche sitzen, die inmitten des Trachtenzuges durch das Dorf fuhr. Oft ließ er das Pferdegespann anhalten, wenn er Schorsch und Friedrich am Straßenrand sah und ließ sie zusteigen.
Im Winter spannte er den Ackergaul vor den großen Schlitten, ließ alle Kinder aus der Nachbarschaft, in dicke Pferdedecken eingehüllt, aufsitzen und fuhr mit ihnen über die verschneiten Wege. Er blieb immer in Sichtweite des Dorfes, damit er sich bei der früh einfallenden Dunkelheit nicht verirrte und durch das warme Licht in den Fenstern der Häuser und den Petroleumlampen vor den Haustüren wieder den Weg zurückfand.
Im Herbst und den ganzen Sommer über wanderten sie sonntags mit Vater durch den Wald an der Kapelle Terzenbrunn vorbei zu seinen Verwandten nach Arnshausen. Sie schoben das Laub mit ihren knöchelhohen Schuhen vor sich her und freuten sich, wenn die Blätter in die Luft wirbelten. Sie schnitzen heimlich Zeichen oder Buchstaben mit ihren Taschenmessern in die Rinden der Bäume und mussten sich beeilen, Vater wieder einzuholen, damit er nichts merkte. Und wenn sie abends nach Hause kamen, machte Mutter ihnen ein Fußbad, brockte Brot in warme Milch und ließ sie oftmals im elterlichen Bett schlafen, was sonst nur dem jüngeren Bruder Ferdinand wegen seiner Krankheit vorbehalten war.
An Weihnachten und Ostern kamen Patres aus dem nahegelegenen Kloster ins Dorf, um die Messe und die Beichte abzuhalten. Sie wohnten immer beim Bürgermeister. Friedrich und Schorsch durften dann lange aufbleiben. Am Abend erzählten diese von ihren Missionarsreisen nach Afrika, von Elefanten, Löwen und anderen Abenteuern.
Schorsch und er mussten immer grinsen, wenn die Patres am Karfreitag Bauernwürste oder Kesselfleisch aßen, was für Katholiken einer Todsünde glich. Mutter ermahnte ihre Buben jedes Mal mit erhobenem Zeigefinger zu schweigen und erklärte wiederholt, dass man unter einem fremden Dach das Essen des Gastgebers nicht verschmähen durfte, was sie nicht erwähnte war, dass sich die Patres diese Verköstigung ausdrücklich gewünscht hatten.
Abends rauften die Patres mit Friedrich und Schorsch oftmals auf dem Teppich vor dem Kaminofen in der warmen Wohnstube und strichen den beiden Brüdern jedes Mal, bevor sie zu Bett gingen, über ihren Haarschopf, wobei sie mit dem Daumen ein Kreuz auf ihre Stirn zeichneten, um sie zu segnen – und als Schorsch zwölf war, nahmen sie ihn mit.
„Vater will, dass ich Pfarrer werde“, unterdrückte Schorsch sein Schluchzen, während er sich die Bettdecke an diesem Abend bis zur Stirn hochzog.
„Was?“, entfuhr es Friedrich, der im Bett hochschreckte und nicht sicher war, wo die Worte im Dunkeln herkamen. Träumte sein Bruder? Erst jetzt merkte er, dass Schorsch weinte.
Als sie noch klein waren, waren sie oft in den unbeheizten Zimmern unter eine Decke gekrochen, um sich gegenseitig zu wärmen. Friedrich zögerte einen Moment, doch dann nahm er seine Bettdecke und legte sich in Schorschs Bett an dessen Seite.
Schorsch hatte sich die Tränen mit dem Bettzipfel abgewischt und grinste verlegen.
„Ich muss dir morgen noch Moped fahren beibringen und mein Taschenmesser kannst du auch haben, als Andenken“, sagte er.
„Ich will nicht, dass du fortgehst“, erwiderte Friedrich und holte tief Luft, um nicht auch in Tränen ausbrechen zu müssen.
„Keine Angst, ich werd nicht Pfarrer, ich werd Richter und dann werde ich alle verklagen.“
Eng umschlungen unter ihren Bettdecken, dieses Mal hatte Friedrich seinen Arm schützend um den großen Bruder gelegt, schliefen sie ein.
Vater hörte sich weiterhin täglich in der Mittagszeit die Sorgen der Dorfbürger im Rathaus an. Es kamen Frauen aus dem Dorf, die ihn baten, ihren Männern zu sagen, dass sie nicht so viel trinken sollten, es kamen Kriegsinvalide, die ihr Leid klagten, weil sie mit der Arbeit auf dem Feld nicht fertig wurden, und manch einer wütete über sein ungezogenes Kind und fragte sich, ob es nicht ein Bankert aus den Kriegstagen sei. Es kamen Alte, die nach Brennholz fragten, oder Lebensmittel brauchten, weil sie zu wenig Rentenmarken geklebt hatten und ihr Essen nicht ausreichte.
„Euer Vater ist ein guter Mensch“, sagte Mutter immer, wenn sie Friedrich und Schorsch mal wieder mit einem Korb voller Kartoffeln und Äpfel zu den Häusern der Bedürftigen losschickte. Doch seit dem Tag, an dem Friedrich allein die Körbe trug, zweifelte er, ob Vater wirklich ein guter Mensch, ein guter Vater war.
*
Vater ist ein Schwächling, dachte Friedrich. Als der zweite Weltkrieg begann, hatte Friedrich gesehen, wie Mutter dem Hausarzt eine Stofftasche mit einer Flasche Schnaps und einen in Zeitungspapier gewickelten Schinken in die Hand drückte.
„Herr Doktor, mein Mann hat schon so viel mitgemacht, können Sie nicht was tun?“
Der Arzt nickte. „Und Ferdinand, der schafft den Hof ja auch nicht allein“, unterstützte er Mutters Absichten.
„Es ist wegen der Lunge, Herr Doktor, sein Husten nachts, den er vom letzten Krieg mitgebracht hat …“, wich Mutter aus.
Vater musste nicht in den Krieg ziehen, Ferdinand nicht – nur er.
In den letzten Kriegstagen kam eine Frau auf den Hof gerannt und rief: „Bürgermeister, die Amerikaner kommen, sie sind schon bei den Weinbergen, schnell, Sie müssen was tun“, rief sie ganz außer Atem.
Vater befahl Mutter ein Bettlaken zu holen und Ferdinand die Apfelpflückstange aus der Scheune, an die das weiße Laken gebunden wurde. Mit dieser weißen Friedensfahne in der Hand und seinem hinkenden Sohn an der Seite ging er den amerikanischen Soldaten auf den Weinbergwegen entgegen und überreichte ihnen den Rathausschlüssel.
„Es fiel kein einziger Schuss, Opa rettete unser Dorf “, prahlte sein Neffe jeden Sonntag beim gemeinsamen Mittagessen, bei dem die ganze Familie zusammensaß, eine Tradition, die Mutter nach dem Krieg hatte wiederaufleben lassen.
„Weißt du, dass Vater nicht mal in der Partei war?“, wandte sich sein Bruder Ferdinand jetzt an ihn.
„Mutter hatte ihn ins Rathaus nach Ellersbach geschickt, damit er sich als Parteimitglied eintrage. Aber Vater“, so erzählte dieser weiter, „war damals auf halbem Weg umgekehrt und all die Hitlerjahre hindurch hatte niemand gemerkt, dass er gar nicht in der Partei gewesen ist. Vater ist ein Held!“
Mutter klopfte bei diesen Worten sanft auf Vaters Schulter und setzte sich neben ihn. Er nahm ihre Hand und wollte mild und versöhnlich wirken, als er sagte:
„Ja, manchmal sind es die Daheimgeblieben, die ihren Mann stehen und das Vaterland retten müssen.“
Friedrich spürte, wie ihm der Sauerbraten aufstieß und einen bitteren Geschmack im Mund hinterließ.
„Ich muss gehen, meine kranke Frau wartet zuhause.“ Er stand ruckartig auf und murmelte noch „Gesegnete Mahlzeit!“
Mutter fing ihn an der Haustür ab und bat ihn zu warten, sie wolle für seine Frau noch etwas zum Einreiben mitschicken. Auch Gernot, der Jüngere der beiden Neffen, kam hinter ihm hergerannt:
„Onkel Friedrich, wann gehen wir wieder auf Rebhuhnjagd?“
„Bald“, antwortete Friedrich und tätschelte die Wange von Gernot. Er wurde jedes Mal schwach, wenn er die strahlend blauen Augen und den blonden Lockenkopf seines Neffen sah, die ihn immer wieder an seinen Bruder Schorsch erinnerten. Mutter hielt ihn am Arm fest, als sie ihm den Beutel mit dem Glas Gänseschmalz und einem Stoffsäckchen mit getrockneten Brennesselblättern in die Hand drückte.
„Dein Vater hat das nicht so gemeint, er war doch selbst im Krieg.“
„Ach was, für sein Drückebergertum müsste man ihn noch im Nachhinein erschießen“, entfuhr es Friedrich zornig, bevor er sich von ihr losriss.
„Friedrich, versündige dich nicht, um Gottes Willen!“, stieß Mutter hervor und als sie ihn die Treppe hinunter und zum Hof hinausgehen sah, bekreuzigte sie sich.
Friedrich war aufgewühlt von dem Geschwätz und quälte sich den ganzen Weg durch den Wald zurück nach Hause mit Gedanken über Sünde und Strafe. Wofür wurde er eigentlich bestraft, fragte er sich.
Schorsch, seinen Bruder, den er so geliebt hatte, hatte er verloren, seine Frau war krank, seine Ehe blieb kinderlos und für seinen Einsatz im Krieg wurde er nun mit der Häme der Drückeberger überschüttet – war dies nicht alles Strafe? Aber wofür?
Er verfluchte sich und die Welt und merkte, wie bei diesen Gedanken sein Kopf schwer wurde und er ließ ihn in beide Hände auf die Schreibtischplatte fallen. Als er wieder zu sich kam, seinen Kopf hob, sah er das Bild von Schorsch auf seinem Schreibtisch stehen und spürte, wie sehr er ihn noch immer vermisste, als draußen ein Ast vom Baum herunterkrachte.
Es war Paul, er hatte ihn gebeten, die Obstbäume zu schneiden. Paul war jung, ein ehemaliger Schüler von ihm – auch er war im Krieg gewesen.
Durchs Fenster beobachtete er, wie Paul auf den Bäumen herumkletterte und die Äste für den nächsten Austrieb zurückschnitt. Mit seinen weit ausholenden, gestreckten Armen lockerte er die abgeschnittenen Zweige aus dem Geäst und warf sie auf die Erde. Friedrich konnte die Muskeln seiner Oberarme und seiner Schultern unter dem Hemd erkennen, wie diese sich zusammenzogen und gespannt weiteten, wenn wieder ein Ast Richtung Boden fiel. Der Schweiß rann ihm den Nacken hinunter und in seinen dunklen Locken verfing sich das eine oder andere trockene Blatt des Baumes. Friedrich spürte den Schmerz, eine Sehnsucht in der Brust, die ihn fast zerriss. – Wie gerne wäre er noch einmal jung gewesen.