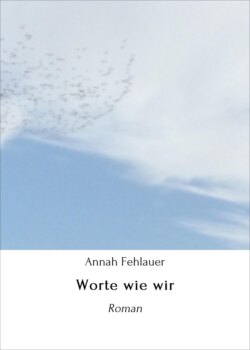Читать книгу Worte wie wir - Annah Fehlauer - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
...8...
ОглавлениеSeit ihrem Gespräch über schlechte Laune, die wie ein Stinktier die Atmosphäre verpestet, waren einige Wochen vergangen. Der Frühherbst war in den Spätherbst übergegangen, und die Tage wurden allmählich wieder kürzer. Hin und wieder hatte Catharina sich bei ihrer kleinen Freundin erkundigt, was das Stinktier mache, aber Marie hatte jedes Mal unbekümmert mit den Schultern gezuckt und nur knapp geantwortet: „Is’ nich da.“
Tatsächlich kam es Catharina so vor, als seien die Anfälle schlechter Laune, die Marie hin und wieder heimsuchten, in dieser Zeit ausgeblieben. Und dennoch hatte sie das Gefühl, Marie brüte über irgendetwas. Sie schien zwar nicht schlecht gelaunt, aber sehr nachdenklich, wenn nicht sogar etwas schwermütig zu sein.
Die Gelegenheit, sie darauf anzusprechen, kam eines Nachmittags im späten Oktober. Die beiden ungleichen Freundinnen saßen in der Küche. Neben Marie auf der Küchenbank lag die Wochenzeitung, die Catharina bislang nur überflogen hatte. Sie bemerkte, dass Marie, die eigentlich dabei war, ein Bild zu malen, ihren Blick immer wieder zum Titelblatt der Zeitung wandern ließ. „Die Achse des Bösen“ lautete der für diese Zeitung außergewöhnlich reißerische Titel, was Catharina überhaupt nicht gefiel.
Die Welt hatte sich ein Stück weit verändert seit dem ungeheuerlichen Anschlag im September. Noch immer berichteten die Medien tagtäglich über die Opfer von 9/11, spekulierten über Hintergründe, veröffentlichten Porträts über verunglückte Feuerwehrmänner und Interviews mit Hinterbliebenen.
Die Wunden waren unverheilt.
Wie alle anderen, war Catharina fassungslos angesichts dieser menschlichen Katastrophe. Mit Marie hatte sie darüber noch nicht gesprochen, wie ihr erst jetzt bewusst wurde. Dabei war sie sicher, dass Marie sehr wohl von den Geschehnissen mitbekommen hatte.
„Marie, geht es dir gut?“
„Hmm.“ Marie hielt den Blick gesenkt.
„Nicht so richtig, oder?“
„Hmm.“ Marie hob ansatzweise die Schultern und ließ sie wieder fallen.
„Möchtest du mir erzählen, was dich bedrückt?“
Als Marie nun aufsah, bemerkte Catharina, dass ihre Augen glänzten, als bildeten sich darin gerade Tränen.
„Ich bin so traurig, wenn ich daran denke.“
„Woran denn, meine Süße, wenn du woran denkst?“
„An die ganzen toten Menschen und die kaputten Häuser und die Familien, in denen jetzt jemand fehlt.“
„Du meinst die Opfer des Anschlags in New York, richtig?“ Catharina sah, wie eine einzelne Träne ganz langsam Maries Wange entlang rollte, und sie setzte sich neben sie, um sie behutsam in den Arm zu nehmen. Marie nickte stumm und schmiegte sich enger an Catharina.
„Ich bin auch ganz tief traurig, wenn ich daran denke.“
Catharina schluckte. Wie immer, wenn sie an die Anschläge dachte, zog sich ihr Inneres zusammen, und es bildete sich ein dicker Kloß in ihrem Hals. Wie können Menschen Menschen so etwas nur antun? Das war es, was ihr vor allem zu schaffen machte. Wenn Menschen gehen mussten, weil sie alt oder krank waren, gehörte das zum Kreislauf des Lebens. Aber sie war schon immer zutiefst betroffen gewesen, wenn sie von Mord oder Krieg gehört oder gelesen hatte. War der Mensch dem Menschen wirklich ein Wolf? Wenn ja, warum? Warum gelang es der Menschheit nicht, endlich in Frieden miteinander zu leben?
„Mit Mama kann ich darüber nicht sprechen. Sie sagt, sie hält das nicht aus, es macht sie krank. Und ich will nicht, dass Mama krank wird!“ Marie fing nun richtig an zu weinen. Ihre zarten Schultern bebten unter den Schluchzern, die sich Bahn brachen.
Catharina konnte sich gut vorstellen, wie groß Maries Sorge war, ihre Mama könnte krank werden. Das Mädchen hatte im Rahmen der Trennung ihrer Eltern schon früh Verlusterfahrungen gemacht. Ihren Vater sah sie zwar noch recht häufig, musste ihn aber oft mit ihren Halbgeschwistern teilen, was ihr offensichtlich schwerfiel. Und ihre Mutter war vor einigen Jahren ernsthaft krank gewesen und hatte sich einer schwierigen Operation unterziehen müssen. Das hatte Katja Brandner ihr ziemlich am Anfang ihrer Bekanntschaft erzählt, als sie noch nicht sicher war, ob Marie sich alleine wohl bei Catharina fühlen würde. Marie hatte damals zwei Wochen bei ihrer Oma verbracht, die inzwischen allerdings auch verstorben war. Da war es nur natürlich, dass sie sich um das Wohlergehen ihrer Mama sorgte.
Eine Welle des Mitgefühls überkam Catharina. Wenn es sie als Erwachsene schon so ungeheuer mitnahm, diese Nachrichten zu sehen, wie mochte es sich dann für ein neunjähriges Kind anfühlen? Sie erinnerte sich noch dunkel daran, wie damals, in den 1970ern und 80ern, die RAF versuchte, Angst und Schrecken zu verbreiten, doch damals war sie bereits erwachsen gewesen und hatte diese Dinge ganz anders verarbeiten können.
„Habt ihr denn in der Schule mal darüber gesprochen? Vielleicht im Religionsunterricht?“ Doch bereits während sie die Frage formulierte, war sie sicher, die Antwort zu kennen. Und tatsächlich, Marie schüttelte den Kopf und sah sie tieftraurig an.
„Nur am Tag danach, da haben wir ganz kurz darüber gesprochen, mit meiner Klassenlehrerin. Aber dann haben wir gleich weiter Deutsch gemacht, eine Personenbeschreibung über einen Bankräuber, pah!“ Marie verdrehte unglücklich die Augen.
Catharina war nicht überrascht. Leider. Sie kannte den Schulbetrieb noch allzu gut, wusste, wie einem als Lehrkraft ständig der Lehrplan im Nacken saß, konkreter noch das aktuelle Schulbuch, das es innerhalb eines Schuljahres durchzuhecheln galt.
Dabei wäre es so wichtig, den Kindern und Jugendlichen in einem geschützten Rahmen die Möglichkeit zu geben, ein solches kollektives Trauma, und das war es, was die Anschläge vom September bewirkt hatten, wenn schon nicht aufzuarbeiten, dann zumindest zu bearbeiten.
„Wenn du möchtest, meine liebe Marie, kannst du gerne mit mir darüber sprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dazu Dinge sagen kann, die wirklich helfen, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen.“
In Maries Blick zeichnete sich noch immer deutlich Trauer ab, doch diese vermischte sich bei Catharinas Worten mit einem Anflug von Erleichterung.
„Ich muss immer daran denken, was du über die verlaufenen Seelen gesagt hast. Die Leute, die sowas machen, müssen sich doch so sehr verlaufen haben, dass es fast schon so ist, wie wenn sie wirklich böse wären.“
„Ja, es wirkt fast so, aber …“
„Ich weiß schon, du glaubst nicht daran, dass jemand wirklich böse ist. Aber wenn die nicht böse waren, dann kapier’ ich einfach nicht, wieso die mit zwei Flugzeugen mit so vielen Leuten in Häuser fliegen konnten. Außer, sie waren total dumm und haben gar nicht verstanden, was sie da machen, so, wie wenn sie Computer spielen würden.“
Was sollte Catharina darauf nur entgegnen? Ihr ging es ja ganz ähnlich wie Marie. Ja, sie war jemand, der eigentlich immer an das Gute im Menschen glaubte. Sie war immer davon überzeugt gewesen, dass der Mensch sich im Grunde seines Herzens nach Liebe sehnt, dass Hass nur dann entstehen kann, wenn ein Mensch so oft und so schwerwiegend in seinem Leben verletzt wurde, dass er sich verläuft und sich schließlich, statt der Liebe weiter nachzulaufen, die ihn so oft enttäuscht hat, davon abwendet.
Aber die jüngsten Ereignisse hatten auch ihr Vertrauen tief erschüttert.
„So richtig verstehe ich es auch nicht, liebe Marie. Ich kann mir nur vorstellen, dass diese Menschen so verzweifelt waren, dass sie sich nicht mehr anders zu helfen wussten.“
Stimmte das? Konnte man von Verzweiflung sprechen oder war eben doch abgrundtiefer Hass am Werke? Catharina musste sich eingestehen, dass ihr Weltbild in letzter Zeit ins Wanken geraten war, wenngleich sie sich dagegen sträubte.
„Ich wünsche mir so doll, dass alle Menschen einfach Freunde sind!“
Catharina war gerührt von diesem kindlichen Stoßseufzer und spürte zugleich, dass Marie ihr, wieder einmal, aus der Seele sprach.
„Ich auch, meine Süße, ich auch. Und zum Glück viele andere Menschen auch. Wir sollten unseren Wunsch ganz doll festhalten und immer wieder erneuern und so gut es geht versuchen, uns selbst daran zu halten.“
„Du meinst, nicht streiten, oder?“
„Ja, genau, meine Süße. Nicht streiten. Denn damit fängt es in der Regel ja an.“
Marie rutschte von der Küchenbank herunter, verließ die Küche und verschwand einen Moment. Catharina hörte ihre Schritte im Flur, doch sie hörte auch, dass Marie nicht die Badezimmertür öffnete, sondern offenbar in Richtung Wohnzimmer unterwegs war. Einen Augenblick lang hörte sie gar nichts mehr, dann bewegten sich die Schritte wieder in Richtung Küche.
Als Marie um die Ecke bog, hielt sie etwas in den Händen. Es war eine mittelgroße Leinwand, die farbig grundiert und auf der eine Art Mantra zu lesen war. Catharina hatte diese Leinwand einige Jahre zuvor gestaltet. Eine Zeit lang hatte sie mit recht konkreter Kunst experimentiert und häufig kurze Gedichte oder Haikus auf einer einfach grundierten Leinwand festgehalten. Sie brauchte nur einen flüchtigen Blick auf die Leinwand zu werfen, die Marie mitgebracht hatte, um zu wissen, um welche es sich handelte.
Jeden Tag ein Stück vom Glück
ein wenig Dankbarkeit
und etwas Demut.
Und jeden Tag ein kleines Licht
in die Welt tragen,
eine Kerze anzünden,
anstatt eine auszulöschen.
Das wäre schon was.
Jeden Tag darauf vertrauen,
dass es richtig ist,
ein Lächeln pflanzen,
Liebe säen.
Das wäre schon was.
Mehr noch.
Das ist
schon
viel.
„Das ist mir gerade eingefallen, und als ich daran gedacht habe, ist ein bisschen was von meiner Traurigkeit weggeflogen.“ Marie legte die Leinwand vor ihnen auf den Küchentisch und rutschte wieder neben Catharina auf die Bank.
Catharina war erstaunt, sie hatte nicht damit gerechnet, dass dieser kurze Text ein Kind ansprechen würde. Doch dann musste sie wieder einmal über sich selber lächeln. Natürlich, das hier war ja auch nicht irgendein Kind. Es war Marie, die außergewöhnliche, liebenswerte und kluge kleine Marie.
„Wirklich? Es hat ein bisschen was von deiner Traurigkeit verscheucht? Das ist ja wunderbar!“ Marie sah tatsächlich ein klein bisschen fröhlicher, zumindest ruhiger, aus als zuvor. Die Kummerfältchen zeichneten sich nicht mehr ganz so deutlich ab, und es kullerten auch keine weiteren Tränen die leicht geröteten Wangen herab.
„Wenn du möchtest, kannst du es gerne mitnehmen. Ich weiß zwar nicht, ob es irgendwo in deinem Zimmer Platz hat, aber von mir aus darfst du es gerne haben.“
Maries Augen wurden groß vor Erstaunen.
„Wirklich? Ich darf es haben? Aber was ist dann mit dir? Brauchst du es nicht, um die Traurigkeit zu verscheuchen?“
„Es ist sehr lieb, dass du fragst, meine Süße. Aber nein, ich denke, ich brauche es nicht mehr. Ich habe es ja ziemlich lange hier gehabt, und es ist tief in mir verankert. Und falls ich doch wieder Sehnsucht danach bekommen sollte, dann kann ich ja einfach ein neues machen.“
„Oder bei uns klingeln und das hier anschauen!“
„Genau, oder so!“
Erst jetzt fiel Catharina ein, dass Maries Mutter eventuell weniger begeistert von Maries neuer Errungenschaft sein könnte. Sie wusste, dass Katja Brandner nicht immer angetan von Catharinas Ansichten war. Im vergangenen Jahr hatte sie einmal recht deutlich durchblicken lassen, dass ihr einiges, von dem, worüber Catharina und Marie sich unterhielten, doch etwas esoterisch, wenn nicht gar sektiererisch, vorkam. Aber es war zu spät, das Geschenk jetzt wieder zurückzunehmen, oder nicht?
„Hör mal, Marie. Vielleicht fragst du erst deine Mama, ob es in Ordnung ist, wenn du das mitnimmst?“
Marie sah sie verständnislos an.
„Naja, weißt du, vielleicht gefällt es ihr nicht so gut wie dir, und sie möchte es in deinem Zimmer nicht sehen.“
„Dann braucht sie es ja nicht anzugucken. Ich mag auch nicht alle von Mamas Bildern. Vor allem das nicht mit diesen komischen Tieren mit den viel zu dünnen Beinen!“ Man konnte Marie ihre Abneigung gegen das Bild regelrecht anhören, und Catharina vermutete, dass sie von Katjas Kunstdruck von Dalis The Temptation of St. Anthony sprach.
Und was nun? Catharina überlegte, ob sie Marie irgendwie dazu bewegen konnte, die Leinwand doch bei ihr zu lassen.
„Außerdem mag Mama es nicht, wenn ich traurig bin. Wenn ich ihr sage, dass mir das hier hilft“, sie tippte auf die Leinwand, „dann darf ich es sicher behalten.“
Catharina kam ein rettender Einfall.
„Wie wäre es damit: Du nimmst es heute sozusagen probeweise mit und fragst deine Mama, ob es in Ordnung ist, wenn du es behältst. Wenn sie ja sagt, kannst du es behalten. Wenn es ihr ganz und gar nicht gefällt, bringst du es wieder her, und wir machen ein Foto davon. Das kannst du dann auf jeden Fall mitnehmen, es ist dann nur eben nicht so groß wie das hier“, sie zeigte auf das Original.
Marie kräuselte erneut ein wenig die Nase, offensichtlich war sie mit diesem Vorschlag nicht ganz glücklich.
Doch dann hellte sich ihr kleines Gesicht wieder auf, und sie sagte: „Aber nur, wenn wir Mamas doofe langbeinige Tiere dann auch fotografieren und das Bild aus dem Wohnzimmer wegschaffen.“
Catharina riss sich zusammen, um nicht zu laut aufzulachen. Sie kannte Maries stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und konnte nicht umhin, Marie innerlich zuzustimmen. Im Grunde hatte sie ja recht. Hoffentlich lässt Katja ihre Tochter die Leinwand einfach behalten, sonst kann ich mich auf eine heftige Diskussion gefasst machen, schoss es ihr durch den Kopf. „Abgemacht, wobei das natürlich trotzdem nur funktioniert, wenn Katja auch einverstanden ist“, war hingegen, was sie laut aussprach. Diesmal rümpfte Marie die Nase regelrecht und stemmte die Hände in die schmalen Hüften, ein deutliches Zeichen ihrer Empörung.
Catharina rechnete damit, dass Marie jeden Moment anfangen würde zu protestieren und überlegte schon, mit welchen Argumenten sie ihre kleine Freundin wieder würde beruhigen können.
Doch es kam anders.
Maries Gesicht entspannte sich wieder, sie lockerte die Protestgeste und fing stattdessen an, an der Stelle weiter zu malen, wo sie vor geraumer Zeit aufgehört hatte. Unwillkürlich zog Catharina vor Verwunderung die linke Augenbraue in die Höhe, eine typische Reaktion, die sie kaum steuern konnte. Nanu, damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dachte sie, ohne es zu wollen.
Schließlich begann Marie wieder zu sprechen.
„In Ordnung. Eigentlich kann Mama mir ja auch leid tun.“
Catharinas Verwunderung wuchs weiter.
„So? Warum denn das?“
„Ich glaube nicht, dass diese langbeinigen Viecher es schaffen, ihre Traurigkeit zu verscheuchen. Im Gegenteil, wenn man sie lange anschaut, wird einem ganz komisch zumute und man bekommt schlechte Laune... ich zumindest. Deshalb mag ich sie ja auch nicht.“
Im nächsten Augenblick klopfte Marie sich erst mit der rechten Hand auf die linke Schulter, anschließend mit der linken Hand auf die rechte Schulter, ein Ritual, das sie von Catharina übernommen hatte.
Catharina verstand die Geste sofort: „Du hast völlig recht, meine Süße. Ich finde auch, das ist ein triftiger Grund, dir selbst auf die Schulter zu klopfen.“
Marie nickte. „Ja, erst wollte ich schon anfangen mit dir zu streiten, zur Probe, damit ich dann für den Streit mit Mama schon weiß, was ich sagen kann. Aber dann habe ich es mir anders überlegt. Ich will lieber friedlich sein, dann ist es mit Mama viel schöner.“ Es grenzt wirklich an ein Wunder, wie dieser kleine große Mensch mich immer wieder verblüfft.
Marie kam an diesem Nachmittag nicht mehr zurück, was zweierlei bedeuten konnte: Entweder hatte sie Katja die Leinwand doch nicht gezeigt, oder sie durfte sie behalten.
Stattdessen klingelte am frühen Abend das Telefon.
„Freudenberg?“
„Hallo Catharina, ich bin’s, Katja.“ Die Stimme von Maries Mutter klang entspannt, beinahe fröhlich, was nach einem langen Arbeitstag im Feinkostladen um die Ecke nicht immer der Fall war.
„Katja, hallo, wie geht es dir?“
„Oh, alles okay soweit. Ich wollte mich eigentlich auch nur kurz erkundigen, ob Marie diese Leinwand wirklich behalten darf.“
„Von mir aus darf sie das gerne, ich hatte sie nur gebeten, dich erst zu fragen, ob du einverstanden bist.“ Catharina rechnete halb und halb damit, dass Katja das Gedicht abschätzig kommentieren würde.
„Tja, meine Tochter hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass dieses… „Kunstwerk““, das Wort ging ihr in diesem Zusammenhang offensichtlich schwer über die Lippen, „für sie den gleichen, wenn nicht einen höheren Stellenwert hat wie für mich der Dali-Kunstdruck, den ich so liebe.“
„Oh“, Catharina wusste nicht genau, was sie erwidern sollte, doch Katja sprach gleich weiter.
„Genauer gesagt, hat mir meine kleine Madame mitgeteilt, dass dein Bild sie glücklich macht, mein Kunstdruck ihr dagegen schlechte Laune.“ Catharina war überrascht, am anderen Ende statt Verärgerung auf einmal ein Lachen zu hören.
„Die „hässlichen langbeinigen Viecher und der dürre nackte Kerl“ hat sie es genannt. Ich muss sagen, der Titel klingt definitiv peppiger als die Versuchung des Sankt Antonius.“ Hörte Catharina richtig? Katja schien tatsächlich vor Lachen zu glucksen. Als sie sich etwas beruhigt hatte, fuhr sie fort: „Damit nicht genug, sie hat sich vor mir aufgebaut, mich vollkommen ernst angeschaut und meinte: „Ich möchte nicht mit dir streiten Mama, ich finde, wir sollten uns friedlich über unsere Bilder einigen. Ich schlage vor, ich behalte meins und du deins und wir schauen einfach nicht hin, wenn wir das andere nicht sehen wollen.“ Ist das denn zu glauben?“
Oh ja, wenn man Marie so gut kannte wie Catharina, war das sehr leicht zu glauben. „Jedenfalls wollte ich mich bei dir bedanken, Catharina. Ich weiß zwar nicht genau, warum Marie dieses Bild so wichtig ist, aber sie wirkte heute ausgeglichener als in den vergangenen Wochen. Wenn dieses Bild das bewirkt, dann soll sie es meinetwegen behalten. Also danke dafür.“
Jeden Tag ein Stück vom Glück, dachte Catharina, als sie das Telefongespräch beendet hatten. So fröhlich und ausgeglichen hatte sie auch Katja in letzter Zeit selten erlebt, schon wieder ein Stück vom Glück, danke.