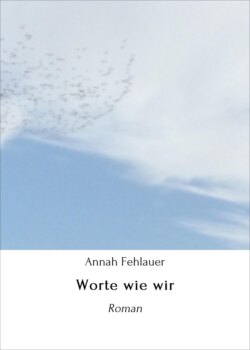Читать книгу Worte wie wir - Annah Fehlauer - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
...5...
Оглавление„Warst du nicht mal Lehrerin?“ Marie sah Catharina fragend und ein wenig kritisch an.
„Stimmt, das war ich“
„Aber jetzt bist du keine mehr.“
„Nein. Jedenfalls arbeite ich nicht mehr in einer normalen Schule.“
Nach einer kleinen Pause ertönte Maries Stimme wieder: „Wurdest du rausgeschmissen?“
„Nein, Marie, ich wurde nicht rausgeschmissen. Ich bin freiwillig gegangen.“
„Warum? Haben die Schüler dich so doll geärgert?“
„Nein, gar nicht. Ich meine, natürlich gab es immer wieder mal Schüler, mit denen es ein bisschen schwierig war, aber im Großen und Ganzen habe ich mich sehr gut mit meinen Schülern verstanden. Und den Schülerinnen natürlich.“
„Und wieso gehst du jetzt nicht mehr in die Schule?“
„Weil ich irgendwann gemerkt habe, dass das nicht mehr für mich passt.“
„So wie mit Martin?“
Catharina musste lachen und verschluckte sich dabei beinahe an ihrem Tee.
„Naja, so ähnlich. Nur aus anderen Gründen. Du hast übrigens ein tolles Gedächtnis, meine Süße.“
„Vielleicht gehe ich auch einfach nicht mehr in die Schule.“ Marie schien laut zu denken.
„Warum möchtest du denn nicht mehr in die Schule gehen, meine Süße?“
„Weil wir so viel doofe Sachen lernen müssen. Und soooo viel Hausaufgaben aufbekommen. Und weil meine Deutschlehrerin so doof ist.“
„Na siehst du, da sind unsere Schwierigkeiten mit der Schule gar nicht so verschieden. Ich hatte auch irgendwann ein großes Problem damit, dass ich den Schülern so viele Sachen beibringen musste, die ich gar nicht so richtig wichtig fand.“ Und so wenig von dem beibringen durfte, was ich für wirklich wichtig halte. „Und so viele Hausaufgaben aufgeben musste.“
„Und warum hast du ihnen nicht einfach andere Sachen beigebracht und keine Hausaufgaben aufgegeben?“
„Das ist gar nicht so einfach, Marie. Ich habe es immer wieder versucht, aber ich bin auch immer wieder gescheitert. Es gibt ziemlich viele Regeln für Lehrer. Und eine davon besagt, dass man den Schülern das beibringen muss, was von bestimmten Leuten vorgegeben wird.“
„Was sind denn das für Leute?“
„Nun, es sind Leute, die der Ansicht sind, sie wissen, was gut und richtig und wichtig für Kinder ist zu lernen.“
„Lehrer und Eltern?“
„Es sind wohl auch ein paar Lehrer und Eltern dabei. Vor allem sind es aber Politiker und manchmal auch Leute, die in der Wirtschaft arbeiten.“
„Dann kann mein Papa also auch mitbestimmen? Der arbeitet doch auch in der Wirtschaft.“ Soweit Catharina wusste, war Maries Vater Bauingenieur und vornehmlich auf Brückenbau spezialisiert.
„Ich glaube eher nicht, dass dein Papa da mitreden darf. Es sind Leute, die indirekt von vielen Menschen gewählt wurden und deren Partei dann bestimmt hat, dass sie im Bereich Schulbildung arbeiten sollen. Weißt du, was eine politische Partei ist?“
„Ja, ich glaub schon. Aber ich verstehe nicht, warum die bestimmen, wer über die Schulaufgaben bestimmen soll. Warum machen das denn nicht die Kinder und meinetwegen die Eltern? Und die Lehrer, wenn’s unbedingt sein muss?“
„Die Kinder wissen ja gar nicht, was es alles so zu lernen und zu wissen gibt. Und außerdem sind viele Erwachsene der Meinung, wenn die Kinder sich aussuchen dürften, was und wie und wann sie lernen, würden sie einfach gar nichts mehr lernen.“
„So ein Quatsch.“
Catharina lachte laut auf, als sie die Empörung in Maries Stimme wahrnahm.
„Ja, ich finde auch, dass das sicherlich nicht stimmt. Und es gibt auch durchaus Schulen, die ein bisschen so funktionieren, dass die Kinder sich aussuchen dürfen, was und wie viel und so weiter sie lernen wollen. Jedenfalls innerhalb eines bestimmten Rahmens.“
„Was sind denn das für Schulen? Und warum sind nicht alle so? Kann ich auch auf so eine Schule gehen?“
„Das sind meist so genannte freie Schulen. Und es sind nicht alle Schulen so, weil es eben sehr viele Leute gibt, denen diese Idee gar nicht geheuer ist. Und ja, theoretisch könntest du auch auf eine solche Schule gehen. Es ist nur so, dass diese Schulen ziemlich viel Geld kosten. Die Schule, die du besuchst, kostet auch Geld, aber das muss nicht deine Mama zahlen und auch nicht dein Papa, sondern es zahlen sozusagen alle Menschen zusammen, die in Deutschland leben. Denn Schulen wie deine, die man „öffentliche“ oder „staatliche“ Schulen nennt, werden aus den Steuern bezahlt. Und Steuern zahlt jeder Erwachsene, der in Deutschland arbeitet.“
„Und wer bezahlt das Geld für diese anderen Schulen, die, in denen man lernen kann, was man will?“
„Ein kleiner Teil wird auch aus den Steuern bezahlt. Aber der größere Teil wird von den Eltern der Kinder direkt bezahlt, die diese Schulen besuchen. Und ganz frei kann man auch nicht entscheiden, was man dort lernen will. Aber sagen wir mal, das Angebot dort ist etwas größer. Du könntest dich zum Beispiel entscheiden, ob du an einem Vormittag lieber Mathe oder Deutsch machen möchtest. Aber zum Beispiel Gummitwist-Unterricht gibt es auch an einer solchen freien Schule nicht.“
„Heißt das, es gibt da die gleichen Fächer wie an meiner Schule auch, und ich kann nur die Reihenfolge der Fächer wählen?“
„So ungefähr. Und man kann mehr auswählen, wie viel Zeit man für eine Aufgabe braucht, und es gibt auch noch ein paar weitere Dinge, die anders sind, als an deiner Schule.“
„Und warum arbeitest du nicht an so einer Schule? Könntest du da den Kindern nicht all das beibringen, was du wichtig findest, und die Hausaufgaben weglassen?“
„Tja, weißt du, meine Süße, ganz so leicht ist es eben doch nicht. Wie gesagt, man hat dort etwas andere Bedingungen. Aber das, was die Kinder dort lernen sollen, ist insgesamt doch recht ähnlich wie das, was die Kinder an deiner Schule lernen. Oft kann man dort ein bisschen kreativer sein, mehr spielen, mehr malen, mehr basteln und tüfteln und so weiter, aber letztlich muss man auch dort Vokabeln pauken oder Rechtschreibung. Und auch an einer solchen Schule wäre es nicht gerne gesehen, wenn ich über Dinge wie Licht und Liebe und belastende Energien mit den Kindern sprechen würde, so wie ich es mit dir tue.“
„Und warum nicht?“
„Weil eine ganze Menge Menschen der Meinung sind, das alles ist Blödsinn.“
„Aber das ist es doch nicht, oder?“
„Nein, das ist es nicht. Ich finde es sogar sehr wichtig. So wichtig eben, dass ich finde, eigentlich sollten alle Menschen etwas darüber wissen. Aber die Leute, die bestimmen, was in der Schule gelernt werden soll, sind da anderer Ansicht, die allermeisten jedenfalls.“
„Und könnte ich nicht einfach hierher zu dir kommen, so wie ich es sowieso schon manchmal mache, nur eben öfter, und dann würdest du mir solche Sachen erzählen und ich könnte aussuchen, ob ich davon was lernen oder lieber Apfelkuchen backen oder malen möchte?“
„Das geht leider nicht, Marie. Denn bei uns hier in Deutschland gibt es etwas, was sich Schulpflicht nennt. Und das bedeutet, dass jedes Kind bis zu einem bestimmten Alter in die Schule gehen muss.“
„Das finde ich total doof, ich will lieber zu dir kommen als in die Schule zu gehen.“
„Das ehrt mich sehr, und ich finde es auch wunderbar, wenn du mich besuchen kommst. Trotzdem hat die Schulpflicht eigentlich auch etwas Gutes. Erstens bedeutet diese Pflicht ja umgekehrt auch, dass man überhaupt in die Schule gehen darf, ist also auch ein Recht, ein ganz wichtiges Recht sogar. Du weißt sicher, dass es ziemlich viele Länder auf der Erde gibt, in denen die meisten Kinder eben nicht in die Schule gehen können, entweder weil es nicht genügend Schulen gibt oder manchmal auch, weil die Eltern es ihnen verbieten. Das ist zum Beispiel in einigen Ländern vor allem bei Mädchen manchmal der Fall.
Und zweitens würde es ansonsten wahrscheinlich auch vorkommen, dass Eltern ihren Kindern Dinge beibringen, die wir ganz schlimm finden. Dass es zum Beispiel in Ordnung ist, anderen mit Gewalt zu begegnen, zu lügen, zu schlagen, zu stehlen und so weiter.“
„Gibt es diese Schulrechtspflicht also nicht in allen Ländern?“
„Nein, in erstaunlich vielen gibt es das nicht.“
„Und wo lernen die Kinder dort dann all die Dinge, die wir in der Schule lernen müssen?“
„Nicht alle Kinder lernen diese Dinge überhaupt. Wie gesagt, ich habe durchaus auch so meine Bedenken, ob das, was wir unseren Kindern als wichtig beibringen, wirklich so wichtig ist. Aber soweit ich weiß, wird das, was ich für wichtig halten würde, überhaupt nur von recht wenigen Menschen für wichtig angesehen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es zum Beispiel in Indien ein paar Kinder gibt, denen so etwas beigebracht wird.“
„Wieso ausgerechnet in Indien?“
„Weil viele Menschen in Indien nicht so sehr an Dinge wie Geld und schnelle Autos und so weiter denken wie bei uns, sondern sich eher damit beschäftigen, was sonst noch ein gutes Leben ausmacht. Andererseits gibt es auch in Indien vieles, womit ich gar nicht einverstanden bin.“
„Zum Beispiel?“ Marie pulte mit dem Zeigefinger gedankenverloren in der Tischplatte herum.
„Zum Beispiel, dass Mädchen dort viel weniger wert sind als Jungs. Das meinen dort jedenfalls viele Menschen.“
Marie sah sie ungläubig an. „Wieso denn das? Das ist ja bescheuert.“
„Ja, ich finde es auch ganz schön bescheuert. Eine andere Sache, mit der ich gar nicht einverstanden bin, ist, dass in Indien viele Menschen überhaupt der Ansicht sind, dass Menschen unterschiedlich viel wert sind und sie in verschiedene Schubladen, so genannte Kasten, einsortieren.“
„Und dann müssen die Leute in dem einen Kasten drin bleiben, in den man sie gesteckt hat? In so einem Kasten kann man doch gar nicht richtig leben!“
Catharina lachte auf. „Das ist nicht ganz so ein Kasten, wie du ihn dir vorstellst, meine Süße. Es heißt übrigens in diesem Fall auch „die Kaste“, nicht „der Kasten“, und damit ist gemeint, dass der Mensch zu einer bestimmten Sorte gezählt wird. Und eine dieser Sorten oder „Kasten“ nennt sich die Kaste der „Unberührbaren“. Das finde ich das schlimmste daran, denn die anderen Menschen sind tatsächlich der Meinung, dass sie mit diesen Menschen keinen Kontakt haben, ja sie nicht einmal berühren, sollten.“
„Na, dann bin ich aber beruhigt.“
Dieses Mal war es an Catharina, ihr Gegenüber fragend und ungläubig anzusehen.
„Weil du dann bestimmt nicht nach Indien gehst, weil du nicht einverstanden mit den unberührbaren Kastenmenschen bist.
Und das ist gut, weil du dann vielleicht hier bleibst.“
Sie betrachtete betont konzentriert das kleine Loch in der Tischplatte, in dem sie seit geraumer Zeit herumpulte.
„Und ich dann weiterhin hier bei dir sein kann“, hörte Catharina sie sehr viel leiser als zuvor murmeln.
„Ja, das ist natürlich wahr, meine Süße“, beruhigte sie ihre kleine Freundin und fuhr ihr liebevoll über den Kopf.
„Aber sag mal, arbeitest du denn gar nichts mehr?“
„Doch Marie, ich arbeite schon noch. Nicht so viel wie die meisten anderen Menschen, und zu etwas unregelmäßigeren Zeiten, aber doch, ja, ich arbeite.“
„Was denn?“
„Zum einen gebe ich hier zuhause privat Nachhilfe.“
„Oh.“
Marie sah seltsam befremdet aus.
„Was ist los, meine Süße? Weißt du, was mit Nachhilfe gemeint ist?“
„Ja.“ Das Mädchen malte mit dem Zeigefinger ein unsichtbares Bild auf den Küchentisch.
„Das ist Schule für Doofe. Das sagt Lou immer.“
„Da hat Lou ausnahmsweise mal unrecht. Das kannst du ihr gerne ausrichten. Das hat überhaupt nichts mit Doofsein oder Dummheit zu tun, sondern es gibt einfach Kinder, denen das Lernen in der Schule nicht ganz so leicht fällt wie anderen, und die ein bisschen zusätzliche Unterstützung brauchen. Manchmal ist es auch so, dass für diese Kinder einfach zu viele Kinder in einem Klassenzimmer sitzen, dass es ihnen zu laut ist, um sich richtig konzentrieren zu können, oder dass sie die Lehrerin oder den Lehrer viel öfter etwas fragen können müssten, als sie das in ihrem normalen Unterricht können.“
Marie zog die Nase kraus. Sie sah nicht völlig überzeugt aus, doch Catharina beließ es dabei. Marie fuhr fort, ihr unsichtbares Bild zu malen.
„Und wann kommen die Nachhilfeleute?“
„Das ist ganz unterschiedlich. Die meisten können natürlich am besten nachmittags oder am frühen Abend, weil sie vormittags ja in der Schule sind. Ich habe aber auch einen Schüler, dem ich meist am Samstag oder Sonntag helfe.“
„Aber wenn ich bei dir bin, ist nie einer von denen hier.“
„Das stimmt. Das wäre ja auch ein bisschen schade, denn dann könnte ich mich weder richtig auf dich konzentrieren, noch auf die andere Person.“ Sie sah Marie liebevoll an. „Und das fänd ich fürchterlich traurig, weil ich unsere Gespräche doch so gerne mag.“
Bei diesen Worten fingen Maries Augen wieder an zu leuchten.
Doch dann schien ihr schon wieder ein Gedanke zu kommen, der sie beunruhigte.
„Aber das heißt ja, dass du an den Tagen, an denen ich hier bin, gar kein Geld verdienst. Brauchst du das denn nicht zum Leben?“
Marie wusste genau, wie hart ihre Mutter arbeiten musste, um genügend Geld für ihrer beider Lebensunterhalt zu verdienen. Manchmal half Katja Brandner sogar am Samstag noch im Feinkostladen aus und nahm Marie dann dorthin mit.
Catharina sprach nicht besonders gern über Geld. Dass sie verhältnismäßig reich war, wusste außer Martin kaum jemand. Das lag weniger daran, dass sie es aktiv verheimlichte, sondern vielmehr daran, dass sie eher bescheiden lebte. Sie fuhr ein inzwischen wirklich in die Tage gekommenes Auto, gab nicht übermäßig viel Geld für teure Kleidung aus, und machte auch keine Luxusreisen.
Ihr großer persönlicher Luxus bestand tatsächlich darin, ihre Arbeit inzwischen nach ihren Bedürfnissen ausrichten zu können, statt umgekehrt. Ihr war vollkommen bewusst, wie privilegiert sie dadurch war. Anstatt dies jedoch an die große Glocke zu hängen und damit vielleicht noch zu prahlen, genoss sie diese Freiheit still für sich und empfand täglich tiefe Dankbarkeit dafür.
Sie hatte bereits angefangen, Nachhilfe zu geben, als sie noch im staatlichen Schuldienst gearbeitet hatte und hatte dabei bald festgestellt, dass es ihr größere Freude bereitete, mit einzelnen Kindern zu arbeiten, als mit großen Gruppen, weil ihr dies erlaubte, viel intensiver auf die individuellen Bedürfnisse ihres jeweiligen Gegenübers einzugehen. Nachdem ihr Vater verstorben war, war es ihr auch finanziell möglich gewesen, den Schuldienst zu quittieren. Dann hatte sie angefangen, neben der privaten Nachhilfe, an ein oder zwei Vormittagen in einer Klinikschule zu unterrichten. Aus Formgründen war es nicht möglich, dies ehrenamtlich zu tun, weshalb sie kurzerhand ihren Lohn direkt wieder als Spende an die Klinikschule überwies.
Ihre dritte Arbeit aus Leidenschaft bestand darin, ein bis zweimal im Monat in einer Schule, in einem Kindergarten oder Altersheim, Geschichten zu erzählen. Sie war besonders auf alte griechische und römische Mythen spezialisiert, aber auch Märchen gehörten zu ihrem Repertoire und die ein oder andere moderne Erzählung. Und jedes Mal, wenn sie vor einer Zuhörerschaft ihre Geschichte erzählt hatte, war sie aufs Neue überwältigt von der Faszination, mit der man ihr zuhörte. Es stimmte ganz und gar nicht. Mündliches Erzählen war nicht überholt. Das Verlangen danach, das Verlangen der Zuhörer war so groß wie eh und je – nur gab es traurigerweise inzwischen kaum noch Erzählerinnen und Erzähler. Und jedes Mal dankte sie ihrem Schicksal dafür, dass es sie in die Lage versetzte, diese Rolle einzunehmen, die ihr mindestens ebenso große Freude bereitete wie ihren Zuhörern.
Die Idee dazu hatte sie schon gehabt, als sie noch als Lehrerin gearbeitet hatte, denn bereits damals hatte sie gemerkt, dass ihre Klassen, wann immer sie anfing, eine Geschichte zu erzählen, vollkommen gebannt und selig zuhörten – was im sonstigen Unterrichtsgeschehen Seltenheitswert hatte. Doch damals hatte ihr schlicht die Zeit und Kraft gefehlt, dies noch nebenher zu betreiben. Das war erst nach dem Austritt aus dem Schuldienst möglich geworden. Manchmal musste man eben etwas Altes beenden, damit etwas Neues entstehen konnte.
Bereits ihre Großeltern väterlicherseits waren recht betucht gewesen. Catharinas Vater war es im Laufe seines Lebens gelungen, das solide Familienerbe in ein nicht unbedeutendes Vermögen umzuwandeln. Die Familienvilla in Heidelberg hatte er als einziger Sohn geerbt, und bald nach seinem Wechsel nach Berlin als renommierter Herzspezialist und Chefarzt einer berühmten Privatklinik hatte er eine zweite Villa am Wannsee erworben.
Catharina war als einzige Tochter Prof. Dr. Franz-Ferdinand Düsterwegs und seiner Gattin Viktoria Catharina übrig geblieben. Ihr älterer Bruder, in alter Tradition Ferdinand nach seinem Vater benannt, hatte sich sehr früh das Leben genommen, ein Verlust, über den Catharina nie hinweggekommen war.
Ferdinand hatte keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Doch Catharina war sich sicher, dass sie das Motiv für seinen Freitod kannte. Ihr Bruder hatte sich dem Vater, beiden Eltern gegenüber, nie zur Wehr gesetzt. Er hatte die Schule mit Bestnoten absolviert, um dann ohne Diskussion dem Wunsch seines Vaters nachzukommen, Medizin zu studieren.
Doch Ferdinand konnte kein Blut sehen, und körperliche Nähe zu anderen Menschen hatte ihm schon als Kind Unbehagen verursacht. Der einzige Mensch, dessen Berührungen er ertrug, war seine jüngere Schwester. Er war ein begnadeter Violinist und hätte seine Leidenschaft sicherlich zum Beruf machen können, doch hatte er nie gewagt, dies auch nur in Erwägung zu ziehen.
Das Medizinstudium kostete Ferdinand große Mühe und tagtäglich Überwindung, und doch gelang es ihm, mit Hilfe seines übermenschlichen Ehrgeizes, sich durchzubeißen und auch das Studium als Bester seines Jahrgangs abzuschließen.
Der Preis dafür war jedoch beträchtlich. Catharina war überzeugt, ihr Bruder hatte schon Mitte Zwanzig ein ernstzunehmendes Alkoholproblem gehabt.
Doch sie kam nicht an ihn heran. Wann immer sie versuchte, mit ihm ins Gespräch zu kommen, über sein Studienziel oder sein Verhältnis zu Alkohol, war er ausgewichen. „Ich habe alles im Griff, Schwesterherz, kein Grund, dich zu sorgen.“
Doch gesorgt hatte Catharina sich, mit jedem Jahr, das verging, mehr. Denn von Jahr zu Jahr wurde er hagerer und hagerer, bis er mit Anfang Dreißig nur noch ein Schatten seiner selbst war. Er hielt noch so lange durch, bis er die Facharztprüfung ablegen konnte, in Kardiologie selbstredend.
Dass sein Sohn in seine Fußstapfen treten würde, war für Prof. Dr. Düsterweg eine derartige Selbstverständlichkeit wie für andere Menschen die Tatsache, dass die Erde sich um die Sonne dreht.
Catharinas Eltern, die sich zeit ihres Lebens nicht einen Fehler eingestanden hatten, blieben dabei: Ihr Sohn Ferdinand war tragisch verunglückt. Catharinas Bruder wusste genau, welch düsteres Licht es auf die Familie und damit auch auf den Ruf seines Vaters werfen würde, wenn sein Name in Verbindung mit Freitod gebracht würde. Noch im Abschiednehmen verhielt er sich seinen Eltern gegenüber respektvoll und, so schien es Catharina, gehorchte dem stummen ehernen Familiengesetz.
„Aufstrebender Herzspezialist stirbt bei tragischem Autounfall“, war damals in der Zeitung zu lesen gewesen. Dass der Wagen auf gerader Strecke bei besten Wetterbedingungen frontal und ohne Abbremsen gegen einen Baum geprallt war, blieb unerwähnt, sehr zur Erleichterung von Catharinas Eltern, die beste Beziehungen zum federführenden Reporter pflegten.
Catharina hatte ihren älteren Bruder geliebt und darunter gelitten, ihn so unglücklich zu sehen. Wirklich verstanden hatte sie ihn allerdings nie.
Waren sie und ihre Eltern einander schon vor Ferdinands Tod seltsam fremd gewesen, wuchs die Kluft zwischen ihnen danach ins Unermessliche.
Catharina konnte nur mutmaßen es gewesen wäre, in einem Elternhaus aufzuwachsen, in dem Eltern und Kinder einander liebevoll verbunden waren. Ihren Bruder vermisste sie zutiefst. Nur ganz allmählich war der Schmerz mit den Jahren etwas abgeebbt. Ganz verschwunden war er nie.
Sie hatte es Ferdinand nicht nachgetragen, dass er freiwillig gegangen war. Was sie ihm lange nachgetragen hatte, war die Tatsache, dass er sich nie gegen den stummen Druck des Elternhauses, die unausgesprochenen Zwänge, zur Wehr gesetzt hatte. Er hatte das Gesetz des Vaters ohne Kampf, ohne Protest, ja selbst ohne eine bloße einmalige Infragestellung eingehalten, nur um dann, Jahre später, unglücklich und alkoholabhängig zu kapitulieren.
Als Catharinas Vater starb, waren ihre Mutter und sie die einzigen Erben. Die zahlreichen Geliebten ihres Vaters gingen leer aus. Seiner Meinung nach hatten sie zu seinen Lebzeiten genug von ihm bekommen, ihn „ausgenommen wie eine Weihnachtsgans“ er selbst es abschätzig ausdrückte.
Seltsamerweise hatte Franz-Ferdinand aus seiner notorischen Untreue nie einen Hehl gemacht. Während der Freitod des eigenen Sohnes vertuscht wurde, wurden die zahllosen Affären Prof. Dr. Düsterwegs keineswegs unter den Teppich gekehrt. Möglicherweise hielt weder er noch seine Ehefrau sie für ehrenrührig, da sie seine Männlichkeit bezeugten.
An seinem Grab stehend, überkam Catharina ein vages Gefühl der Traurigkeit. Doch sie musste sich eingestehen, dass sich diese Traurigkeit ironischerweise weniger auf den Tod ihres Vaters bezog als auf das Gefühl, im Grunde nie einen wirklichen Vater gehabt zu haben, zumindest keinen, der seiner Tochter ein Gefühl von Liebe vermittelt hätte.
„Ich bin euer Erzeuger und Ernährer.“ Mehr als einmal hatte sie diesen Satz aus seinem Munde gehört.
Er hatte dabei nicht gelogen. Er war ihr Erzeuger und lange Zeit Ernährer. Nicht weniger, aber auch nicht mehr.
Catharina hatte sich später eine Zeit lang gefragt, ob sie wohl leichter gelernt hätte, die Nähe anderer Menschen auszuhalten, wenn die in ihrem Elternhaus gängige Währung nicht Geld, sondern Liebe gewesen wäre.
Doch irgendwann hatte ihr lebensbejahender Optimismus die Oberhand gewonnen. Es war es war. Es nutzte ja nichts, zurückzuschauen und sich zu fragen es anders hätte sein können. Letztlich hatte sie es ja doch gelernt, Nähe zuzulassen und Liebe zu empfinden, und dafür war sie zutiefst dankbar. Denn genauso gut hätte ihre Kindheit und Jugend dazu führen können, sie ebenso gefühlskalt werden zu lassen ihre Eltern es waren.
Prof. Dr. Düsterweg hinterließ eine äußerst gut betuchte Witwe und Tochter. Bei dem kleineren Teil des Erbes, das an Catharina ging, handelte es sich um eine Eigentumswohnung. Etwas befremdlich kam es Catharina schon vor, dass es die Mieteinkünfte dieser Immobilie waren, die bislang dafür verwendet worden waren, die wechselnden Gespielinnen ihres Vaters zu unterhalten, womit er selbst einige Jahre zuvor regelrecht geprahlt hatte. Andererseits wäre es ihrem pietätlosen Vater auch zuzutrauen gewesen, diese Wohnung seiner Ehegattin zu überschreiben, die sicherlich mit noch ambivalenteren Gefühlen darauf reagiert hätte als Catharina.
Einen Teil des verbleibenden, größeren Teils des Erbes investierte Catharina, um die Wohnung zu kaufen, die sie bis dahin gemietet hatte. Der Zufall wollte es, dass sie keine zwei Monate nach dem Ableben ihres Vaters ein Schreiben ihres Vermieters erhielt, der ihr mitteilte, aus Altersgründen wolle er die Wohnung verkaufen. Als langjährige Mieterin gewähre er ihr bei Interesse gerne das Erstkaufsrecht. Andernfalls übergebe er die Angelegenheit einem Makler zum Verkauf.
Catharina hatte nur einen Nachmittag lang gezögert und eine Nacht die Entscheidung überschlafen. In diesen Stunden hatte sie mit dem Gedanken gespielt, die Zelte in Deutschland abzubrechen und irgendwo, vorzugsweise im Süden und am Meerder aufzubauen. Doch diesen Gedanken hatte sie einstweilen wieder verworfen. Sie fühlte sich wohl in Berlin, so gut wie zuhause. Und wenn sie nun tatsächlich aufhören würde, in einer staatlichen Schule zu arbeiten, könnte sie beliebig häufig dennoch ans Meer und in den Süden fahren.
Die Wohnung zu kaufen ging sehr schnell. Bedeutend länger dauerte es, aus dem Beamtenwesen wieder auszutreten.
Freunde hatten den Kopf geschüttelt, Kollegen die Nase gerümpft, als sie davon erzählte, mit dem Gedanken zu spielen, aus dem Schuldienst auszutreten, allen voran ihr Lieblingskollege Andreas, der zugleich Personalrat an ihrer Schule war.
„Mensch Catharina, dit kannste doch nich machen. Jetz überleg’ doch mal. Die janze Sicherheit jeht doch flöten, die janzen Privilejien futsch. Sicher, verbeamteter Lehrer zu sein is’ nich immer n’ Zuckerschlecken. Aber denk doch och ma an deine Versorjungsbezüje, dit is doch denn allet futsch.“ Der einzige, der ihr Vorhaben gutgeheißen hatte, war Martin gewesen. Martin, der treu zu ihr hielt, ihr den Rücken stärkte und Mut zusprach, wenn sie ihn brauchte.
Catharina hatte sich schließlich dazu durchgerungen, sich vorerst als Beamtin für drei Jahre beurlauben zu lassen. Andreas hatte sie bekniet, es doch bei einem Jahr zu belassen, doch darauf ließ Catharina sich nicht ein. „Drei Jahre. Und wenn das gut geht, gebe ich meinen Beamtenstatus auf.“
Die drei Jahre waren gut gegangen. Natürlich hatte Andreas recht, auf die Privilegien, die sie als Beamtin genossen hatte, musste sie verzichten. Doch ihr großzügiges Erbe machte diesen Verzicht schmerzfrei.
Sie gab mehr Nachhilfe als zuvor, konnte mehr Zeit in ihre Kunst und ihr Schreiben investieren und hatte insgesamt das Gefühl, mehr Lebensqualität gewonnen zu haben.