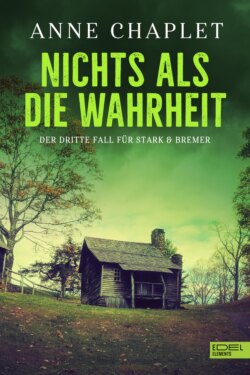Читать книгу Nichts als die Wahrheit - Anne Chaplet - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеBerlin
Fast hätte sie protestiert, als die Frau im schwarzen, wallenden Kleid an ihr vorbei durch die Tür drängen wollte. Aber dann sah sie deren Gesicht. Die Frau hatte rotgeweinte Augen, ihre Lippen zitterten. Anne blieb im Türrahmen stehen und hörte, wie sich die kurzen, stolpernden Schritte den Flur hinunter entfernten. Eigentlich hatte sie soeben das Zimmer betreten wollen – ihr Zimmer, wie sie geglaubt hatte. Sie trat einen Schritt zurück. Auf dem Schild draußen stand noch immer »Dr. Alexander Bunge«. Sie fühlte ein mulmiges Gefühl in sich aufsteigen – auf Schattenboxen war sie nicht eingestellt gewesen. Aber Bunges Schatten schien überall zu sein.
»Wir freuen uns, daß du da bist«, hatte Eva Seng während der Fraktionssitzung heute früh gesagt und dabei alles andere als freudig geguckt. »Du entschädigst uns für einen schweren Verlust...« Sie hatte getan, als ob ihr die Stimme bräche, theatralisch die Hand auf den Busen gelegt und in die Runde geguckt. Die meisten hatten stumm genickt und ernste Gesichter gemacht. Entweder, hatte Anne gedacht, vermissen sie ihn wirklich. Oder er ist ihnen so auf die Nerven gegangen, daß sie ihre klammheimliche Freude besonders heftig überspielen müssen.
Sie hatte ebenso ernst zurückgenickt. »Es fällt mir schwer, unter diesen tragischen Umständen mein Mandat anzutreten«, hörte sie sich zu ihrer Verblüffung salbungsvoll sagen. Schau an, hatte sie gedacht. Sie beherrschte das Spiel noch immer.
Bunges Büro – ihr Büro – sah unaufgeräumt aus. Über den Bildschirm auf dem Schreibtisch in der Mitte wogte ein grüner Bildschirmschoner in Gestalt eines Spruchbands, dessen Botschaft sie nicht entziffern konnte. Aus der Fülle der zusammengeknüllten Tempotaschentücher schloß sie, daß hier der Arbeitsplatz der Sekretärin war, die soeben vor ihr geflüchtet zu sein schien.
Anne betrat den Raum und machte die Tür hinter sich zu. Zwei Schreibtische standen hier, auf dem einen der eingeschaltete Computermonitor, der andere schien unbesetzt. An der Wand gegenüber vom Schreibtisch, an dem offenbar bis vor kurzem noch gearbeitet worden war, hingen Fotos, dutzendweise, manche im Rahmen, manche seitwärts darunter geklemmt. Als Anne näher trat, erkannte sie Bunge. Bunge mit einem Spaten und siegesgewissem Lächeln, Bunge auf einem Sektempfang, Bunge mit einem Helm auf dem Kopf, der vorn eine Lampe hatte. Bunge, der einen undefinierbaren Gegenstand triumphierend in die Kamera hielt. Bunge mit dem Außenminister, Bunge mit dem Kanzler, Bunge mit der Präsidentin. Bunge am Rednerpult. Bunge auf einer Wahlveranstaltung. Bunge allgegenwärtig.
Auf Anne wirkte der Anblick dieser Galerie von Heiligenbildern wie eine kalte Dusche. Kopfschüttelnd ging sie ins Zimmer nebenan. Die Vorhänge waren zugezogen, das Zimmer lag im Halbdunkel. Als sie das Deckenlicht anmachte, mußte sie die Augen zusammenkneifen. Dann sah sie das gerahmte Porträtfoto auf dem Schreibtisch in der Mitte des Raumes stehen: Alexander Bunge natürlich, versehen mit schwarzem Trauerflor, daneben eine Kerze, darunter Kondolenzkarten. Ein Strauß weißer Lilien verbreitete süßlichen Duft. Mit zwei Schritten war Anne beim Fenster, riß die Vorhänge zur Seite, öffnete alle Flügel und ließ Luft in den Raum.
Sie war gewarnt. Einen leichten Stand würde sie nicht haben.
Sie räumte die Kondolenzkarten zusammen und legte sie, zusammen mit dem Foto, der Sekretärin auf den Schreibtisch. Dann schloß sie die Tür zum Sekretariat hinter sich und sah sich um – in ihrem Zimmer. Das Bücherregal mußte leer geräumt werden. Auf den angestaubten Ficus in der Ecke konnte sie verzichten, ebenso auf den mit kackbraunem Kord bezogenen Sessel. Nur die große Karte an der Wand – eine Karte von Berlin, auf dem die jetzigen und künftigen Bauprojekte des Bundes eingezeichnet waren – wollte sie behalten.
Sie setzte sich auf den ihr entgegenfedernden, mit graumeliertem Stoff bezogenen Schreibtischstuhl und stützte das Kinn in die geballten Fäuste. Der Empfang war alles. andere als herzlich gewesen. Selbst schuld, dachte sie. Niemand hat dich gerufen.
Und niemand brauchte sie hier. Nur sie hatte geglaubt, sie sei sich und der Welt noch etwas schuldig. Nur sie hatte nicht versauern wollen in der Rhön. Sie hatte Leo nicht das letzte Wort lassen wollen – Gott hab ihn selig, den Stasispitzel. Anne legte den Kopf in die ausgebreiteten Hände. Was für eine Schwachsinnsidee. Der Kreisverband von Haslingen hatte sich auf sie nur eingelassen, weil der Parteivorstand ihre Kandidatur unterstützte. »Vergiß den alten Mist, Anne«, hatte Jupp damals zu ihr gesagt, als sie ihn nach seiner Meinung fragte. »Verlaß die selbstgewählte Verbannung. Wir haben viel zu wenige von deiner Sorte.« Beliebter machte solche Protektion nicht. »Wir sind doch kein Wohltätigkeitsverein für arme Stasi-opfer«, hatte ihr Linde Steinhauer vor der entscheidenden Abstimmung zugezischt.
Daß sie hernach im Wahlkampf mit äußerstem Einsatz dabeigewesen war, hatte auch nicht viel geholfen. »Ich versteh’ dein Engagement«, hatte Linde einmal spöttisch gesagt. »Eigeninteresse ist ein mächtiger Motor.« Genützt hatte es nichts. Mindestens das Ergebnis der letzten Bundestagswahlen hätte die Partei wieder einfahren müssen, damit Anne ins Parlament hätte einziehen können. Sie war nur knapp gescheitert. Bis vor kurzem war ihr das als verdienter Sieg in der Niederlage erschienen.
Das durchdringende Gedudel des Telefons ließ sie hochschrecken. Sie griff nach dem Hörer. »Ja?« sagte sie und schob hastig ein »Anne Burau« hinterher. Der Anrufer konnte ja nicht wissen, wer sie war. Dieser hier schien es zu wissen.
»Paß auf dich auf, Anne«, flüsterte eine körperlose Stimme. »Berlin ist nicht die Rhön.«
Dann wurde die Verbindung unterbrochen. Für einen Moment war sie überrascht, ach was: verängstigt. Und dann packte sie die Wut. Sollte sie aus ihrem Mandat gemobbt werden, bevor sie es überhaupt angetreten hatte? Laß dir nichts gefallen, dachte sie und ballte die Fäuste. Laß dich nicht einschüchtern. Nimm, was dir zusteht. Kämpfe. Oder, fügte eine innere Stimme spöttisch hinzu, hast du das mittlerweile verlernt?
Als sie auf die Uhr guckte, war es bereits nach zwei. Sie hatte noch nichts gegessen heute – aber dazu war es jetzt zu spät. Sie mußte ins Plenum. Das erste Mal nicht auf die Besuchertribüne, sondern aufs Parkett. Als freigewählte, unabhängige Volksvertreterin, der es egal sein konnte, was die Partei von ihr hielt – zumindestens für die nächsten drei Jahre.
»Nach mir die Sintflut«, sagte sie laut und erhob sich.
Sie ärgerte sich über die Unsicherheit, die man, glaubte sie fest, ihr ansehen mußte, als sie am Eingang zum Reichstag ihren Abgeordnetenausweis vorzeigte. Der Saaldiener im Frack, der sie in der Lobby empfing, war jung, die dunklen Haare glänzten gegelt, und mit Verwunderung registrierte sie den goldenen Ring in seinem Ohr.
»Sagen Sie mir Ihren Namen, und ab morgen werde ich Sie jeden Tag persönlich begrüßen!« sagte er und sah ihr konzentriert ins Gesicht.
»Anne Burau.« Sie mußte lächeln. »Und das soll ich Ihnen glauben?«
Der junge Mann hielt ihr die Hand hin. »Aber ja. Ich bin Walter – wenn mal was ist....
Vor der Tür zum Plenum stand eine Person, die ihr bekannt vorkam. Die hochgewachsene, dunkelhaarige Frau im eisblauen Blazer guckte durch die Glastür und tippte sich nervös mit dem Füllfederhalter gegen die großen weißen Vorderzähne. Sie hielt ihre Handtasche unter dem Arm, als ob es eine Kalaschnikoff wäre. Es war die Frau, mit der sie Peter Zettel hatte zusammenstehen sehen, damals, bei der Eröffnung des Reichstags. Die Frau hatte sich die Brille hoch und in die dichte dunkle Haarmähne geschoben. Anne beschloß, sie herzlich unsympathisch zu finden.
Die Fraktion war bereits versammelt, als sie den Plenarsaal betrat, über dem sich die Kuppel erhob, die in Windeseile zum neuen Wahrzeichen Berlins geworden war. Ihre Fraktion saß von hinten gesehen links von der Mitte des Halbrunds, in einer Art Keil, so daß vorn zwei Personen nebeneinander sitzen konnten und oben sechs. Unschlüssig blieb sie stehen. Zwei ihrer Kolleginnen telefonierten, einer las Zeitung, ein anderer Akten, zwei drehten sich zu ihr um, tuschelten, irgendwie vorwurfsvoll, wie ihr schien, und drehten sich wieder weg. Wie Kater, die ihren Rivalen die kalte Schulter zeigten, um Überlegenheit zu demonstrieren, dachte sie. Ein Saaldiener im schwarzen Frack kreuzte gemessenen Schritts den Bereich zwischen den vordersten Abgeordnetensesseln und dem Rednerpult und stellte ein Glas Wasser auf das Pult. Sie fühlte sich etwas verloren und ziemlich unerwünscht, bis Emre Özbay sich umdrehte und sie neben sich winkte.
»Das alles hat weniger mit dir zu tun, als du glaubst«, sagte er, als sie ihm von der tränenreichen Szene vor Bunges Büro erzählte – und von dem Heldenschrein. »Der Kollege Bunge war bei seinen Mitarbeitern sehr beliebt – und du kennst ja Sekretärinnen: Entweder geben sie alles, oder sie sabotieren dich, wo sie nur können.«
Anne erinnerte sich an diesen stillen Boykott aus ihrer Zeit in Kiel.
»Außerdem hatte Bunge seine feste Rolle und war deshalb für viele keine Konkurrenz mehr. Deshalb kann man ihm auch völlig authentisch nachtrauern.« Emre mußte ihrem Gesicht angesehen haben, daß sie soviel Zynismus nicht mehr gewohnt war, jedenfalls lachte er und legte ihr wieder die Hand auf den Arm.
»Und was man von dir erwarten kann, weiß keiner. Alle fürchten, du könntest deine schönen langen Finger ausgerechnet nach ihrem Steckenpferd ausstrecken.« Er grinste spöttisch. »Das fürchten vor allem die Frauen.«
Dann stand er plötzlich auf – wie alle anderen, was Anne zu spät bemerkte. Sie stand erst, als man sich um sie herum bereits wieder zu setzen begann.
»Du weißt doch: Wir stehen immer auf, wenn das Präsidium hereinkommt«, zischte Emre ihr zu. »Alte Sitte aus alten Zeiten.«
Hastig setzte auch sie sich wieder.
»Das ist so ziemlich das Maximum an guten Manieren, das du hier erwarten kannst.«
Sie nickte abwesend. Auf der Pressetribüne hatte sie Peters Freundin gesehen, deren eisblauer Blazer wie ein Fanal leuchtete inmitten der Riege der grauen und braunen Sakkoträger hinter und neben ihr. Nicht eifersüchtig sein, verordnete sie sich. Vor allem nicht auf so eine.
»Willst du Nachhilfeunterricht?« Emre stieß sie freundschaftlich in die Seite.
Sie nickte wieder.
»Das Wichtigste zuerst«, sagte er.
Sie versuchte, interessiert zu gucken.
»Geld – beziehungsweise: wie du es unter Garantie verlierst.«
Sie schüttelte den Kopf. »Hier?« Bundestagsabgeordnete waren nicht überbezahlt, aber mit Diäten und Kostenpauschale auch nicht gerade auf der Verliererstrecke.
»Genau hier. Paragraph 14.1 des Abgeordnetengesetzes: Bevor du den Plenarsaal betrittst, mußt du dich in die Anwesenheitsliste eintragen. Tust du das nicht, werden dir hundertfünfzig Mark von der monatlichen Kostenpauschale abgezogen.«
»Aha«, murmelte sie.
»Nur neunzig Mark kostet deine Abwesenheit, wenn du dich vorher entschuldigt hast. Und 75 Mark sind fällig, wenn du bei einer namentlichen Abstimmung fehlst. Deshalb verlassen unsere notorischen Trinker donnerstags abends immer so schlagartig die Bundestagsbar, wenn zur Abstimmung aufgerufen wird.« Emre guckte an ihr vorbei zum linken Rand des Plenarsaals.
»Siehst du die weißhaarige Frau dort oben in der grünen Bluse?«
Anne nickte.
»Bei der letzten Debatte über die Diätenerhöhung stand sie plötzlich empört da und behauptete, sie wisse gar nicht, worüber hier geredet werde. Sie erhalte mindestens dreitausend Mark im Monat weniger als das Abgeordnetengehalt plus Kostenpauschale, von dem hier immer die Rede sei.« Emre legte eine kunstvolle Pause ein.
»Du meinst...?« fragte Anne, um ihm den Gefallen zu tun.
Emre nickte. »Die Freifrau von Hoppenstedt hat jahrelang, jahrzehntelang nicht gewußt, daß sie sich in die Anwesenheitsliste hätte eintragen müssen und hat deshalb den Höchstsatz möglicher Strafen gezahlt.«
Anne schreckte auf, als der Gong ertönte. »Jetzt spricht der Performancekünstler mit den derzeit höchsten Lachwerten«, flüsterte Emre.
Der Abgeordnete der Oppositionspartei gab in der Tat ein beachtliches Schauspiel. Erst stützte er sich mit beiden Armen aufs Pult und wippte auf und ab. Dann begann er die Arme zu heben und mit den Händen schraubende Bewegungen zu machen. Dann ballte er die linke Hand zur Faust und durchschnitt mit der rechten die Luft, als ob er einen imaginären Gegner mit Handkantenschlägen erledigte. Schließlich hob er beide Fäuste und führte sie ruckartig aufeinander zu, wie ein Dirigent, wenn es dramatisch wurde. Zum Schluß seiner Rede glänzte Schweiß auf seiner Stirn. Anne hatte kein Wort verstanden und war dennoch tief beeindruckt.
Das Hohe Haus bot eine Menge fürs Auge. Bei der größeren der beiden Regierungsparteien hatte fast jede der gar nicht mal wenigen weiblichen Abgeordneten rot gefärbte Haare – ein leicht ins Schrille wanderndes Signalrot. Bei der größten der Oppositionsparteien bevorzugten die Damen pastellfarbene Blusen und Kostüme. In ihrer eigenen Fraktion erwiesen sich die Herren als modische Avantgarde des Hauses, die Frauen hatten ein Faible für enggeschnittene Hosen unter strengen Sakkos.
Je länger sie die Blicke durchs Plenum schweifen ließ, desto mehr bekannte Gesichter entdeckte sie – Politiker, die sie seit Jahren im Fernsehen gesehen hatte. Und jetzt gehörst du dazu, dachte sie mit einem seltsamen Gefühl in der Magengrube und merkte erst gar nicht, daß ein Saaldiener neben ihr stand. Verwirrt schaute sie auf. Es war Walter, der junge Mann mit dem Ring im Ohr, der sie vorhin nach ihrem Namen gefragt hatte.
Er hielt ihr eine Visitenkarte hin und flüsterte: »Sie werden in die Lobby gebeten.«
Fragend guckte sie zu Emre hinüber, der spöttisch nickte. »Siehst du – es geht schon los.«
»Was geht los?«
»Geh nur. Das wirst du gleich sehen.«
Als sie in die Lobby trat, sah sie sich einer unüberschaubaren Menge von Fernsehteams, Bildfotografen und jungen Menschen gegenüber, die ihr Schreibblock und Stift entgegenreckten. Nach ein paar Schrecksekunden zählte sie zwei Kameras, drei Fotografen und fünf Journalisten, die alle auf sie einredeten.
»Was sagen Sie zum Tod Ihres Vorgängers?«
»Werden Sie Alexander Bunges Aufgaben übernehmen?«
»Was meinen Sie – war es Selbstmord?«
Sie rückte die Beine ein bißchen auseinander und legte ihre Hände auf den Rücken, so daß niemand merken konnte, wie sie zitterten, als sie endlich antwortete. Dann senkte sie den Kopf, wie man es vor einer Horde unruhiger Bullen machen würde. Und redete von ihren Gefühlen. Von ihrer tiefen Bewunderung für Alexander Bunge, von der Trauer über seinen Verlust, vom Mitgefühl, das seiner Familie gebühre. Und ja, sie werde in der Baukommission seine Aufgaben übernehmen, ohne seinen Platz ausfüllen zu können. Und nein, sie könne sich bis heute nicht vorstellen, was an diesem schrecklichen Tag in Frankfurt wirklich passiert sei, sie warte, wie alle anderen auch, auf das Ergebnis der Ermittlungen. Und wie ein gut geölter Politikdarsteller hob sie zum Schluß ihrer Ausführungen beide Hände und bat um Verständnis dafür, daß sie nun wieder an die Arbeit müsse.
Als sie der Meute den Rücken zudrehte, atmete sie tief aus. Es gibt Dinge, dachte sie, die verlernt man nie. Diplomatische Verstellung gehörte dazu. Für einen Moment wußte sie nicht, ob sie das segensreich oder schade finden sollte.
Der Saaldiener hielt ihr bereits die Tür auf, als hinter ihr eine helle Stimme »Frau Burau?« rief. Sie drehte sich um und nickte, zögernd. Sie wollte bei der Abstimmung dabeisein.
»Das war eine gute Performance«, sagte die kleine blonde Frau mit dem Block in der Hand. Sie streckte ihr die Hand hin. »Lilly E. Meier.« Erwartete sie, daß ihr Name Anne etwas sagte?
Anne blickte auf die Uhr und deutete auf den Plenarsaal.
»Es dauert nicht lange«, sagte die Frau. »Ich soll ein Porträt über Sie schreiben – für das ›Journal‹.«
Anne merkte, wie ihr die Wärme ins Gesicht stieg. Sie hatte gedacht – sie hatte denken müssen... »Und – Peter...?« fragte sie, ohne zu überlegen.
Die andere lächelte gleichbleibend freundlich.
Anne korrigierte sich. »Sollte nicht Peter Zettel dieses Porträt schreiben? Er hat mir das schon vor einiger Zeit mitgeteilt, ich dachte nur...«
»Tut mir leid.« Lilly E. Meier schaute zu Boden. Sie hatte die dunkelblonden Locken streng gescheitelt und zurückgebürstet, was ihr Gesicht noch schmaler machte. »Sie müssen schon mit mir vorliebnehmen.«
»Aber...« Anne verstummte. Sie hatte, merkte sie plötzlich, fest damit gerechnet, ja, gehofft, Peter Zettel aus diesem Anlaß wiederzusehen.
»Sie sind hoffentlich nicht enttäuscht.« Die Journalistin sah noch immer nicht auf.
»Das nicht, aber...« Verdammt, Zettel, du Idiot, dachte Anne. Hättest du mich nicht vorwarnen können?
»Er hat immer so von Ihnen geschwärmt!« Lilly E. Meier hob den Kopf, lächelte ein völlig unschuldiges Lächeln und schien nicht zu ahnen, was sie mit dieser Bemerkung anrichtete.
Anne war für einen Moment sprachlos.
»Und wenn ich Sie so sehe – dann kann ich das gut verstehen!« Die Journalistin hatte ihren Mund spitzbübisch geschürzt.
Anne fühlte sich, als ob ihr jemand in den Magen geboxt hätte. Ein paar Sekunden lang wußte sie nicht, wen sie mehr hassen sollte: Die Frau, die da vor ihr stand und nicht zu wissen schien, was sie sagte. Oder Zettel.
Sie entschied sich für Peter, der sich mit ihr gebrüstet haben mußte. Mit einer Eroberung, mit der er, wie sie sich nur zu genau erinnerte, so gut wie nichts hatte anfangen können – oder wollen... Sie blickte in das freundliche Gesicht von Lilly Meier und fragte sich mit hochsteigender Übelkeit, was er wohl sonst noch erzählt haben mochte. Und wem. Bei diesem Gedanken wurde ihr kalt.
»Danke für das Kompliment, aber ich glaube, ich muß jetzt«, sagte sie mit aller Ruhe, die sie zustande brachte.
Die Journalistin nickte, griff in ihre Jacke, die innen eine Brusttasche hatte wie bei einem Männerjackett, drückte Anne eine Visitenkarte in die Hand und sagte: »Ich ruf bei Ihnen an, ja?«
Anne starrte erst auf das weiße Stück Pappe und dann der anderen hinterher. Sie hätte die Frau gern genauso unsympathisch gefunden wie ihre Kollegin – aber das gelang ihr nicht. Sie konnte ja nichts dafür. Sie war ja nur die Überbringerin der Botschaft. Statt dessen wünschte sich Anne mit Inbrunst, der Herrgott möge alle Männer mit größtmöglichem Verhängnis überziehen – vorsichtshalber alle, aber ganz besonders diejenigen, die in Anne Buraus Leben jemals eine Rolle gespielt hatten.
Im Plenarsaal stand gut die Hälfte der Abgeordneten, während die andere saß. Ihre Augen suchten nach Emre, der nicht zu sehen war. Wenigstens diesmal wollte sie nichts falsch machen und blieb stehen.
»Du hast soeben für den Antrag der Opposition gestimmt«, flüsterte Eva Seng mit eisiger Miene, als sie an ihr vorbei zu ihrem Platz ging. Anne merkte, wie ihr das Blut ins Gesicht stieg. Heute war wohl nicht ihr Tag.
Emre Özbay sah sie erwartungsvoll an, als sie wieder neben ihn geglitten war.
»Ist das immer so?« fragte sie, leicht atemlos.
»Du meinst die Überfälle der Journaille? Meistens. Aber vergiß nicht: Du brauchst ihre Unterstützung, auch wenn es alles Aasgeier sind. Du brauchst Rückhalt in der Öffentlichkeit – zuerst gegen die eigene Fraktion. Danach gegen die eigene Partei.«
Nach allem, was sie bislang erlebt hatte, leuchtete ihr diese Weisheit ein. Offenbar war es im Parlament wie im wirklichen Leben: Man trieb den Teufel mit dem Beelzebub aus.
Die Sehnsucht nach dem Weiherhof umfing sie wie ein warmer Herbstregen. Wäre nicht der Gedanke an Paul Bremers zweifelndes Gesicht gewesen, hätte sie dem Verlangen nach Stallgeruch und Mistforke nachgegeben und sich zurückgeträumt in die Rhön. Anne Burau schüttelte sich und richtete sich dann kerzengerade auf. Ich laß mich nicht kleinkriegen, dachte sie.