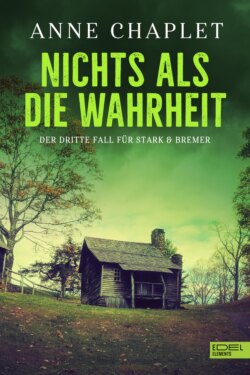Читать книгу Nichts als die Wahrheit - Anne Chaplet - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
ОглавлениеBerlin
Becker klopfte mit dem Bleistift auf den Block, der vor ihm auf dem Konferenztisch lag. Er haßte die morgendlichen Sitzungen, zu denen alle zu spät kamen – außer ihm. »Des Rätsels Lösung ist: Du kommst einfach zu früh, Hansi«, hatte Jo Eyring kürzlich behauptet, ihm betont sanft die Hand auf die Schulter gelegt und unverschämt gegrinst dabei. So konnte man es auch sehen, wenn man unbedingt wollte.
Durch die geöffnete Tür hörte er Isolde reden. Sie telefonierte immer noch so, als ob die Segnungen der digitalen Revolution nicht existierten und sie Entfernung mit Lautstärke ausgleichen müsse. »Das kann jeder passieren«, trompetete sie gerade. »Das haben wir alle mal gemacht. Eine Abtreibung...« Die Person am anderen Ende der Verbindung schien einen Einspruch zu wagen. »Ach was! Du nimmst ein Taxi, Annalena, und nach einer halben Stunde ist alles vorbei!«
Becker krümmte sich auf seinem Stuhl, stellvertretend für Annalena, die offenbar noch immer nicht begriffen hatte, daß ihr Schicksal zum Fortsetzungsroman für die gesamte Redaktion geworden war. Das hatte vor etwa drei Monaten damit angefangen, daß Annalena über den lustlosen Sex mit ihrem Angetrauten geklagt haben mußte. »Probier’s mal mit einem anderen!« hatte Isolde ihr lautstark empfohlen. Daran mußte sich Annalena gehalten haben, denn in den Wochen danach nahm die halbe Redaktion am Liebestaumel der angeblich besten Freundin der angeblich besten Journalistin des Hauptstadtbüros teil.
Hans Becker verzog das Gesicht. Er für seinen Teil hätte auf eine solche Freundschaft längst verzichtet. Isolde Menzi schonte nichts und niemanden, zugegebenermaßen auch sich selbst nicht, aber meistens waren die anderen das Opfer. Wie die unglückselige Annalena, deren neue Liebschaft nicht ohne Folgen blieb. Sie war nach kürzester Zeit schwanger und ihren Ehemann los. »Heiratet er dich wenigstens?« hatte Isolde in scharfem Ton gefragt. Gemeint war der neue Liebhaber. Dem »Ach so!« und »Hmmmh!« und dem etwas tiefer intonierten »Also so ein Schwein!« hatten Becker und alle anderen entnehmen können, daß nein. Und nun mußte also auch die Leibesfrucht dran glauben.
Becker sah auf die Uhr und ließ den gelbschwarzen Faber Castell sanft und rhythmisch gegen das Wasserglas prallen. Isolde war erst seit kurzem beim »Journal« – eingekauft als knallharte Analytikerin und als beißwütiger Terrier, der keinen Fall losließ, den er mal gepackt hatte. Beides traf zu, das mußte er neidlos zugeben. Er nickte dem Kollegen Schiffer zu, der mit gerunzelter Stirn ebenfalls auf seine Uhr sah, bevor er sich an der gegenüberliegenden Seite des runden Tischs niederließ und in dem Packen von Bundestagsdrucksachen zu blättern begann, den er mitgebracht hatte. Isolde ließ sich von nichts und niemandem beeindrucken, roch jeden Skandal, kannte keine Rücksichten, war immer an vorderster Front.
Schade, daß wir gerade keine Front haben, dachte Becker. Denn in der Redaktion war sie eine ziemliche Nervensäge, die Kette rauchte, unermüdlich Kaffee kochte und andauernd telefonierte, mit einer Lautstärke, der man sich auch bei geschlossenen Türen nicht entziehen konnte. Ihre Neugier war unerschöpflich, ihre Präsenz übermächtig. Becker versuchte stets, den Abstand zu ihr möglichst groß zu halten. Ihm blieb die Spucke weg in ihrer Nähe. Alles an ihr war zu laut: Ihre Stimme. Ihre Kleidung. Ihr Lippenstift. Sie nahm ihm den Atem.
Er krauste die Nase in Erinnerung an ihren Geruch. Besonders schlimm war es, wenn sie frisch geduscht von ihrer täglichen Aerobicstunde kam, geradezu dampfend noch von der körperlichen Anstrengung. Einmal war sie strahlend und dynamisch ins Büro gekommen, hatte ihre Sporttasche fallen lassen und sich über den Schreibtisch gelehnt, ihm entgegen, wahrscheinlich nur, um ihm etwas zuzuflüstern. Es hatte ihm die Brillengläser beschlagen. In Panik hatte er seinen Stuhl nach hinten rollen lassen, »’tschuldigung« gemurmelt und war auf die Toilette geflohen. Ihr Parfüm – es mußte ihr Parfüm gewesen sein. Es hatte ihn plötzlich an das Mückenspray erinnert, mit dem seine Oma immer das Kinderschlafzimmer eingenebelt hatte – bevor alle Welt wußte, wie gefährlich das war.
Vielleicht war es auch... Hans strich mit der Fingerspitze über die lange weiße Narbe an seiner Schläfe und streckte die Beine von sich. Vor ein paar Wochen, als er wieder einmal versucht hatte, sich dünne zu machen in ihrer Gegenwart, hatte sie sich zu ihm umgedreht, ihm ins Gesicht geguckt und dann, ausnahmsweise einmal leise, gesagt: »Du hast Angst vor mir, Hansi.« Er hatte wie das Kaninchen im Angesicht der Schlange zurückgeguckt. Fast hätte er ergeben genickt. Aber dann hatte Gott sei Dank der Alte nach ihr gerufen.
»MENZI!« Becker zuckte zusammen. Sonnemann war ins Zimmer gekommen, schlechtester Laune, wenn man nach dem Klang seiner Stimme ging und der robusten Zielstrebigkeit, mit der er zu seinem Sessel ging. »Verdammtes Weib!« murmelte der Redaktionsleiter, ließ sich in den Sitz fallen und knallte den Stenoblock auf die Tischplatte.
»Wo ist Zettel?« Keiner sagte was. »Wieder nicht da. Bin ich denn hier unter lauter Idioten?« Auch das mußte man nicht kommentieren. Es gehörte zum morgendlichen Ritual. Ebenso wie der kalte Luftzug, der Isoldes Auftritt begleitete, denn sie pflegte im Vorübergehen stets demonstrativ ein Fenster aufzureißen – als rituellen Protest gegen das Rauchverbot während der Konferenzen. Heute trug sie zum eisblauen Blazer ein knallrotes Tuch, registrierte Hans, als Isolde mit dem gewohnten »Ratsch!« das Fenster hinter seinem Rücken öffnete.
»Guten Morgen!« sagte sie und zeigte die Zähne.
»Wird auch Zeit!« Sonnemann ließ sich zu keinen Höflichkeiten hinreißen. »Wo ist Zettel?«
Isolde guckte, als ob ihr das passende biblische Zitat vorübergehend entfallen wäre. »Soll ich meines Bruders Hüter sein?« murmelte Becker.
»Was?« brüllte Sonnemann.
Das heißt »Wie bitte«, dachte Becker und ließ sich noch ein paar Zentimeter tiefer in den Sessel sinken. Er hatte sich noch immer nicht an den Ton gewöhnt, der in das früher so beschauliche Berliner Büro eingezogen war, seit Sonnemann die Geschäfte führte. Sonnemann mit dem kahlen Schädel und dem Stiernacken und dem breiten Kreuz. Sonnemann, das Tier. Sonnemann, der Vater der Kompanie. Trotz seines rauhen Tons wußten in der Redaktion alle, was sie an ihm hatten. Im Ernstfall stand er eisern hinter ihnen – vor allem gegen »die da oben«, gegen die Chefredaktion im hohen Norden. Wirklich gefährlich wurde er erst, wenn er leise oder gar höflich wurde.
Hinter ihm ging die Tür auf. »Herr Sonnemann?« Die Sekretärin, Frau Novak, war die einzige hier, die der Büroleiter zu respektieren schien. Ihre kurzen schwarzen Haare waren graumeliert, und sie wirkte in ihrer dunkelgrauen Bügelfaltenhose mit der weißen Bluse und der gestreiften Weste »tipptopp«, wie Beckers Mutter sagen würde. Unwillkürlich mußte er beim Gedanken an den spitzen Mund grinsen, den seine Mutter immer gemacht hatte, wenn sie »tipptopp« oder »1a« oder »einwandfrei« sagte.
»Ein Herr von der Frankfurter Staatsanwaltschaft ist am Apparat. Es sei dringend.« Becker sah der Novak an, daß sie am liebsten »Das sagen sie alle!« hinzugefügt hätte. Noch spitzer hätte sie nur reagiert, wenn der Staatsanwalt eine Staatsanwältin gewesen wäre. Die Novak hielt nichts von Frauen, die sich »überhoben«, wie sie es gern nannte – die eine andere Rolle anstrebten als jene dienende, die sie nun schon seit über 30 Jahren mit Perfektion ausfüllte. Isolde und sie führten deshalb von Beginn an eine Privatfehde, die man Krieg nennen müßte, wenn die Novak sich nicht auf eine Guerillataktik der stillen Verweigerung und beiläufigen Sabotage beschränken würde.
Sonnemann murmelte mißmutig vor sich hin, warf den Kugelschreiber neben den Notizblock und stand auf. »In fünf Minuten!« sagte er drohend in die Runde. Als er aus der Tür war, setzte das übliche Stimmengewirr ein.
»Ja, wo ist er denn, dein Freund Zettel?« rief Eyring über den Tisch in Richtung Isolde, die eine aufgeklappte Puderdose in der Hand hielt und sich die Lippen nachzog. Dabei waren die weiß Gott rot genug, dachte Becker, der ihr fasziniert und abgestoßen zugleich dabei zusah.
Isolde preßte die Lippen gegeneinander und rollte sie dreimal hin und her. »Woher soll ich das wissen? So dicke sind wir nicht!«
»Man fragt ja nur!« Eyring lachte, als ob er einen guten Witz gemacht hätte. Vom niederen Antrieb des Ehrgeizes abgesehen, den Zettel und Menzi gemein hatten, waren die beiden grundverschieden. Zettel machte auf bescheiden und verstand es, seinen Informanten das Gefühl zu geben, er täte ihnen einen Gefallen, wenn sie ihm Auskunft gaben. Isolde war offen, direkt und fordernd. Hans Becker wünschte sich manchmal, sich von beiden eine Scheibe abschneiden zu dürfen: Von Peter Zettel hätte er gern die strategische Raffinesse und von Isolde ihr unerschütterliches Selbstbewußtsein. Und weil es ihm an beidem mangelte, hieß er bei fast allen in der Redaktion Hansi. Und nicht Hans. Hansi, der kleine, unauffällige Blindgänger, dem die Brille beschlug, wenn er verlegen war. Hansi in der Grube.
»Na, Hansi? Bist du weitergekommen mit deiner Geschichte? Du weißt ja: Wer schreibt, der bleibt!« sagte Eyring neben ihm mit dick aufgetragenem Mitgefühl in der Stimme.
»Danke der Nachfrage«, hörte Becker sich wie aus weiter Ferne höflich antworten – statt dem blöden Kerl eins in die Fresse zu geben. Eyrings Geschichten hatten es auch schon lange nicht mehr auf die Seite 3 geschafft.
»Man fragt ja nur«, murmelte Jo und klopfte ihm auf den Arm.
Die Seite 3 war Lillys Revier, das sie sich huldvoll mit Isolde Menzi teilte. Isolde war keine Konkurrenz für Lilly E. Meier. Beide waren auf ihre Weise konkurrenzlos. Isolde war die knallharte Analytikerin und Lilly die Meisterin der Geschichten mit dem human touch — Kinder und Frauen zuerst. Sie hatte Lichterketten ausgelöst mit der Schilderung des Lebens einer Rollstuhlfahrerin, in deren Gesicht Neonazis ein Hakenkreuz geritzt hatten. Ihre Geschichte über den kleinen Mehmet, dessen ganze Familie ermordet worden war, hatte es bis in die Bundestagsdebatte geschafft, in der über einen Nothilfeeinsatz der Nato im Krisengebiet entschieden worden war. Wer weiß – vielleicht war es sogar Lillys Rührstory gewesen, die auch die zunächst skeptische Mehrheit der Abgeordneten von der Notwendigkeit des Eingriffs überzeugt hatte.
Die beiden Frauen konnten unterschiedlicher nicht sein. Nicht nur äußerlich: Isolde war auffallend, dunkel, laut und weiblich – Lilly war klein, dunkelblond, sanft und jungenhaft. Die Menzi konnte einen Verstand haben wie ein Rasiermesser – Lilly schien manchmal überzulaufen vor Gefühl. Und während Isolde bei jedem Prozeß dabeigewesen war, den man nach dem Mauerfall den unwürdigen Greisen, den ehemaligen Herrschern der DDR machte, hatte die gute, zarte Lilly den Egon-Erwin-Kisch-Preis für ein Thema eingeheimst, das so abseitig war, daß ihr die gesamte Redaktion allein für die Idee jeden Preis der Welt zugestanden hätte. Lilly E. Meier hatte in monatelanger Kleinarbeit in Erfahrung gebracht, was aus den ehemaligen DDR-Grenzschützern und ihren treuen Begleitern, den Wachhunden, geworden war. Die Berichte aus der Welt der unverbrüchlichen Liebe zwischen Herr und Hund waren derart herzzerreißend, daß sogar Hans Becker sich bei einem Gefühl der Rührung ertappte. Seine Mutter hatte sich damals jede Nörgelei an der Geschichte verbeten. Sie war allein bei dem Gedanken an das Schicksal von Burschi, dem Schäferhund von Exgruppenführer Ewald, in Tränen ausgebrochen.
Becker zeichnete Striche und Kringel auf seinen Block. Er ärgerte sich über Jo Eyring – aber mehr noch über sich selbst. Er hatte einen unverzeihlichen Fehler begangen, einmal, nur einmal, nach einem außerplanmäßigen Glas Bier. Er hatte Peter Zettel davon erzählt, was ihn im Innersten antrieb bei seinem Beruf. Peter Zettel hatte nichts Eiligeres zu tun gehabt, als es jedem in der Redaktion weiterzuerzählen. Seither erntete Becker Sticheleien und Seitenhiebe, wenn wieder einmal eine seiner Geschichten nicht ins Blatt gekommen war – wie eben von Eyring. Der war fast so schlimm wie Zettel. »Das große Ganze, gell, Hansi?« hatte Zettel letzte Woche verschwörerisch geflüstert. »Hier greift wieder ein Zahnrad ins andere, oder, Becker?«
Hans Becker hatte dem Kollegen Zettel gestanden, daß er sich am wohlsten fühle als Rädchen in der Maschinerie. Er hatte das »Journal« mit einem alten Ozeanriesen verglichen, geschwärmt von den riesigen Pleuelstangen und Schwungrädern seiner Maschinen, die sich erst langsam, dann immer schneller in Bewegung setzten, vom Stampfen und Schlingern des Riesen und von der großen Fahrt, die nichts und niemand aufhalten konnte. (»Auch kein Eisberg?« hatte Zettel ironisch dazwischen gefragt.) So jedenfalls kam es ihm vor, wenn das Blatt zu jener gigantischen Kollektivleistung ausholte, für das es berühmt war: Vor wichtigen Wahlen, bei der Aufdeckung großer Skandale hatte jeder, auch noch die flatterhafteste Edelfeder, sein Gewicht in die Schale zu werfen fürs große Ganze. Dabeisein zu dürfen, war wichtiger als ein bißchen vorübergehender Ruhm auf Seite 3 – hatte Hans Becker Peter Zettel erzählt.
Becker seufzte auf und griff zur Flasche mit dem Orangensaft, die vor ihm stand. Seine Kollegen tranken Kaffee, höchstens mal ein Mineralwasser. Nie Cola. Und abends Alkohol, meistens zuviel davon. Der Berufsstand Journalismus verzeichnete reihenweise vorzeitiges Ableben verdienter Kollegen. Erst vor einer Woche hatten sie Ernst Wolters zu Grabe getragen. Er hielt dagegen, so gut er konnte. Rauchte nicht. Trank selten. Nahm genug Vitamine.
Sonnemann riß die Tür auf, ließ sich wieder in den Sessel fallen und atmete hörbar aus. »Wer hat damals die Geschichte über Bunge geschrieben? Die Frankfurter Staatsanwaltschaft in Gestalt von Herrn Dr. Manfred Wenzel« – der bekennende Akademikerverächter Sonnemann grinste anzüglich – »hat Fragen zu unserer Story über Berlins prominentesten Päderasten.«
»Ich«, sagte Schiffer mit müder Abgeklärtheit in der Stimme.
»Und woher kam der Tip?«
»Na, wenn sogar du das nicht mehr weißt!« Schiffer reagierte wie ein quengeliges Kind.
»Geh der Sache noch mal nach«, sagte Sonnemann. »Hansi kann dir zuarbeiten.« Becker nickte ergeben. Schiffer runzelte die Stirn.
»Was ist mit dem Nachfolger von Bunge?« Sonnemann schien an der Antwort auf seine Frage nicht übermäßig interessiert.
»Es ist eine Nachfolger in«, sagte Lilly E. Meier und legte die kleine Hand mit den kurzgeschnittenen Nägeln behutsam auf die polierte Platte des Konferenztisches. »Nach einem Männerplatz auf der Liste folgt ein Frauenplatz. Die Quote...«
»Gutgut.« Sonnemann war auf Subtilitäten wie die Errungenschaften der Frauenbewegung nicht ansprechbar. Nur Lilly verzieh er solche Belehrungen. »Wollte nicht Zettel ein Porträt der Dame abfassen? Wo ist der Kerl überhaupt?«
»Auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer.« Schiffer tat todernst, die anderen kicherten.
Sonnemann machte eine wegwerfende Bewegung. »Egal. Isolde übernimmt das.«
»Iiich?« Man sah Isolde an, daß ihr nichts ferner lag denn die dienende Rolle als Rädchen in der großen Maschinerie. »Aber ich muß noch...« »Zwei Features im Monat, Isolde«, sagte Sonnemann. »Das muß für ein so überströmendes Ego wie das deine reichen. Und ein Porträt ist auch was Schönes.«
Isolde maulte, aber sie schien sich zu fügen. Sonnemann gab sich abwechselnd als guter Onkel und als autoritärer Menschenschinder – und wunderlicherweise funktionierte die Methode.
»Frank?« Lilly sprach leise, aber unüberhörbar. »Laß mich das machen.«
»Aber du mußt doch noch ...«
»Ich weiß. Bitte.«
Sonnemann seufzte theatralisch auf, warf seinen zerkauten Bleistift auf den Schreibblock und sagte: »Weil du es bist.« Was konnte man schon sagen, wenn Lilly eine Bitte hatte.
Während der Blattkritik schaltete Hans Becker ab. Diesmal waren Schiffer die schönen Grüße von der Chefredaktion zugedacht – so nannte Sonnemann die Kritik von oben. Wohl bekomm’s, dachte er. Er war erst vor zwei Monaten dran gewesen und hatte sich davon drei Wochen lang nicht erholt. Er beneidete alle anderen um ihr dickes Fell, besonders den Kollegen Zettel, der sich bei Kritik grinsend zurückzulehnen und »Nur wer nichts tut, macht nichts verkehrt« zu sagen pflegte.
Wo war der Kerl? Er war seit Wochen nur noch sporadisch in der Redaktion und begründete seine langen Absenzen mit einer großen Reportage über die »Bauplätze der Berliner Republik«, wie er es nannte. Zettel mußte in jede Baugrube gestiegen und jedes alte Fundament, jeden Keller, jeden Bunker besichtigt haben, bevor die großen Schaufelbagger die Relikte der alten Zeit endgültig zuschütteten. Daß er auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer sei, war der geflügelte Redaktionsscherz. Zettel hatte Sonnemann vor ein paar Monaten die angeblich heiße Story verkaufen wollen, das Bernsteinzimmer sei nicht beim Angriff der Roten Armee auf Königsberg 1945 verbrannt, sondern in einem thüringischen Kalibergwerk eingebunkert worden. Sonnemann hatte sich geweigert, das Honorar für einen Informanten und die Reisespesen für Zettel zu bezahlen. »Hirngespinste drucken wir nicht«, hatte er kategorisch gesagt.
Ein Rippenstoß von Eyring ließ Becker hochschrecken. Sonnemann sah mit zusammengekniffenen Augenbrauen zu ihm herüber.
»Das gilt auch für dich, Hansi!« sagte er.
Becker nickte stumm. Ja und amen sagen half immer. Auch wenn er wieder einmal nicht wußte, worum es eigentlich ging.