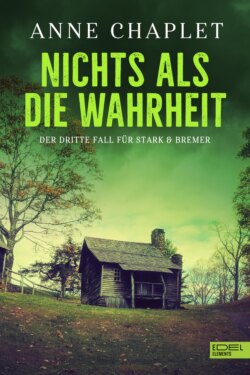Читать книгу Nichts als die Wahrheit - Anne Chaplet - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7
ОглавлениеFrankfurt
Karen Stark drückte die Wohnungstür leise, aber fest hinter sich ins Schloß und schüttelte ungläubig den Kopf. Sachen gab’s, die gibt’s nicht. Erst hatte sie geglaubt, Jehovas Zeugen vor sich zu sehen – so durchdrungen von ihrer Mission wirkten die junge Frau und ihr etwas älterer Begleiter. Aber die beiden hatten früh um halb acht nicht über die Bibel reden wollen, sondern über... Worüber eigentlich?
»Wollen Sie Ihren Lebenshorizont erweitern?« hatte die Frau gefragt und mit großen braunen Augen Karen unverwandt angesehen. »Danke, heute nicht«, hätte Karen am liebsten geantwortet, wenn tief eingegrabene Höflichkeit sie nicht davon abgehalten hätte. Warum bloß hatte sie die Tür geöffnet?
Sie seufzte, schlug den Bademantel fester um die Leibesmitte und ging wieder in die Küche, in der sie schon seit eineinhalb Stunden saß, Milchkaffee trank und über Katalogen brütete. Warum wohl – aus ebenso tief eingegrabenem Pflichtgefühl, natürlich. Es konnte ja nur ein wichtiger Grund sein, der jemanden veranlaßte, so früh schon bei ihr zu klingeln. Die »Ökumenische Aktion«, wie der Mann sie mit ernster Miene vorgestellt hatte, gehörte nicht in diese Prioritätenliste.
»Was die sich alles ausdenken«, murmelte Karen vor sich hin und stellte die Espressomaschine an.
»Das Leben in der Anonymität der Großstadt«, hatte die junge Frau gesagt.
»Einsamkeit und Verlassenheit«, war es wie ein Echo von ihrem Begleiter gekommen.
»Wir können etwas tun!« Die junge Frau hatte gestrahlt bei dieser Aussage. »Sie auch!«
Karen schnaubte und goß Milch in die große Henkeltasse. Sie hatte wie betäubt dagestanden und blöde genickt. So wie man eben nickt, wenn einem frühmorgens jemand gegenübersteht, der so fanatisch an das Gute glaubt.
»Wenn einer von uns den ersten Schritt tut...« Der Mann hatte beschwörend die Hand gehoben. »Wenn einer den Anfang macht...«
»Machen Sie mit bei der ökumenischen Aktion ›Lade deinen Nachbarn ein‹!« hatte die junge Frau schließlich feierlich deklamiert. Karen wartete, bis der heiße Dampf die Milch aufgeschäumt hatte, stellte die Tasse auf den Rost und drückte den Hebel der Espressomaschine herunter.
Sie hatte ungläubig nachgefragt. Aber die beiden meinten es nicht nur ernst, sondern ganz und gar wörtlich.
»Ihren Nachbarn!« hatte die junge Frau wiederholt und mit dem Daumen nach links gewiesen.
Links, in dem kleinen Zweizimmerappartement neben ihrer eigenen, großen Wohnung, hauste Harald Weiss. Niemand würde auf die Idee kommen, ihn zu irgend etwas einzuladen.
Sie hatte trotzdem genickt, »Gute Idee!« gesagt und die beiden mit der Behauptung hinauskomplimentiert, sie müsse jetzt zur Arbeit. Fast traurig hatte der Mann »...in der Anonymität der Großstadt...« gemurmelt und »Einsamkeit statt Geborgenheit...«, bevor die beiden weitergezogen waren. Sie hatte sie nebenan klingeln gehört, als sie die Tür zuzog. Niemand würde ihnen aufmachen. Selbst wenn er da wäre, würde Harald Weiss sich verleugnen. Das war sein Lebensprinzip.
Vor ein paar Jahren hatte sie ihn Marion gegenüber zum ersten Mann erklärt, der sich die Auszeichnung »Armes Opfer der Frauenbewegung« redlich verdient hätte.
»Er ist in jeder Hinsicht ein armes Schwein.«
»Sooo?« hatte Marion gefragt und sie von schräg unten angeblinzelt – ihre beste Freundin liebte es, den Größenunterschied zwischen ihnen beiden möglichst deutlich hervorzuheben. Wenn es ja nur die Größe wäre, dachte Karen und kniff sich in die Seite.
»Sie nimmt ihn systematisch aus.«
»Aha?« Marion hatte völlig mitleidlos ausgesehen.
»Er schuftet von morgens bis abends, damit sie sich nicht einschränken muß. Sie und das Kind. Dabei hat sie ihn verlassen...«
»Ich dachte, das Verschuldensprinzip sei abgeschafft?« Marion konnte von tückischer Unschuld sein.
Fakt ist, dachte Karen und nahm ihre Tasse mit zum Küchentisch, daß Harald Weiss sich von seiner Geschiedenen nach Strich und Faden ausnehmen ließ. Sie erpreßte ihn mit einer nie versagenden Waffe: mit dem Kind, das sie nur dann am Wochenende zum Vater ließ, wenn der vorher auf den Brustwarzen zu Kreuze gekrochen war.
Karen hatte jahrelang jeden Ehekrach der beiden zwangsweise mitangehört – und das Elend des schließlich Verlassenen war unübersehbar gewesen. Vor zwei Jahren hatte sie Weiss in einem geradezu verzweifelten Zustand angetroffen. Er hatte den Kleinen seit Monaten nicht gesehen. Als sie Tage später nach ihm schaute, weil sie sich als gute Nachbarin Sorgen machte um den Mann, hatte er die Tür nur einen Spalt weit geöffnet und mit beseligtem Ausdruck auf dem Gesicht »Pschscht, er schläft!« gesagt. Seither hatte sie ihn nicht wieder gesehen.
Nur das Kind war unüberhörbar, wenn es denn zum Vater durfte, schätzungsweise alle vier Wochen – der Bub veranstaltete regelrechte Tobsuchtsanfälle. Wahrscheinlich hatte der Kleine mittlerweile gelernt, wie er seinen schuldbewußten Vater am geschicktesten erpreßte. Harald Weiss war immer ungeselliger geworden. Heute schien er nur noch seine Arbeit zu kennen und die seltenen Besuche des Jungen, der seinen Erzeuger wahrscheinlich in dem Maße zu verachten lernte, in dem der sich seinem Kind unterwarf.
»Lade deinen Nachbarn ein«, murmelte sie. »Mit mir nicht.«
Und die Alternative zu Harald Weiss? Sollte sie etwa Dieter Stein einladen, den Mieter der Parterrewohnung? Karen schüttelte sich.
»Frau Stark, wenn ich Sie bitten darf, Ihre Joggingschuhe schon unten an der Haustür auszuziehen? Der Schmutz...« Stein war in seiner Funktion als Hausmeister für den makellosen Zustand des Treppenhauses zuständig. Zu Anfang hatte sie versucht, mit ihm zu argumentieren. Aber jeder Einwand war abgeprallt an seinem unbewegten Gesicht mit den wachsamen Augen und der spitzen Nase.
»Bitte!« hatte er gesagt, was einem Befehl gleichgekommen war.
Und Frau Petzold? Die wollte sie nie, nie wieder in ihrer Wohnung sehen. Aber leider war ausgerechnet das schlechterdings nicht zu vermeiden. Als sie eingezogen war in die wunderschöne helle Westendwohnung, sieben Jahre war das jetzt her, hatte sie nicht weiter ernst genommen, was ihre Vermieterin mit mildem Lächeln sagte: »Und uns allen liegt etwas an einem gepflegten einheitlichen Bild, gell?«
Frau Petzold aber hatte das ganz und gar wörtlich gemeint: Zur Straßenseite hin sollten alle Fenster weiße Gardinen aufweisen, Schmuck oder Blumen in den Fenstern waren verboten, und in die Balkonkästen gehörten, dem eindringlichen Wunsch der Vermieterin entsprechend, rote Geranien – ausschließlich rote Geranien. Dunkelrote Geranien.
Als Karen das erste Mal dagegen verstieß, indem sie eine lachsfarbene Rose auf ihren Balkon pflanzte, hatte sie zuerst nicht weiter ernst genommen, daß die Petzold bei ihr Sturm klingelte und völlig außer Atem Mal um Mal »Aber Frau Stark!« rief. Heute fand sie das alles nicht mehr komisch. Denn Frau Petzold beharrte darauf, mitreden zu dürfen bei der Neugestaltung ihrer Wohnung. Karen Stark aber hatte die Nase voll von weißen Gardinen an ihren Fenstern. Sie hatte keine Lust mehr auf das »einheitliche Bild«, das das Haus nach außen abgeben sollte.
Sie hatte ein einziges Mal versucht, mit der Vermieterin die Situation unter rechtlichen Aspekten zu diskutieren. Frau Petzold hatte tödlich beleidigt reagiert. »Nur weil Sie Staatsanwältin sind!« hatte sie empört ausgerufen. Sie schien anzunehmen, daß es eine besondere Anmaßung sei, wenn sich auch eine Staatsanwältin auf das für alle geltende Recht bezog.
Karen seufzte und räumte den Stapel von Katalogen beiseite. Die Verkäuferin in dem Laden mit den wunderbaren französischen Stoffen hatte sich das Problem angehört, die Vorderzähne auf die Unterlippe gesetzt, das Kinn nachdenklich vorgeschoben und schließlich vorgeschlagen, die neuen Vorhänge so zu drapieren, daß von außen nur die weiße Gardine und von innen nur das opulente Rosenmuster der neuen Vorhänge zu sehen seien.
Karen Stark sah auf die Uhr, die über dem Kühlschrank hing. Dann seufzte sie wieder und griff nach der Handakte, die neben der Kaffeetasse lag. Sie hatte noch eine Stunde Zeit, bis sie im Büro sein mußte, Zeit genug, um das Versprechen einzulösen, das sie Wenzel gestern gegeben hatte. Wenigstens überfliegen wollte sie die Akte Bunge.
Lustlos überblätterte sie die ersten Seiten und den Autopsiebericht. Im Unterschied zu Wenzel war sie wenig interessiert an den medizinischen Details. Die Gefühle beschäftigten sie, mit denen man es bei gewaltsamen Todesfällen zu tun hatte. Die meisten Täter trieb Persönliches an. Sollte Bunge wider Erwarten nicht freiwillig gesprungen, sollte der Todesfall gar auf Mord oder Totschlag zurückzuführen sein, so würde sich das Motiv, davon war sie überzeugt, nur in seinen persönlichen Umständen finden lassen.
Als sie auf die Kopie der Todesanzeige für Alexander Bunge stieß, war sie überrascht – nicht nur, weil jemand die Anzeige für wichtig genug gehalten hatte, um sie der Akte beizuheften, sondern weil sie in jeder Hinsicht ungewöhnlich war:
ALEXANDER BUNGE, 19.4.1951— 13.8.1999
»Du liebtest die Wahrheit
mehr als dich selbst
An ihr hing Dein Herz —
nicht am Leben.
Das Leben hatte ein Einsehen.«
In Liebe, Respekt und Trauer
im Namen der Freunde und Familie:
Edith Manning.
Edith Manning. Woher kannte sie bloß den Namen? Nicht aus Politiker- oder Parteikreisen, so viel war sicher. Schließlich fiel es ihr wieder ein: Edith Manning war der Name einer bekannten Frankfurter Strafverteidigerin. Sie vertrat den Beschuldigten im Kindergartenprozeß. Karen sah wieder auf die Küchenuhr. Sie konnte die Anwältin in etwa zweieinhalb Stunden bei der Verhandlung treffen.
Karen ließ ihren kalt gewordenen Milchkaffee in der Tasse kreisen und sah durchs Küchenfenster hinaus zum Himmel, auf dem ein Flugzeug eine Schleppe aus zwei weißen Kondensstreifen hinter sich herzog. Es schadete nichts, die Kollegin anzusprechen. Gehörte sie zum Freundeskreis oder zur Familie des Verstorbenen? Und was hatte es mit dem seltsamen Text der Anzeige auf sich?
Endlich gab sie sich einen Ruck und erhob sich vom Küchentisch. Dann ging sie ins Bad.
Bevor sie eine halbe Stunde später die Haustür hinter sich zuzog, war sie zweimal zurück in ihre Wohnung gelaufen, nur weil sie wieder irgend etwas vergessen hatte. Erst die Handakte Bunge. Dann ihren Autoschlüssel. Demnächst würde sie noch ihren Verstand zu Hause liegenlassen.
Karen drehte den Schlüssel in der Haustür zweimal um. Ihre Schusseligkeit in letzter Zeit machte sie nervös. War das vorzeitige Altersdemenz? »Streß«, hatte Marion kürzlich gesagt und ihr Urlaub empfohlen. Streß! Karen schnaubte. Das war ja das Allerneueste.
Wenigstens war sie noch nicht so gaga wie der alte Niemann, der jeden Tag wie ein Besessener die Straße fegte. »Bin gleich fertig!« rief er ihr zu, als er sie aus dem Gartentor heraustreten sah.
»Nur keine Hektik!« rief sie zurück. Sie und er waren ein eingespieltes Team.
»Gleich ist es soweit!«« rief die brüchige Männerstimme, jede Silbe unterlegt von einem kräftigen Strich mit dem Besen. Der alte Mann würde wahrscheinlich verdorren und verdämmern, wenn er nicht jeden Tag die Straße kehren dürfte.
»Gleich – fertig!«« sagte er, ohne aufzusehen.
Andere joggen, dachte Karen – manchmal jedenfalls. Der alte Niemann fegt mit Kraft und Ausdauer die Straße. Auch das beugt dem Herzinfarkt vor.
In ihrem Laden herrschte Hochbetrieb. Kaum saß Karen wieder im Büro, funktionierte ihr Gedächtnis makellos. »Streß!« murmelte sie verächtlich, als sie den zweiten Aktenstapel durchgearbeitet hatte.
Dann erst ging sie hinunter zum Verhandlungszimmer. Die ersten beiden Verhandlungen des Tages verliefen nach Plan: Im einen Fall wurde die Beweisaufnahme verschoben, im zweiten Fall folgte die Richterin dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Karen schaffte es gerade noch vor Beginn der Sitzung in den Raum, in dem der »Kindergartenfall« verhandelt wurde. Diese Verhandlung würde sich nicht so unspektakulär erledigen. Dafür würde die Person sorgen, die sich soeben mit der linken Hand durch die kurzen dunklen Haare fuhr und sich mit beiden Händen das Jackett geradezog, während sie aufstand. Mit vor Konzentration gerunzelten Augenbrauen begann Edith Manning die Klagebegründung der Staatsanwaltschaft auseinanderzunehmen.
Karen war damals froh gewesen, daß nicht sie den Fall hatte übernehmen müssen. Es ging um einen jungen Mann, einen gelernten Erzieher, der im katholischen Kindergarten von Bornheim jahrelang als liebevoller und verläßlicher Betreuer gegolten hatte – bis das Gerücht aufkam, er habe sich an seinen Schützlingen vergangen. Auf das Gerücht folgte die Hysterie, und noch bevor die Ermittlungen begonnen hatten, war der junge Mann bereits als mutmaßlicher Täter geoutet – von den Zeitungen, mit Foto.
Nach einem mißlungenen Selbstmordversuch lag der junge Mann auf der Intensivstation – und Edith Manning bezichtigte sie alle des Rufmordes. Die hysterischen Mütter und besorgten Väter, die Kolleginnen des Angeklagten, die Vertreter des Jugendamtes und vor allem die Medien. Und nicht zuletzt die Staatsanwaltschaft, die Klage erhoben hatte.
»Wir nennen das Rassismus. Wir nennen das Sexismus. Wir nennen das eine unerträgliche Diskriminierung, wenn eine Person aufgrund ihres Geschlechts an den Pranger gestellt wird. Der Angeklagte schwebt in dieser Minute zwischen Leben und Tod – nicht, weil er ein reuiger Verbrecher wäre, der sich der weltlichen Gerechtigkeit hätte entziehen wollen. Sondern weil er ein Verzweifelter ist, der dieser Gerechtigkeit nicht mehr traut. Die Anklage beruht allein und ausschließlich darauf, daß der Angeklagte ein Mann ist. Sie ist ein Dokument sexistischer Vorurteile. Sie hat einen Unschuldigen auf dem Gewissen.«
Fast bewunderte Karen die Verteidigerin für ihren Mut. Fast hatte sie Mitleid mit dem ermittelnden Kollegen. Sexueller Mißbrauch von Kindern im Kindergartenalter war schwer nachzuweisen – nur wenn die Kinder körperlich verletzt worden waren, gab es Eindeutigkeit. Ob sie Schaden an ihrer Seele genommen hatten, war eine Frage des Ermessens – und der Definition. Besonders Ängstlichen galt bereits das Abhalten der Kinder auf dem Klo als Mißbrauch, Hysteriker schlugen bei jeder Form körperlicher Berührung Alarm. Natürlich war das Unsinn. Andererseits erwischte auch sie sich beim Gedanken, daß sie in solchen Fällen auf der Seite des gesunden Volksempfindens und damit im Zweifel gegen den Angeklagten war.
Der Richter verkündete Vertagung und beendete die Sitzung. Edith Manning stand noch immer am Tisch, beide Hände auf die Platte gestützt, und schien ins Leere zu blicken. Karen räusperte sich, bevor sie sie ansprach. Sie glaubte zu sehen, wie die Anwältin zusammenzuckte. Die Müdigkeit auf ihrem Gesicht wich mißtrauischer Wachsamkeit, als sie Karen sah.
»Frau Stark.« Sie nickte Karen zu.
»Frau Manning.« Karen nickte ebenso förmlich zurück. »Haben Sie eine Minute...?«
»Auch zwei, Frau Kollegin.« Edith Manning bemühte sich um ein Lächeln.
»Es geht um Dr. Alexander Bunge.« Wieder glaubte Karen das Mißtrauen im Gesicht der anderen aufflackern zu sehen. »Die Todesanzeige...«
Die Frau machte eine ungeduldige Handbewegung. »Er hat den Text selbst entworfen.«
Karen klappte erstaunt den Mund wieder zu. »Wann?« fragte sie dann.
»Ein paar Wochen – davor. Ein entsprechender Brief war seinem Testament beigefügt.«
»Und – Sie?« Karen wußte nicht genau, wie sie sich ausdrücken sollte. War Edith Manning die Schwester oder eine andere Verwandte Bunges?
»Ich sah keinen Anlaß, seinen letzten Willen zu ignorieren«, sagte Manning mit steifer Würde.
»Ich meine —«
»Ich weiß, was Sie meinen, Frau Kollegin. Ich war seine Frau.«
Für einen Moment konnte Karen ihre Überraschung nicht verbergen. Sie hatte Bunge für alleinstehend gehalten.
Edith Manning blickte sie fast zornig an und sagte dann leise: »Ist das so ungewöhnlich?«
Ungewöhnlich? Nichts, dachte Karen, war gewöhnlicher als eine Ehe. Selbst daß beide Ehegatten ihren Namen beibehielten, galt mittlerweile nicht mehr als exotisch. Dennoch fand sie ihren Irrtum verzeihlich – von einer Ehefrau hatte Manfred Wenzel ihr nichts gesagt. Und in der Akte hatte sie die Seiten mit den biografischen Daten überblättert.
Karen merkte, daß Edith Manning fast unhörbar, aber deutlich sichtbar mit nervösen Fingern auf den Schreibtisch klopfte.
»Der Anzeigentext stammt also von ihm. Das läßt auf Vorbedacht schließen«, sagte sie.
»Läßt es wohl.« Die Finger hörten nicht auf zu trommeln.
»Ihr Mann hing also an der Wahrheit mehr als am Leben.«
»So hört sich das an, oder?« Edith Manning hatte eine für eine erfolgreiche Anwältin untypische Spur von Trotz in der Stimme.
»Bezog sich das – auf den Artikel im ›Journal‹?«
Edith Manning lachte auf, kurz, trocken und, wie Karen verwundert feststellte, ordinär.
»Die Wahrheit jedenfalls hat im ›Journal‹ nicht gestanden!«
»Woher wissen Sie das? Die Ehefrauen sind in solchen Fällen meistens die letzten, die die Wahrheit erfahren...«
Die Anwältin hörte abrupt auf, mit den Fingern auf den Tisch zu klopfen und steckte beide Hände in die Taschen ihres Jacketts. Dann zog sie die Schultern hoch und sagte mit unverhohlenem Sarkasmus: »Wir hatten weniger Geheimnisse voreinander als andere Eheleute.«
Sie mußte Karen angesehen haben, daß sie ein ebenso sarkastisches »Das sagen sie alle!« auf den Lippen hatte, jedenfalls fügte sie hinzu: »Es gab keinen Grund, mir irgend etwas in dieser Art zu verschweigen.«
Als Karen noch immer ungläubig guckte, sagte Elisabeth ungeduldig: »Er war kein Päderast. Er stand nicht auf kleine Jungen. Er mochte Männer – erwachsene, normalgewichtige, virile Männer.«
Karen Stark fühlte, wie ihr das Blut ins Gesicht stieg. Wie konnte sie nur so blöd sein! Kein Wunder, daß Manfred Wenzel sich befangen fühlte.
»Auch das ist nicht so ungewöhnlich.« Edith Manning klang wie ein trotziges Kind, das mit dem Fuß aufstampft, während es »Alles ganz normal!« ruft.
»Nicht?« Karen merkte, wie ungläubig sie klang. Aber Edith Manning hatte ihren Sarkasmus abgestreift und sah plötzlich jung und verloren aus.
»Wir waren eine richtig glückliche Familie. Und wir führten eine wunderbare Ehe. Es war eine in allen Punkten gute Ehe.« Sie lächelte matt, als sie Karens Gesicht sah. »Ist doch ganz einfach: Er wollte Kinder, aber keinen Sex mit einer Frau. Ich wollte Kinder, aber keinen Sex. Punkt.«
Karen sah, wie sie die Hände in den Jackettaschen ballte und dann wieder entspannte.
»Kinderpornografie! Alexander! So ein Schwachsinn!«
»Die Karriere eines Abgeordneten kann durch solche Gerüchte schnell beendet werden.«
»Aber wenn es doch nicht stimmte...« »Warum ist er dann gesprungen?«
»Ist er das?« Edith Manning hatte wieder die Hände geballt.
»Was sonst?«
Die Strafverteidigerin zuckte mit den schmalen Schultern. Plötzlich standen auch ihr die Zweifel im müden Gesicht.
Karen fühlte plötzlich tiefes Mitleid mit der Frau, die mit einem Mal ganz verloren aussah in dem leeren Verhandlungssaal. Sie gab Edith Manning die Hand, als sie sich verabschiedete. Selbst ihr Händedruck wirkte zögernd, zweifelnd.
Aber konnte es wirklich Zweifel geben? Daß Bunge schwul war – nun, das war offenbar Teil eines für beide Seiten befriedigenden Abkommens. Man mußte einander nicht lieben, um eine Familie zu gründen. Aber würde eine Mutter, mehr noch: würde diese Frau dem Vater ihrer Kinder Päderastie verzeihen?
Niemals, dachte Karen. Sie würde bis zuletzt daran festhalten, daß er Opfer einer Denunziation war – wie der junge Mann, für den sie ein so leidenschaftliches Plädoyer gehalten hatte. War er es aber nicht – dann würde ihre Rache unerbittlich sein. Er würde, anders als Harald Weiss, seine Kinder nie wieder sehen.
Bunge mußte das gewußt haben. Wenn die Zeitungsmeldung stimmte, hatte er jeden Grund der Welt, sich umzubringen. Und die eigenartige Todesanzeige? insistierte eine innere Stimme. Diese Stimme aus dem Jenseits? Karen Stark packte ihre Aktentasche fester. Inszenierung. Selbstschutz. Eitelkeit noch über den Tod hinaus. Aber das alles war kein Grund, um nicht endlich das zu tun, was Manfred Wenzel all die Wochen über versäumt hatte – aus gänzlich persönlichen Motiven: die Akte Alexander Bunge zu schließen.