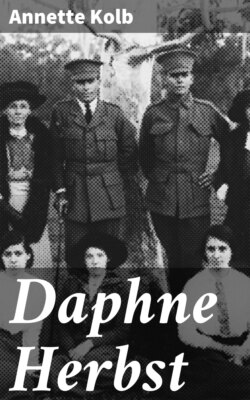Читать книгу Daphne Herbst - Annette Kolb - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеERSTER TEIL
Inhaltsverzeichnis
ERSTES KAPITEL
Baronin Zenaide Waldmann
Inhaltsverzeichnis
Der Vorhang der Bilder und Begebenheiten, die sich hier entrollen werden, hebt sich eines Novembernachmittages um die fünfte Stunde im München der letzten Vorkriegsjahre. Baronin Zenaide Waldmann erwartet in ihrer engen Dreizimmerwohnung Besuch. »La baronne Zénaide de Waldmann, dame du palais, Äußere Schellingstraße 15. Rgb. III. Stock.« So steht es auf ihren Visitenkarten, und immer liegen sie wieder frisch bei jenen Mitgliedern der Hofgesellschaft auf, welche Einladungen geben werden oder soeben eine gaben. Heute empfängt sie selbst. Der Teekessel blitzt auf dem weißen Damast, Hausgebackenes ist zweckmäßig verteilt, farbige Tassen und Tellerchen bilden die Runde. Notburga Vogt und ihre Tochter Resi kommen bestimmt, gilt es doch den gestrigen Rout bei Marie Menes, der bildschönen österreichischen Gesandtin, von Grund auf zu erörtern. Aber draußen rast ein Unwetter; Influenza ist stark in der Zunahme begriffen. Wenn niemand käme! Da ertönt eine Klingel; gleich darauf Notburgas Stimme im Vorplatz, gottlob! Aufatmend, von einem Alp befreit, stürzt die Hausfrau durch ihren kleinen vollgepfropften Salon der Freundin entgegen.
Wohl mag es angehen, Zenaiden so ohne weiteres vorzuführen, nicht aber sie selbst das Wort ergreifen zu lassen, bevor wir den Leser auf das ganz eigentümliche Idiom der Familie Waldmann vorbereiten. Ja, nicht nur eine kleine Pause, einen großen Sprung gilt es hier, grade ein Jahrhundert zurück, wir haben es sozusagen mit der Zentenarfeier eines tiefen Hofknickses zu tun, den eine sehr hübsche Frau von Waldmann im Schloß Nymphenburg vor Napoleon I. vollzog. Ihr Ernst bei dieser Handlung war so groß, daß Fächer und Taschentuch der Dame entglitten. Aber Napoleon hatte sich gebückt und ihr die Gegenstände überreicht. Daraufhin hatte er sie huldvollst, wenn auch etwas gewohnheitsmäßig, gefragt, wieviel Kinder sie habe.
»Trois, Sire«, war die Antwort der Baronin gewesen.
Unglaublich, aber wahr: von diesem Tage an datiert die Waldmannsche Manie, sich im Familienkreise der französischen Sprache zu bedienen. Sie wurde zur Tradition, zum unbestimmten Vorrecht des Hauses. Schon Zenaidens Großvater zwar setzte den Fuß nicht mehr außer Landes. Empire war nicht mehr Trumpf, Napoleon war vergessen, seine Sprache behielt man bei. Nur bekam sie im Lauf der Dezennien einen sehr niederbayrischen Einschlag, vollgespickt mit deutschen Worten baute sie sich breit und breiter aus, erhielt sich dennoch, ja wurde in ihrer Eigenart sehr zwingend sogar, sehr hartnäckig, fast ein wenig erbost. Vermaß sich jemand, den Waldmanns ein korrektes Französisch entgegenzuhalten, so fiel er ab, und sie überhörten den Unterschied; bald genug ließ der »Fex«, als welcher er empfunden wurde, seinen Standpunkt fahren, stellte sich um und sprach Waldmannsch. Übrigens war es auch viel gemütlicher.
Zenaide hat jetzt das Wort.
»J’ai déjà cru que tu allais me planter!« rief sie. Das »là« blieb in der Luft. Nicht nur war es längst abhanden gekommen und hatte kein Waldmann sich danach umgetan, vielmehr führte die Etymologie des in Münchener Hofkreisen eingebürgerten Wortes »plantieren« auf die Sprachpraktiken der Casa Waldmann zurück.
»Ich habe dich nicht plantiert, meine Liebe, fast mit Lebensgefahr bin ich bis zu dir herausgeturnt«, sagte Notburga, welche heute kein Orkan abgehalten hätte, die mit ihren Nöten so wohlvertraute Freundin aufzusuchen. Zenaide wußte es wohl, doch sie hatte Formen.
»Pauvre«, sagte sie, »par ce Sauwetter, et moi, qui demeure déjà comme ça au diable vert. As-tu pris un Droschk? Viens, il fait bon chaud à coté.«
Es war nicht möglich, sich durch die Kommoden, Schränke, Konsolen, mit Tuch überzogenen Tischchen in Kleeblattform ohne Havarie hindurchzuschlängeln. Notburga tat ihr möglichstes, allein ein Katzenkopf flog dennoch zu Boden, eine Filigrangondel und eine Miniatur mit sich reißend, während ein Becher für sich allein umfiel.
»Laisse seulement«, sagte Zenaide, »cela Zensi emporte déjà«, und zog sie in das Speisezimmer.
Zensi, die alte Dienerin, pflegte am Dienstag (die übrige Zeit kam ohnedies niemand) die gestürzten Nippsachen in einem Sack aufzulesen und ihn dann auf das Sofa zu legen, denn sie wieder aufzustellen, auf den Millimeter genau wie zuvor, verstand nur die Baronin. Die Beschäftigung sagte ihr zu, war noch eine Ideenassoziation, hing noch mit der Geselligkeit zusammen, an welche sie sich klammerte. In der Tat war das kleine Speisezimmer mit dem schön gedeckten Tisch unter der Lampe der einzig zuversichtliche Fleck in Zenaidens Heim. Der Duft des Tees machte sich jetzt mit dem der Käsestangen vertraut, die an ihrem Empfangstag nie fehlten. Sie waren die Brücke, die Lockspeise, ohne die sie ganz zu vereinsamen zitterte. Niemandem verriet sie das Rezept, man bekam sie in dieser Güte nur bei Zenaiden. Der Weg zu ihr war unbequem und weit, ihre meist betagten Freundinnen fingen an, den finsteren Flur und die Treppen zu scheuen.
Sie füllte jetzt die Tasse ihres einzigen Gastes und legte, sowie ein Stängelchen verschwand, ein neues auf den Teller.
»Köstlich!« sagte Notburga und entschuldigte das Fernbleiben ihrer Tochter mit einer beginnenden Erkältung. In Wirklichkeit hatte sich Resi glatt geweigert, die Mutter zu begleiten, und war in aller Heimlichkeit mit ihrer Base zum Besuch einer Hellseherin verabredet, welche bis in alle Einzelheiten die Verlobung einer gemeinsamen Rivalin vorausgesagt hatte: ein Mann von hoher Merkwürdigkeit, der nicht sei wie alle anderen, würde sie zur vielbeneideten Braut erwählen. Nun aber besaß Dachs von Dachsenstein, so hieß er — und Dachs war der Familientaufname der ältesten Söhne der Dachsensteins —, Dachs von Dachsenstein also besaß ein Glasauge, und wie hätte sich daraufhin Frau Herzogenbuchsee, es war ihr »nom de guerre«, nicht eines gesteigerten Zulaufes erfreut? Und wie hätte Resi sie nicht befragt? — Schonheim, die beste Partie dieser beginnenden Saison, ernst und offenkundig um sie bemüht, hatte gestern abend nur Augen für Daphne Herbst gehabt, den neu aufgehenden Stern.
»Wenn es dieses Mal wieder nicht klappt, es wäre die Hölle«, sagte Notburga. »Josi muß nächsten Winter dran. Sie wird schon in diesem achtzehn. Danke Gott, Zenaide, daß du keine Töchter hast. Schonheim ist ja ein ausgemachter Snob«, äußerte sie von dem ersehnten Schwiegersohn; »das wissen wir alle.«
Aber grade diese Eigenschaft, welche Zenaide übrigens hochschätzte, dünkt sie tröstlich. Er würde seinen Georgiritter nicht preisgeben, und wer war denn diese Daphne Herbst? Marie Menes empfing wirklich schon Krethi und Plethi. Ein Verstoß sondergleichen, dies Wesen aus einem Fräulein zu machen, das in Wien nicht vorgestellt war.
»Vielleicht aus Willkür«, wandte Notburga ein. »Der Vater ist doch so was Gutes!«
»Ta, ta ta, das Mädel ist nicht hoffähig, voilà le pot aux roses. Sa mère est déjà comme ça auf der Brennsupp dahergeschwommen.«
Notburga hatte zuviel Sorgen, um französisch zu reden.
»Eine ätherische Erscheinung«, meinte sie nachdenklich.
»Jawohl, diese Sylphiden kennt man. Was steckt dahinter? Skrofeln.« Zenaide hielt noch an den ältesten medizinischen Ausdrücken fest. »Meines Wissens trägt man nirgends Ärmel an ausgeschnittenen Kleidern. Aber sie hat wahrscheinlich Narben. Daher ihre langen Tüllfetzen. Mir altem Schlachtroß macht man nichts weis. Warum seid ihr übrigens so früh gegangen? Schonheim hat zum Schluß kein Wort mehr mit ihr gesprochen. Er suchte euch.«
Notburgens Herz schlug endlich höher. Sie tat im stillen ein Gelübde. Zenaide sollte zu Weihnachten ein Telephon erhalten. Man würde ihr dann auch leichter absagen können. Heute noch wollte sie es anmelden.
Die beiden hingen aufs engste zusammen: wie Pech und Schwefel, hieß es im Gegenlager. In Wahrheit mit vollendeter Treue. Zenaide, die weitaus ältere, von jeher unschön und unbemittelt, viele Jahre hindurch Hofdame, bis ihre Prinzessin starb und sie mit einer elenden Pension fortfuhr, in die »große Welt« zu gehen. Weiter wie bis Stuttgart war sie dabei nie gekommen, eine Wiener Hochzeitsfahrt scheiterte an dem Widerstreben der jungen Erzherzogin, deren Dienst sie versehen sollte. Es war also ausschließlich eine Münchner »grand monde«, in welcher Zenaide sich bewegte. Ihre breite Hermelinstola, ein paar Schmuckstücke und eine lila Brokatrobe bildeten ihren Abendornat. Fast immer wurde sie abgeholt oder doch nach Hause gefahren, war es doch der Bitterkeiten größte für sie, allein zu Hause zu bleiben. Man begriff dies wohl. Sie saß im Sommer Monate lang auf Schlössern herum, wenn sie nicht eine erkrankte oder beurlaubte Hofdame vertrat. Sie selber erkrankte nie. Krankheiten mieden ihre Schwelle. Gab es etwas Wesenloseres als ihre Räume? Sie strebte nur immer von ihnen fort. Selbst der Tod würde diese alte Eintagsfliege suchen und dort hinstrecken müssen, wo sie wirklich war: in Gesellschaft, mitten in einem nichtigen Gespräch. Genau so ahnungslos und fast so ungebildet wie ihre Zensi, — war sie im Gotha, in Fragen der Etikette so beschlagen, war ihr Ton so absprechend, so selbstsicher, war ihre Dummheit so geschickt verbaut, daß Dinge, von welchen sie nichts begriff, in ihrem Beisein nie zur Erörterung gelangten. Sie wurde dann gleich hämisch. Statt eines berühmten Gastes oder eines Konzertes im Odeon kam das infantile Geigenspiel der Fürstin Perleburg zur Sprache oder die Schnadahüpfeln des Barons Blau, der, wo nur ein Pianino stand, sofort gebeten wurde zu singen und sich sofort hinstellte und sang. »Quel talent!« rief dann die Baronin. Leer, kalt, egoistisch, hatte ihr Herz nur eine sensible Stelle: Notburga. Es war Zenaide, die seinerzeit ihre Ehe mit dem Grafen Sempronius Vogt vermittelte und betrieb, wofür ihr Notburga, obwohl sie dem Grafen nicht eine Spur von Neigung entgegenbrachte, die größte Dankbarkeit bewahrte. Der um vierundzwanzig Jahre ältere Vogt besaß zwei Schlösser und ein Stadthaus und gehörte der zweiten Hofrangklasse an, und nicht das Glück, die Liebe (solchen Schnickschnack gewährte man sich nebenbei), sondern der Rang, die Partie gab für Notburga bei der Wahl eines Gatten den Ausschlag. Sie hatte noch immer ihre sehr schönen Tage, reizende Zähne, einen bezaubernden Mund und ihr melodisches Lachen. Welcher Laune hatte die Natur gefrönt, als sie dies Wesen bildete, dessen Einstellung dem Leben gegenüber von einem Tiefstand war, der an Niedertracht grenzte, und das eine korrupte Seele mit einem edlen Charakter verband? Vorzüglich auf das Denken bezieht sich wohl die Faulheit der allermeisten Menschen. Notburga, diese stets rührige Frau in ihrem Heim, geschmackvoll, talentiert, von einem gewissen philosophischen tour d’esprit sogar, hatte sich, solange sie lebte, zu keiner Schlußfolgerung aufgerafft. Großmütig, aufopferungsfähig, war sie in ihrer Sinnesrichtung dennoch gewöhnlich, dennoch gemein. Der kleinste Leutnant mit einem feudalen Namen, ob sie ihn auch gering schätzte und die absprechendsten Urteile über ihn fällte, galt in ihren Augen mehr als ein bedeutender Geist. Zwischen einem Ausverkauf von Seidenpartiewaren und einem interessanten Gastspiel hätte sie sich stets für jenen entschieden. Für beides nur, wenn ihr Sempronius die Mittel dazu gewährte, und er war von einem skandalösen Geiz. Auch dies, auch daß er den Spitznamen Odiosus trug, wußte Notburga, bevor sie die Ehe mit ihm einging. Im Zwiegespräch mit Zenaiden nannte sie ihn selber nie anders. »Mein armer Odiosus«, sagte sie auch heute wieder mit einem tragischen Augenaufschlag, als sei der Himmel ihr Zeuge, »mein armer Odiosus ist zu seinen Pferden, Schweinen und Kühen gefahren. La maison respire!« Bei aller Plattheit der Gesinnung war dies gewissenlose, dies widerspruchsvolle Geschöpf im Grunde harmlos, und es war nicht langweilig. Denn wie das so ist: Leute, die über ihrer geistigen Marke leben, pflegen viel stärker anzuöden als die intelligenten Unintellektuellen. Notburgas Mutterwitz, ihre Drastik lieh ihren Äußerungen eine eigentümliche Farbe. Diese Anbeterin des goldenen Kalbes und der Alltäglichkeit war selber nicht alltäglich.
Wir hielten uns des längeren bei den beiden Damen auf, weil wir ihnen noch begegnen werden. Indessen hat es von neuem geläutet. Zwei Münchener Baroninnen, die sich zusammentaten, rascheln durch den Salon und werfen ein paar Sachen um. Aber sie waren gestern abend nicht bei Marie Menes, und sie interessieren uns nicht. Notburga stellt sich, als wäre sie schon längst im Aufbrechen. Es ist Zeit, daß auch wir uns zu den Ursachen ihrer Sorgen, zugleich den Helden dieses Buches begeben.