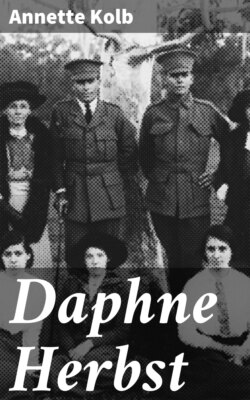Читать книгу Daphne Herbst - Annette Kolb - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DRITTES KAPITEL
Helga und Constantin
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Im Jahre 1890 hatte sich Daphnes Vater, der damals noch Rang und Titel eines bayrischen Standesherrn führte, in den österreichischen Donaustaaten nach einer Braut umgesehen. In München konnte er nicht schlüssig werden, und da die Familie katholisch war, blieb nur Wien. Ein heftiger Flirt mit Notburga Vogt, der, statt ein »Schnickschnack« zu bleiben, zum regelrechten Skandal auszuarten drohte, schien jäh beendet, und die bösen Zungen erzählten sich, auf Notburgas mariage de raison sei bald genug eine rupture de raison erfolgt. Wie dem auch sei, Constantin, halb und halb entschlossen, in österreichische Dienste zu treten, verschwand. Statt eine Clam Gallas oder Kinsky heimzuführen, verliebte er sich indes über Hals und Kopf und auf Tod und Leben in Helga Lucius, Tochter eines bekannten Wiener Arztes, eines der ersten übrigens, welche Pferd und Wagen gegen das Auto eintauschten, zugleich auch eines seiner ersten Opfer, indem er bei einem Zusammenstoß verunglückte. Die junge Doppelwaise, denn Helga verlor ihre Mutter schon als Kind, wurde von ihrem Großvater, dem Musikprofessor Lucius, zur Geigerin ausgebildet und errang gleich bei ihrem ersten Auftreten den schönsten Erfolg. Daß Constantin diesem Konzert beiwohnte, geschah durch Zufall. Eine irregeleitete Ballmutter, in der Absicht, ihm die hübscheste ihrer Töchter als Nachbarin zu gesellen, überrumpelte ihn mit einer Einladung, der er sich ohne große Unhöflichkeit nicht entziehen konnte. Sie hatte auch die Rückfahrt sehr geschickt eingerichtet, und wer weiß, was noch erfolgt wäre. Allein die Intrige scheiterte an Helgas Erscheinung und dem Zauber ihres Spieles. Constantins Sinnen und Trachten war nur mehr auf eine Einführung im Hause des Professors Lucius gerichtet, und schon eine Woche darauf hielt er um die Enkelin mit einem Ungestüm an, der den alten Herrn nicht wenig verdroß. Abgesehen davon, daß ihn ihre musikalische Laufbahn viel glänzender dünkte als die zweifelhafte Ehre, einem bayrischen Standesherrn, womöglich zur linken Hand, angetraut zu werden, mißfiel ihm die Unbelesenheit und Fahrigkeit des feudalen Freiers. Allein auch Helga hatte sich in den schönen Constantin verliebt. Indes sie den Großvater zu begütigen suchte, indes sie beteuerte, sie würde weniger denn je von ihrer Geige lassen, gebärdete sich Constantins Familie, als sei diese Braut eine vorbestrafte Landstreicherin oder etwas Verrufenes vom Varieté.
Fürst Währingen Fünfeck, der Vater Constantins, ließ sich den großen Karton bringen, auf dem sein Stammbaum mit allen Zweigchikanen eingetragen war, und im Beisein von zwei Schwägerinnen und einer Base strich er daraus den Namen des einzigen, pflichtvergessenen Sohnes; eine Zeremonie, welche die Gespräche der Münchener »grand monde« einen Tag lang in Atem hielt. Nur Wenige lachten. War auch die Fürstin Währingen mère eine kalte und unbeliebte Dame, so gab es einem solchen Unglück gegenüber nur Mitgefühl. Zenaide behalf sich mit zwei Kommentaren: »cela casse les vitres« oder »cela fend le cœur«. Der Waldmannsche Sprachschatz befand sich damals schon stark in Abnahme. Unwillkürliche Befriedigung empfand nur Constantins Vetter und Freund, der mittellose Aribert Zell, der nunmehr die Dame seines Herzens heimführen konnte. Constantin, über die Gleichgültigkeit selber erstaunt, mit welcher er das Gezeter der Seinen anhörte, und über die Kälte, mit der er sich von ihnen lossagte, unterließ jeden Versuch, die beiden Lager einander näherzubringen, denn angesichts der großen Selbstsicherheit auf der einen Seite, dem monumentalen Dünkel auf der anderen, konnte er nur mißlingen.
Statt aller Gratulation wurde der Braut bedeutet, daß ihr auf Rang und Titel ihres Gatten kein Anrecht zustünde und sie nur in der Eigenschaft einer Baronin Tuntenzell neben ihm figurieren könnte. Helga erklärte, dieser Name lächere sie an; Constantin, keinen Augenblick gewillt, sich anders als das angebetete Mädchen zu nennen, besann sich auf das zutiefst im Spessart gelegene Wasserschlößchen Herbst, das im Besitze der Familie stand. Als Herr und Frau von Herbst begaben sich die beiden seelenvergnügt auf ihre Hochzeitsreise und später zu längerem Aufenthalt nach Paris. Helga besaß dort von ihrem Vater her gute Freunde. Der vielseitige und interessante Mann war der Freund und Hausarzt der Botschaft gewesen, und die Sympathie übertrug sich ganz und gar auf seine Tochter. Die Franzosen sind nun einmal die konservativsten Leute der Welt. Als Helga ein Jahr lang am Pariser Konservatorium studierte, wurde sie von den ehemaligen Patienten des cher docteur mit offenen Armen aufgenommen, sie war und blieb auch jetzt die petite mignonne, die pauvre chérie, wenn auch bedauert wurde, denn sie war vermögend, daß sie einen Deutschen geheiratet hatte: »mais non pas un prussien«, hieß es zu seiner Entlastung, »de ›Bareith‹ très bien pensant, un catholique pratiquant«, denn Constantin schlenderte am Sonntag in die Madeleine, seine Frau aus der 12-Uhr-Messe zu holen. Zudem bestach sein Äußeres sowie die romantische Geschichte seiner Ehe.
Er selbst indessen überlegte hin und her, ob er Helga einer entfernten Tante und zwei Kusinen dritten Grades aus dem Faubourg St. Germain zuführen sollte oder nicht. Unterließ er es, so würden sie die schlimmsten Folgerungen ziehen, das wußte er wohl. Kurz entschlossen also brach er eines Morgens zu einer kleinen Rundfahrt in der Provinz mit ihr auf: zuerst nach Montcarlin, dem Schloß der Tante Hortense, nicht weit von Orleans. Es blickte recht stolz und einladend zu Tal, im Stiegenhaus und dem Riesensalon standen noch Tragsessel mit reichen Vergoldungen zu Jardinieren umgewandelt, und Azaleen strahlten in allen Ecken. Herr von Montcarlin hatte es bis zum Botschaftsrat gebracht, worauf er einen unannehmbaren Gesandtenposten angeboten erhielt und pensioniert wurde. Seitdem verfolgte er die Republik, die er doch viele Jahre vertreten hatte, mit seinem Haß, taufte die Place de la Concorde in die Place Louis XV. zurück und nannte die Herren am Quai d’Orsay, welche sich seiner Berufung nach London widersetzt hatten — mit Recht, denn er war ein Esel —, »dieses Pack«. Dagegen kramte er für Helga einen schmeichelhaften Brief Karls X. an seinen Großvater wie etwas ganz Aktuelles hervor, ja, unfähig, in seiner gekränkten Eigenliebe sein eignes Land zu lieben, deutete er auf eine große Karte Frankreichs, die über seinem Schreibtisch hing, und mit einem Lineal die verlorenen Provinzen umzirkelnd: »ein schöner Brocken, den sie hergeben mußten«, sagte er.
Damals ahnte noch niemand in ganz Europa, mit welchem Tempo die Geschicke des scheinbar so stabilen Erdteiles einsetzen sollten, auch Montcarlin ahnte nicht, wie ganz und gar er ein Vorläufer so mancher war, die ein Vierteljahrhundert später, als das Rad sich wieder drehte und die Sieger als die Besiegten nach unten trieb, mit ebenderselben Eiseskälte wie er sich von dem nationalen Unglück desinteressieren und der Einsicht in die wahren Ursachen desselben verschließen würden, Herrschaften, wie durchpausiert auf Herrn von Montcarlin, welchen die Partei, die Standesprivilegien und die zu rettenden persönlichen Vorteile alles, das ganze Vaterland mit einem Male nichts bedeuten sollte.
Constantin hatte drei Tage für den Besuch bei der Tante anberaumt, und der erste verlief noch mit leidlichem Glanz. Allein, Hochmut und Geiz waren die zwei Laster, welchen das kinderlose, steinreiche Ehepaar gemeinsam frönte. Der Garten, die Glashäuser, im herrlichen Stande übernommen, wurden zwar beibehalten, weil sich durch die Umsicht des alten Gärtners mancher Gewinn aus dem Prunk ziehen ließ, die übrige Lebenshaltung dafür so eingeschränkt, als wäre man ruiniert. »Marquis et Marquise de Montcarlin« stand auf ihrer Visitenkarte, aber es waren kleine Leute, dieses stand fest, da biß die Maus keinen Faden ab, das ließ sich nicht bestreiten, und eine Portierloge wäre die richtige Umrahmung für sie gewesen. Frühmorgens, denn er war noch rüstig, begab sich der Marquis in seinen spärlichen, schlecht geforsteten Wald und schoß Kaninchen für die Mahlzeit. Die Marquise betete. Das Schloß war in Hufeisenform, und dort, wo die Flügel sich landeinwärts öffneten, hatte sie als Abschluß eine Kapelle gebaut. Von ihren Fenstern aus sah die gelangweilte Helga sie tagsüber wohl an die sieben Male im Sturm darauflossteuern. Nicht lange, und sie trat wieder hervor, die Kapuze übergezogen, groß und stattlich im langen braunen, nach Heiligenart zurechtgeschnittenen Havelock. Denn Hortense, deren Ruf an den verschiedenen Höfen, an welchen ihr Mann akkreditiert war, je einige Stöße und sogar Beulen davongetragen hatte, war heute sehr bigott. Daß sie ihren Altweibersommer mit dem Altmännersommer des Marquis zusammentat, stand sie zwar nicht an, Helga mit einem Mangel an Scheu zu bedeuten, welcher diese zu Tränen anwiderte. Aber in Wahrheit sprachen die runden leblosen Vogelaugen ihres regelmäßigen, welken Gesichtes nur noch von einer Leidenschaft: der Neugier. Sie sahen nichts, aber sie bemerkten alles, und Helga mißfiel ihr. War es nicht unstatthaft, daß sie ihre Geige übte? Man hörte es bis in die Kapelle. Helga hatte sich zu dieser Kapelle nicht geäußert, sie keine zweimal betreten, diese Kapelle war aber der Stolz der Tante Hortense. Ihrer Sparwut freilich hatte sie dabei nicht entsagen können. Das Inventar war aus ordinärstem Tannenholz, die Glasmalereien schrecklich.
»Constantin hat sich da eine unsympathische Person geholt«, sagte Hortense zu ihrem Manne. Hatte sie ihr nicht das ganze Schloß, in der großen, mansardierten Kammer sogar die Brokatkleider und Courschleppen von dereinst gezeigt, serienweise in Riesenkoffern eingemottet, die ihnen zu Mausoleen dienten? »Cela ferait de belles chasubles«, bemerkte Helga, die eine so zwecklose Aufstapelung nicht begriff. Die Marquise warf den Deckel zu, daß er schnappte. »Laß uns morgen mit dem Frühzug fahren«, bat Helga ihren Mann. »Ich vertrage kein Kaninchenfleisch.« So wurde vorgeschützt, daß sie sich nicht ermüden dürfe und man zeitig am Tage bei der ersten Kusine dritten Grades eintreffen wolle.
Kein Schloß diesmal; das märchenhafteste aller Landhäuser, inmitten einer Stille, einer verzückten Baumeinsamkeit, von Vogelgesang erfüllt, nicht von Gezwitscher, von Gesang. Der großblumige Kretonne, das Mobiliar, der Duft, der es durchzog, die Lichtreflexe, die ihr Spiel zwischen den weißen Fensterläden und dem Grün des nahen Laubes trieben, durch das die Sonne brach, alles schien auf dieselbe Beschaulichkeit gestimmt, und hier sicher war das Glück zu Haus.
Allein Base Félicie, die Eigentümerin des schönen Gutes, eine noch hübsche, noch leidlich junge Witwe, war gar nicht lustig. Allzu eintönig zog sich ihr Dasein hin, das sie durch eine zweite Vermählung gerne lebhafter und kurzweiliger gestaltet hätte. Doch ihre ringsum begüterte Verwandtschaft duldete es nicht. Die arme Félicie wurde nur mit Ehepaaren eingeladen, mit dem Chanoine, dem Archevêque de Tours, als größter Sensation, und es fehlte ihr die Initiative und der Mut, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Schon bedrohte sie der schlimmste aller Specke; der des Kummers: ihre schöne siebzehnjährige Tochter, die strenge Adrienne, wollte ins Kloster treten, und wie hätte ein solcher Entschluß ihre Mutter nicht vollends eingeschüchtert. Was blieb ihr übrig, als auf dreißig Jahre oder mehr die ihr zugedachte Rolle einer Erbtante weiterzuspielen? An Adrienne mußte es liegen, daß hier wie in Montcarlin nichts wie Gebet- oder Erbauungsbücher die Regale in den Zimmern füllten. Helga schloß nur Félicie in ihr Herz. Ein Flügel, lang verstummt, stand in dem reizend ländlichen Salon. Helga holte ihr Instrument und zwang sie zu begleiten. Es war zuviel des Glücks für Félicie, die eine ganze Nacht durchweinte. Ach, wie sollte sie Helgas Drängen folgen, im Winter nach Paris zu ihr zu kommen? Vergnügungen, Konzerte, Theater, Bälle gar, war das etwas für eine Mutter, deren Tochter sich einkleiden ließ?
»Doch! Sie kommen! Sie müssen kommen!« rief ihr Helga noch zum Abschied zu, aber sie war froh, auch von diesem Ort zu scheiden, in dem nur die Bäume, die Vögel, die Schwäne des Teiches und die Blumen, vom Lichte umblaut, Gottes Wunder zu preisen schienen.
»Hast du keine heiteren Verwandten?« fragte sie Constantin in dem Wägelchen, das sie durch grüne Hohlwege der Station zuführte.
Constantin hatte die Kusine Philiberte für zuletzt aufgespart. Und nicht eine Kutsche wartete diesmal. Das Auto verstand sich dort von selbst. Da wurde getutet, schneidig jede Kurve genommen, da war man oben, ehe man sich’s versah, auf der vieltürmigen Burg, berühmt wie ihr Name, berühmt wie der Philibertes, wie Philiberte selbst im ganzen Land. Ja, das war ein Betrieb! Da hatten die Bahn, der Telegraph, die Brief- und Paketpost zu schaffen. Da war auch für das Leben der neueste Fahrplan Trumpf. Hinter der Welt selber jagte man her, auf Jachten, in Luxuszügen, per Auto. Irgend etwas entging einem dabei immer: und der Lido, das Engadin, Coventgarden oder Bayreuth, Caruso oder ein Rennen, eine Blumenausstellung, ein Kostümball oder das Requiem von Mozart, es war alles eins. Die Tage, die Jahre vergehen im Flug, wenn man nicht zu sich selber kommt; auch zum anderen nicht. Aber die junge Helga war fasziniert von so viel triumphierender Bejahung, von dem herrlichen Park, der sich bis zum Flusse hinzog und dessen Ufer meilenweit, wie es schien, für sich in Beschlag nahm, von der schönen Freudigkeit und Weite des Schlosses, der Buntheit und Pracht seiner Räume. Philiberte, ganz in Weiß, war die Treppe herabgeeilt und hatte sie in ihre Arme geschlossen. Helga schwärmte für Philiberte. Wo diese ging und stand, hob sie sich von der Türe, der Wand, dem Lichte ab, so stolz war ihr Relief. In Helgas Zimmer lagen unaufgeschnitten die neuesten Bücher. Sie legte eine Robe an, schwer mit silbernen Ähren bestickt. »Sollen wir gerade von hier schon morgen wieder fort?« rief sie zu Constantin hinüber.
Ein Fest war auch die Tafel. Philibertes Vorfahren, in Peruque, Kardinalshut oder Stuartkrause, sahen als stumme Zeugen von den Wänden herab; sie hatte ihren Bruder zu Helgas Tischherrn bestimmt. Er besaß ein machtvolles Schulterpaar, ganz Stoßkraft und Arroganz, wußte in allem Bescheid, sogar über Musik, über Musikkoryphäen wenigstens, auf Du und Du mit allen Berühmtheiten. Scheinbar sehr ernst faßte er sie ins Auge, wandte sich dann seiner anderen Nachbarin zu und ließ ihr alle Muße, Umschau nach Constantin zu halten. Seltsam: wo immer der sich befand, in einem III.-Klasse-Abteil oder einem Rahmen wie diesem, paßte er sich ganz von selber an. Nur nicht ihr. Die Entdeckung versetzte ihr einen Stoß. Die Tatsache, daß sie ihn zum ersten Male unter vielen Menschen, also gewissermaßen von der Entfernung aus betrachtete, rückte auch innere Distanzen zurecht. Zu einem richtigen Gespräch kam es fast nie zwischen ihnen. Gab da ein Wort das andere? war es eine wirkliche Vertraulichkeit? Nein. Gemeinsame Interessen? Gar keine. In diesem Schloß aber, in dem das regste Geistesleben herrschte und man die Künste liebte, gehörte er ohne jedes Umschalten natürlicher her als sie. Auch Miß Slocomb, die amerikanische Diva in erdbeerfarbenem Panne, mit der sich jetzt Philibertes Bruder so zwanglos unterhielt, fügte sich viel lückenloser hier ein. Sie starrte von Perlen und Diamanten. Es war Mode in diesem Jahr, sich heftig zu behängen. Ihre weißen Arme, ihre festen Hände waren immer in Bewegung, die Schärpe zu dirigieren, die immer von ihren Schultern glitt. Philiberte funkelte wie eine Sonne in ihrem goldenen Kleid. Helga trug zwar ein reizendes Diadem, aber als einzigen Schmuck. Philibertes Bruder hatte es schon mißbilligend bemerkt. Ohnedies der Frau abhold, ertrug er sie nur gepanzert sozusagen, wie die emaillierte Slocomb, deren blanke Augen kaum noch menschlich waren, oder stilisiert und undurchdringlich wie Philiberte, sein Geschöpf. Helgas fast jenseitige Lauterkeit schlug ihm wie ein Pesthauch entgegen.
»Werden Sie uns heute etwas spielen?« fragte er.
»Ich spiele gern«, erwiderte Helga.
Aber dies Spiel interessierte ihn nicht im mindesten oder nur insofern, als er suchen würde, es zu verhindern. Helga, innerlich sehr abgerückt, sah zu ihrem Mann hinüber und spann an dem Faden ihrer Wahrnehmungen weiter. Philibertes Bruder deutete ihr Schweigen als Schüchternheit: die kleine Bourgeoise war schüchtern. Ihren Blicken folgend: »Ce brave Constantin«, sagte er und erhob ein wenig sein Glas. Sein Ton, sein Lächeln gab ihr einen Stich, sie hörte die Abneigung für sie heraus, erwachte endlich und war nun ganz Ohr. Ich habe auch mein Patent, dachte sie. Aber ihr Himmel hatte sich umwölkt.
Philiberte indessen hatte noch nicht Zeit gehabt, ihre Sympathie überprüfen zu lassen, und verlangte im Lauf des Abends stürmisch nach Helgas Geige, und Helga, die viel lieber spielte als redete, ließ sich nicht bitten. Mr. Cresham, der Begleiter der Slocomb, jeder Zoll ein »inverti« und auf Schritt und Tritt von ihr mitgeführt, weil er sie nicht kompromittierte, setzte sich an den Flügel. Die anfängliche Geziertheit seines Spiels wurde bald überboten, ja sie verlor sich, so überzeugend, so innig und so sicher geboten ihre Kantilenen. Philibertes Bruder, der den Musiksaal verlassen hatte, kam gerade wieder, als die »adorable, merveilleux, enchanteur und encores« zum Lob der jungen Wienerin ertönten. Er machte dem Enthusiasmus ein Ende, indem er die Slocomb zum Flügel führte, zum Zeichen, denn er erlaubte sich alles, daß Nr. 1 des Programmes nunmehr erledigt und eine andere Sensation an der Reihe sei. Miß Slocomb, ihrer selbst an jenem Abend nicht eben sicher, hielt Helga zurück, räusperte sich und legte, um sich einzusingen, Noten für Klavier, Geige und Sopran aufs Pult. Es war eine Komposition von Reynaldo Hahn, und man brauchte gar nicht hinzuhören, so ganz von alleine ging sie ins Ohr, aber die »admirable, exquis und parfait« und ein noch gesteigerter Applaus machte sich am Schlusse laut. »You are divine!« rief Philibertes Bruder und trat hinzu. Er sprach mit einem Male englisch, um Helga nicht im Zweifel zu belassen, daß er nur ihre Partnerin meine. Zwiefach verletzt, für sich selbst wie für den schönen Durante, den nun der Schmachtfetzen begrub, legte sie ihre Geigenstimme wieder zu den anderen, und in um so liebenswürdigerem Tone, als sie ihrem Ärger durch ihre Worte genügend Luft machte, bemerkte sie lächelnd: »C’est de la musique pour des gens, qui ont bien diné!« Das vieltürmige Schloß hätte ebensogut über ihr einstürzen können, so verschüttet war es für sie durch eine solche Äußerung. Denn Hahn war Intimus des Hauses, Gönner und Schützling zugleich. Dem Bruder Philibertes, dem keiner der schneidenden Gegenhiebe beifiel, die er sonst immer bereit hielt, blieb nichts anderes übrig, als den Kommentar zu überhören. Auch Miß Slocomb, seinem Beispiel folgend, starrte Helga nur an. Denn ihr Kurs war schon gesunken. Sie hatte zwar wie ein Engel gespielt und wie eine Blume dabei ausgesehen, aber Musik hin, Musik her, hier gab Philibertes Bruder, der Arbiter elegantiarum, den Ausschlag.
Es ist etwas Eigenes um die Versnobtheit. Man sollte denken, Kellner, Portiers, Hoteliers, Gesellschaftsdamen, Hofdamen, Oberhofmeister, kurz Leute in abhängiger Stellung, neigten ihr vornehmlich zu. Aber der Snobismus ist eine Subalternität für sich. Es frönen ihm viele, die es nicht nötig haben, ja ein zeitgenössischer König sogar. In der Zeit, von der wir hier erzählen, war er schon stark ins Kraut geschossen, brüsten aber tat sich keiner noch mit ihm. Wenn auch mit Nachsicht schon, zieh man den Nächsten dieser Schwäche, für seine eigne Person gestand man ihn nicht ein. Noch hatte ihn die Welle nicht hochgetragen, Mode war er noch nicht. Geduld. Er wird auch wieder abwirtschaften. Die Intelligenz selber hat ihn auf den Thron gehoben. Was gilt’s? Sie wird sich seiner wieder schämen.
Die stolze Philiberte gab noch selben Abends in schüchterner Weise dem Bruder ihr Bedauern kund, daß Helga, deren Talent das der Slocomb so weit übertraf, nicht länger gespielt habe. »Du wirst mir doch nicht sagen«, fuhr er auf, »daß wir in Paris um gute Geiger verlegen sind.« Mit dieser typischen Antwort war der Fall erledigt.
Tags darauf, es war Montag, fuhren die meisten Gäste nach Paris zurück. Unter dem Vorwand, daß man heute ganz unformell zu Tische gehen wolle, kam Helga »miserabel zu sitzen«, wie Zenaide Waldmann es bezeichnet hätte. Constantin wurde von der Dienerschaft Monseigneur genannt, wie auch dazumal bei seinen früheren Besuchen, und unentwegt sprach man gemeinsame Freunde und Bekannte durch, welche Helga nicht einmal dem Namen nach kannte. Mit den allerherzlichsten Händedrücken und Phrasen vermied es Philiberte, sie beim Abschied ma cousine zu nennen; dafür verlautete die innigste Besorgnis, sie möge im Auto nicht frieren. Dann traten das Portal, seine Wappen, die Türme vor den Scheidenden zurück. Graziös wie ein Schlößchen und dennoch mächtig ragte die Burg. Helga warf einen letzten Blick über Fluß und Wald zu ihr hinüber. Oh, dieser verschmitzte und dabei wohlberatene Constantin, der sich gleich bei der Ankunft dem Drängen Philibertes, länger zu verweilen, so hartnäckig entzog. Warum aber hatte er sie in dies Wespennest geführt? Helga legte die Fahrt nach Paris in fast vollständigem Schweigen zurück. Sie hing ihrem Groll, Constantin seinen Gedanken, oder besser gesagt, seinen Hintergedanken nach. Zuunterst in seinem Koffer lag der ihm anonym zugesandte Schlüsselroman: »Die Tochter des Feldschers«, mit welcher Helga gemeint war. Als Verfasserin bekannte sich Hermine Brielmaier, die recht in Vergessenheit geratene einstige Gouvernante I. K. H. der Prinzessin Adelaide. Vielleicht würde man daraufhin sich ihrer entsinnen, sie nochmal zuziehen? Und wirklich kamen an die fünfzig Exemplare in Stadt und Land in Umlauf. Dann freilich schlugen die Wellen über Hermine Brielmaier und ihrem Buch auf immer zusammen.
Constantin fühlte sich wieder einmal der Trennung von seiner früheren Umgebung und ihrer Stickluft froh. In Wahrheit hatte auch er sich im stillen schon des öfteren gefragt, ob er mit Helga die richtige Wahl getroffen habe. Heute war er als Ergebnis der kleinen Rundreise seiner Sache sicher. Sie war alles, nur kein Abklatsch, keine Larve, keine Niete, sie war selbständig und sie selbst. Ob und wie sehr sie zueinander paßten, schien angesichts dieser Tatsache durchaus nicht wichtig. Sondern... sondern?... Was war das Wichtige? Aber Constantin pflegte sich alle unbequemen Antworten selber schuldig zu bleiben. Er machte dann einfach halt. Seine Gedankengänge waren vielmehr Stimmungsbilder, die sich augenblicklich in eine heitere oder düstere Laune umsetzten. Der Tag war schön, Pappeln wehten vorbei. Chartres rückte heran mit seiner Kathedrale; Constantin deutete bald auf diese, bald auf jene Aussicht. »Übertünchte Gräber«, sagte er plötzlich. »Wie, was meinst du?« fragte Helga.
»Der amerikanische Zeisig von gestern abend unter seiner rosaroten Steppdecke und ein paar andere noch. — Aber wir sind in Paris«, rief er und sprang auf. Die Gare St. Lazare wogte von Kommenden und Ziehenden wie ein Feld im Winde. Froher Dinge zog er Helgas Arm durch den seinen. »Süden, Osten, Westen«, sagte er, »daheim ist’s am besten!«