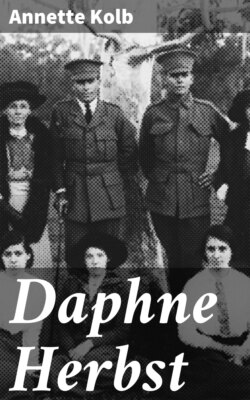Читать книгу Daphne Herbst - Annette Kolb - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
FÜNFTES KAPITEL
Weltbühne
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Mit Constantin war eine Veränderung vorgegangen, die man am wenigsten bei ihm erwartet hätte. Die Ferne lockte ihn nicht mehr. War es, weil ihm die Heimkehr so zerrüttet war? Oder reute ihn jetzt jeder Tag, den er auswärts verbracht hatte? Die Reisetasche, die Constanze so lustig verbarg, weckte zu trostlose Erinnerungen; sie trat nicht mehr in Gebrauch.
Es war die Zeit, in welcher die Trennung von Kirche und Staat schwere Konflikte im Innern Frankreichs erregte und die Vertreibung der lehrenden Ordensbrüder und Schwestern von peinlichsten Auftritten und Gewaltmaßregeln begleitet war. Helga fand diese Szenen abscheulich, wenn Constantin sie ihr berichtete, aber die politische Seite des Kampfes interessierte sie nicht. Sie stammte aus keiner klerikalen Familie. Als Kind hatte sie einmal einige Sommermonate in einem Erziehungskloster verbracht und es schlecht dabei getroffen. Unter den jüngsten Zöglingen befand sich die recht unschöne Tochter einer Witwe, deren kleiner Zuckerbäckerladen in demselben Städtchen stand, dem auch das Kloster angehörte. Zwei der Nonnen machten sich kein Gewissen daraus, dem Kinde alles andere wie eine Vorzugsbehandlung zu erweisen, hierin dem traurigen Beispiel ihrer Oberin folgend, welche, wenn sie das Wort an die Kleine richtete, etwas von Linzertörtchen einzuflechten liebte, dies in einem Tone, der sehr ausdrücklich besagte, daß ihre Herkunft zu gering sei für ein so feines Institut. Unvergeßlich, wie dann die Ohren des bläßlichen Kindergesichtes erglühten. Den Ausschlag für Helgas Idiosynkrasie gegen Klosterfrauen aber bildete eine Ansprache jener selben Oberin vor der versammelten Schar der Zöglinge, bevor diese in die Ferien gingen. Sie lobte darin die einen, tadelte die anderen, und auch da spielte jedesmal die Provenienz ihr Wörtchen mit; die mangelhafte Leistung der Konditorstochter verurteilte sie besonders barsch und schloß mit den unerhörten Worten: »Dabei hat deine Mutter die Pension noch nicht bezahlt.« Vermutlich wurde diese Roheit von dem Opfer derselben unschwer verwunden, sofern, wie wir hoffen, es bei Anbeginn des neuen Schuljahres nicht wiederkehrte und die Mutter, auf eine also vorgebrachte Mahnung hin, sich, was die unbezahlte Pension anging, als quitt erachtete. Für Helga aber wurden diese Eindrücke bestimmend, sie ließ nur Bettelorden gelten, Geldinteressen vertrugen sich nach ihrem Dafürhalten schlecht mit klösterlichen Orden; Geiz und Habgier wucherten an diesen weltabgewandten Stätten allem Anschein nach auch. Wir wollen hier nicht untersuchen, wie weit Helgas Meinung voreingenommen war, sie dankte sie nun einmal ihren persönlichen Erfahrungen. Auch sonst hätte die Trennung von Kirche und Staat sie niemals aufgeregt; in Constantin sprachen Atavismen mit, die bei ihr nicht in Frage kamen. Aber auch bei ihm wäre es ohne Tante Hortense zu keiner wirksamen Teilnahme gekommen. Sie sitzt auf Schloß Montcarlin, die Koffer voll eingemotteter Courschleppen. Sollte der Leser sie schon vergessen haben? Zu Unrecht. Denn sie befindet sich gerade in ihrem Element. Ja man darf wohl sagen, sie schwelgt. Jede Post bringt die Nachricht von einer neuen Freveltat, und es kommen Gäste, immer Gäste. Das Leben hier oben mit dem hageren Wäldchen war entsetzlich öde, die vielen flüchtigen Klosterfrauen aber, die schwergeprüfte Geistlichkeit war billig zu bewirten. Und die Opposition wuchs. Hei, sie wuchs! Der Marquis witterte Morgenluft, Restauration. Es schwebte ihm ein Einzug in goldenen Karossen vor, bei dem er selbst an erster Stelle figurierte. Am tollsten trieb es die Marquise. Kaum daß sie ihre Kapuze noch zurückschlug. Es tat ihr so wohl, die Heilige zu mimen. Immer zur Kapelle hin oder zurück, die Kerzen anzündend, sie verlöschend, die Knie beugend, wieder in die Höh’, immer geschäftig, Offizien veranstaltend, um ein »Tantum ergo« anzubringen, von dem sie die Stimmen herausgeschrieben hatte, die Begleitung selber spielte und die Sopranstimme selber sang. Das quietschende Harmonium, die musikalische Darbietung war ganz auf die Kapelle und die Glasmalereien gestimmt. Die armen Schwestern in ihrer seelischen Bedrückung kamen nicht zur Ruh’. Sie empfanden ihre Gönnerin, die in ihr Gebet einzuschließen sie sich verpflichtet fühlten, als recht lärmend, wenn sie sich auch nicht gestehen wollten, wie sehr die leblosen Spatzenaugen, der kleine welke und geschwätzige Mund der Marquise sie ermüdete. Selbst der junge und kluge Abbé Laurion, ob er auch ihre ganze Frömmigkeit als pure Spielerei erkannte, konnte es nicht wagen, ihr die Wahrheit entgegenzuhalten. Immerhin war ihr Schloß in diesen Tagen ein Asyl für viele, wenn auch alle es enttäuscht verließen. Sprach die Marquise so laut und unentwegt, um auch die bescheidensten Anliegen im Keime zu ersticken? — Ihr Geld blieb unantastbar wie ihre eingepfefferten Brokate. Kaninchenfleisch à discrétion, aber keinen Centime. Dafür gab sie jedem Schützling, der nach Paris fuhr, ein warmes Schreiben mit für Constantin, denn mit Empfehlungen kargte sie nicht. Constantin, von Natur hilfsbereit, brachte Mittel für die Weiterreise auf, nach Belgien, Bayern, Österreich. Manch rührend hilflose Gestalt stellte sich ihm dabei vor, der rasch gekaufte Laienhut saß ihr gar plötzlich zu Gesicht, baumelte seitwärts oder nach vorn. Aber das ewige Treppauf, Treppab, der einförmige Tonfall, der klösterliche Singsang der heimatlosen Frauen irritierten Helga. Es waren ihrer so viele. Am meisten verdrossen sie jedoch die fast täglichen Besuche des Abbé Laurion, und nicht ohne Eifersucht nahm sie den wachsenden Einfluß wahr, den er auf Constantin gewann. Fürs erste dadurch, daß er Hortense so klar durchschaute und indem er es zu vermeiden wußte, mit der Tür, in diesem Fall mit dem Fanatismus, ins Haus zu fallen. Sehr schön, ohne enge Gesichtspunkte und dadurch nur um so verfänglicher, im übrigen ein frommer, ja asketischer Priester, frönte er, als einzigem Entgelt für sein entsagungsreiches Leben, einer geradezu ungeheuerlichen Neugier, und Constantins Ehe erregte sie aufs höchste. Was da nicht stimmte, war viel leichter zu erkennen, als was da stimmte, wie das so geht. Helga, für alle Untertöne ungemein empfindlich, blieb ganz unnahbar. »Er ist ein enragierter Seelenretter«, sagte sie zu Daphne. Nicht daß sie religiösen Problemen aus dem Wege ging, aber alle Wörtlichkeiten trieben sie die Wände hoch, und sie mißtraute den wohldosierten geistlichen Zusprüchen dieses neuen Freundes. Vor ihm zeigte sich Constantin zu ihrer Bestürzung, wie keiner ihn noch gesehen hatte: »devot«. Bisher beruhte sein Katholizismus vornehmlich in einer stets regen Abneigung für Martin Luther und einer wohlwollenden Neutralität gegenüber den Juden. »Aber das genügte doch«, meinte Helga.
Daphne begleitete eines Morgens zwei Wiener Kusinen ins Panthéon. Da sie sich aber der Gruppe anschlossen, welche die Gräber besuchte, und sie selbst die Treppen noch möglichst meiden sollte, ging sie mittlerweile ins Freie und überschritt den Platz. Links schließt sich ihm gleich ein zweiter an, dem die Kirche von St. Etienne das Gepräge gibt. Streng und doch voll Anmut, eine richtige Lockung schien ihr dies zusammengetragene Stück Architektur. Durch die offenen Pforten brausten Orgeltöne. Viele Wagen harrten ihrer Insassen, den Kutschern hingen schwarze Florstreifen von den Hüten. Daphne war vor ihrer Krankheit an einem trüben Wintertage flüchtig einmal hier gewesen. Sie trat ein; auch im Inneren kam alles einem ersten Eindruck gleich. Sie sah die Fenster. Ihr dunkler Rubin fing das Feuer der Sonne, die eine schräge Strahlenbrücke mitten durch das Schiff gezaubert hatte. Kreuz und quer schlangen sich die köstlichen Galerien als steinerne durchbrochene Gewinde zwischen den Säulen und um sie herum, Girlanden, die nie verblühten. Der müde, weißhaarige Priester, welcher zelebrierte, der einsame Rhythmus seiner tausendmal vollzogenen Bewegungen, sein Hin und Wider am Altar, die tausend- und aber tausendmal gesprochenen Worte, die hier in ihren Sinn eintraten wie in ein Reich, das Ritornell der »Saecula Saeculorum«, das hier nicht Geleier wurde, sondern Melodei, die hellen Stimmen der Ministranten, das Tönen ihrer Silberschellen, das Schwanken der Weihrauchfässer, die Wolken, die sie als durchlichtete Schleier überallhin entsandten, und, o Glück, eine schöne und geschulte Frauenstimme, die jetzt ihr Solo anhub, alles nahm an der Verzückung teil. Eine selige Herberge, sie war’s. Das Wort »Kunstwerk der Zukunft« stand damals noch viel in Gebrauch, es stieg, sie wußte nicht warum, in Daphne auf. Doch welch ein Schreck, als sie, von dem goldenen Staube umsponnen, der mitten durch die Kirche zog, in einer der vordersten Bänke ihren Vater erkannte. Den schönen Kopf ein wenig zurückgelehnt, das Auge zu den herrlichen Fenstern aufgerichtet, schien er in Träumereien verloren. Es war dasselbe Gesicht, nur stiller, das sie eines Sommerabends im kleinen Jagdwagen an ihm gesehen hatte, als sie eine weiße Straße des steiermärkischen Gebirges zwischen Wäldern einem See zufuhren, der ihnen von weitem entgegenfunkelte. Neue Orgelklänge hatten eingesetzt, er blickte zum Chor hinauf, Daphne wollte sich schnell verbergen, da grüßte er zu ihr herüber, ein wenig überrascht, im übrigen »gottlob ganz wie in einem Konzertsaal«, dachte sie. Nein, ihn hier zu ertappen, sie war die Tochter ihrer Mutter und nannte es ertappen —, verletzte sie nicht. Dies war ein schöner und würdiger Ort, und Constantins neueste Phase war Liebhaberei vielleicht, aber nicht Spielerei, wie bei der entsetzlichen Hortense. Das Amt war zu Ende. Da Constantin seinerseits sie auch gesehen hatte, wartete Daphne vor dem Portal.
»Man muß St. Etienne du Mont vormittags und bei schönem Wetter wie heute sehen«, sagte er, und sichtlich erfreut, sie bei sich zu haben, zog er sie mit ins Café du Panthéon, bestellte Kaffee und vertiefte sich in die Zeitungen. Dann gingen sie zu Fuß das Quartier hinab. In der Rue Bonaparte blieb er plötzlich stehen. »Merk’ dir eines, Daphne«, und er schlug mit seinem Spazierstock auf das Pflaster, »aber sag’ es deiner Mutter nicht.«
»Was?« fragte sie beunruhigt.
»Es wird noch einen Krieg geben«, sagte er, »und warum?« fuhr er fort, »weil wir zu dumm sind. Niemand merkt es noch, wie dumm wir sind, weil wir so tüchtig sind. Lieber weniger tüchtig und nicht so dumm.«
Das Verdienst der heroischen Helga war es indessen, daß eine Art von Heiterkeit sich der Familie Herbst einbürgerte, kunstvoll zwar und der früheren sehr ungleich, die zu siegreich den Neid der Götter reizte. Jetzt glich sie einem Baum, der, am Abhang stehend, seinen Frühling feiert. Als letzter hinaufgerückt, bevor der dunkle Wald ansteigt, prangt er allein für sich in seinem Blütenkleid; so war hier eine auf dem dunkeln Grund der Trauer aufgerichtete Heiterkeit.
Von Flick durfte es nicht länger heißen, sie sei zu klein. Sie hatte das interessante Augenfleisch Constanzens, wenn auch nicht ihren Blick, die schönen Achseln Daphnes, wenn auch den kürzeren Hals. »Locken, aber kein Kopf«, pflegte ihr Vater sie zu necken, denn unter der blonden Fülle mußte man ihn förmlich suchen. Flick war ein Sammelsurium aller Ähnlichkeiten der Familie. Auch der Sinn für Komik, ein großes Nachahmungstalent drang bei ihr durch, nur minder lustig. Aber Helga machte immer ihre Vorzüge geltend, stets bemüht, sie denen der Geschwister gleichzustellen, und ließ sich, als fände sie eine Ablenkung darin, mehr und mehr von ihr tyrannisieren.
»Toll, wie die Mutter sie verhätschelt« — sagte Franzl. Er hielt sich ganz an Daphne. Sie war die Ruhe, die er in sich nicht finden konnte.
Heute sitzt sie wieder in ihr Modell, die Place Vendôme, vertieft, denn Franzl soll ihre besten Aquarelle haben als Andenken an zu Hause. Schon in den nächsten Tagen fährt er auf ein halbes Jahr zu Onkel Aribert, um in München seine Prüfungen zu überstehen. Er hat die drolligsten Einfälle, aber das Studium ist ihm verhaßt, und in ihm lebt das herbstische Grauen vor einer Bibliothek. Dabei steht er im Begriffe, eine neue Stiefelwichse zu erfinden, und baut Luftschlösser mit erträumten Patenten. Daphne überläßt ihm lachend ihre Schuhe zu Versuchsobjekten.
Ja, mit dem Pariser Heim wird es nun bald ein Ende haben, denn man will nicht getrennt von Franzl leben und nach Bayern ziehen. Auch deshalb malt sie immer wieder die Aussicht vor ihren Fenstern.
Die Mutter erscheint zum Ausgehen bereits im dunkelblauen Jackenkleid und weißplissierter Weste. Sie ist jetzt dreiundvierzig Jahre alt. Die Umrisse sind jung geblieben. Der Teint ist zart, nur die Haare sind eisgrau.
Noch ist es früh am Nachmittag, der große Verkehr hat noch nicht eingesetzt. Nur vor dem Portal des Hotels, schief gegenüber, spielt sich viel Abfahrt und viel Ankunft ab.
An der Beleuchtung liegt es, daß man heute alles so deutlich gewahrt. Ein weißlicher Himmel überhängt Paris. Die Säule, die Fassaden ringsherum sind ein einziges, unendlich stolzes, ein wenig nebliges und doch zeitloses, jahreszeitloses, herbstzeitloses Grau. Wer es herausbrächte, denkt Daphne. Sie bietet Helga an, sie zu begleiten.
»Nein, nütze dies wunderbare Licht«, sagt ihre Mutter. Mit ihr in eine Ausstellung zu gehen, war immer ein Vergnügen. Constantin verstand nichts von Gemälden. In allem waren sie verschieden.
Plötzlich zeigte sich der eben noch fast leere Platz schwarz von Leuten, Autos und Karossen. So wird es bleiben bis zum Abend; und so besehen, in einer Perspektive, die noch lange keine Vogelperspektive ist, kommt das Getriebe beängstigend gedrängt zum Ausdruck, als ein verwirrendes Chassé-croisé zwischen Vorsehung und blindem Zufall und als sei ein Anteilschein dieser vielen einzelnen an ein Massenschicksal nicht zu leugnen. Helga steht am Fenster und blickt hinab. »Es ist nicht die natürliche Bestimmung der Menschen, zu leiden. Es ist so vielfach ihr Los, aber ich glaube nicht, daß es ihre Bestimmung ist.« Sie sagt es nachdenklich, wie vor sich hin. Aber diese einfachen, mit so bedachter Ruhe ausgesprochenen Worte fallen wie Steine in einen Teich, ziehen Ringe, die sich ausbreiten, Reflexe verändern, Töne anschlagen in dem weißlichen Himmel, in den Daphne vertieft ist. Sie vergißt sie nie.
»Es wird spät«, ruft Helga, »adieu, zum Tee bin ich zurück«, und ist in ihrer schnellen Art schon zur Tür draußen. Daphne sieht sie in einen offenen Einspänner steigen, der hurtig auf die Boulevards losfährt. Man unterscheidet ihn nicht lange. Zwei Stunden später hat sie ihren Malerkittel abgelegt, sitzt im Salon, ein Buch auf den Knien, und überwacht die Teemaschine. Es stehen nur zwei Tassen bereit. Franzl hat seinen Lehrer bis um sechs, Constantin, der sich nie um diese Stunde zeigt, hat Besuch: den Abbé Laurion. Und wo steckt Flick? Sie ist mit Cilly in eine große Hundeausstellung gegangen, ermächtigt, ein Hündchen zu erstehen. Es ist der letzte Tag. Dann wollen sie zu Colombin zum Tee. Daphne ist allein. Sie ist — es wurde schon von ihr gesagt — ein höchst romantisches Wesen, in welchem kein Raum ist für Pandorens Trug, in dem Vernunft der Unruhe gebietet. Nie vorher, es wurde schon von ihr gesagt, hatte sich so viel Weisheit mit so viel Grazie umkleidet und die Taue eines so unschuldigen Lebens gelockert. Hier war alle Schwäche ausgeschieden, war alles Schönheitssinn und Stil. Zuletzt sind Linien, die uns fesseln, solche, an die wir uns nicht gewöhnen, und stete Neugier erregte diese schmale ernste Stirne mit den hochgezogenen Brauen, die leichtsinnige Anmut des kleinen Ovals, das unbeschreibliche Relief der fast bangen Umrisse und dabei die männliche Zurückhaltung in den durchdringenden Augen. Mit der schon damals herrschenden Mode hat sie es gut getroffen, denn sie ist nur ein Hauch. Auf ihren Zügen ist heute das halbe Lächeln, das sie nicht selten tragen. Ein weißes Kleid mit vergilbten Valenciennespitzen, ein Geschenk ihrer Mutter, liegt auf dem Najadenbett bereit. Es wird sie auf dem Ball heute abend wie eine Wolke hintragen.
Sie hat den Hang, sich kostbar anzuziehen. Sie flirtet auch: alles mit Maß. Mit dem halben Lächeln, das wir schon kennen.
Helga verspätet sich gern ein wenig. Doch nun wird sie gleich eintreten; etwas müde und abgehetzt. Da klingelt es schon. Es ist Helga. Aber keine Helga, die sich des Tees erlaben wird, keine Helga auf eignen Füßen, sondern von zwei Männern getragen, bewußtlos, als eine Sterbende.
Und welch ein Anlaß! — Schon hatte sie heil den Hausflur betreten, als sie sich auf die allerlei Päckchen besann, die im Wagen geblieben waren. Er stand noch in Sicht. Eben machte er kehrt. Sie lief ein paar Schritte zu ihm hin, versah sich der anderen Richtung dabei nicht, von der ein Auto aus der Rue St. Honoré einhergerast kam, nicht über sie hin, aber sie dennoch erfaßte, mit aller Wucht gegen ihren Kopf hinstieß und sie auf das Pflaster schlug. Ein Page, der sie schon ins Hotel zurückkommen und wieder forteilen sah, trat, von schlimmer Ahnung erfüllt, in den Kreis von Menschen, der alsbald die Verunglückte umstand. Schnell war sie den Blicken der Menge entzogen und ins Haus gebracht. Dies der Vorgang.
Nun ist eine Stunde verflossen. Der Arzt hat schonend seine Meinung kundgegeben. Wo Leben ist, sei Hoffnung. Eine so schwere innere Verletzung allerdings... doch würde sie das Bewußtsein voraussichtlich noch einmal erlangen. Daphne erkennt die Lage auf dem Fleck. Sie zieht die Vorhänge zu. Trotzdem dringt die Abendsonne bis zu dem Lager vor, auf welchem Helga in ihren Kleidern — denn man hat nicht gewagt sie anzurühren — gleich einer großen zerbrochenen Puppe liegt.
»Sie lebt!« rief Constantin.
Denn sie hat die Augen langsam aufgeschlagen. Sie ist erwacht. Sie ist im Bilde. Sie sieht sich selbst wie eine Fackel dem Wagen folgen, spürt das höllische Gewicht noch einmal sie zermalmen. Sie erkennt den Mann und ihre Kinder. Sie läßt voll unsäglicher Liebe ihre Blicke von Constantin zu Daphne gehen, von ihr zu Franzl und wieder zu Constantin zurück; dann noch einmal zu Daphne, bei ihr verweilend, als ob ein Anliegen sie mühe. »Sie sucht Flick, ihren Liebling«, glaubt Daphne und beugt sich herab.
»Nimm die Geige«, flüstert die Mutter. War dies ihre letzte Sorge? nicht Flick? War hier ein Band zerrissen, daß sie ihrer nicht gedachte? Aber schon fielen ihre Augendeckel wieder zu. Eine Brandung erfaßte nunmehr ihr Dasein, trieb es heran, richtete auch seine Ufer von neuem auf und ließ es verlaufen. Alle seine Phasen und Ereignisse begannen so brennend grell einander abzulösen, daß ihr armes Gesicht sie alle vortäuschte, sie, zwanzigjährig, als junge Frau, im Glanz der Lüster gleichsam, dann trübe, älter, geprüften Herzens spiegelte. Und dann? Was weiter? — Die Zeit reißt ab. Scheinbar bewußtlos, nur zu bewußt vielleicht, verliert ihr Fuß den Boden. — Constantin und Franz stehen von gnädigen Tränen erblindet, gewahren nichts. Daphne allein ist Zeuge. Da vernimmt sie von draußen ein Geräusch, unterdrückte Stimmen, das Schließen einer Türe. Flick! — Sie will sie vorbereiten und flieht ihr entgegen. Aber es ist nicht Flick. Die arme Flick sitzt ahnungslos mit Cilly bei Colombin, sie schenkt ihr Schokolade ein, seelenfroh hält sie das erworbene Hündchen unter dem Arm, hat schon den Namen dafür ersonnen und läßt sich Zeit. Daphne aber kehrt zurück, kommt wieder durch das Zimmer ihres Vaters und gewahrt — jetzt erst — im Zwielicht eine unbewegliche Gestalt. Es ist der schöne, ganz und gar vergessene Abbé Laurion. — Nein, denkt sie, ihre Mutter soll in Ruhe gelassen werden. In »Ruhe?« denkt sie schaudernd.
Laurion hat die Miene eines Menschen, der hart mit sich selbst im Kampfe liegt. Dennoch rührt er sich nicht, sagt kein Wort. Daphne hält ihm seine Zurückhaltung zugute.
»Wollen Sie Abschied von ihr nehmen?« fragt sie ihn; »sie wird Sie nicht erkennen.« Schweigend geht er da mit ihr.
Aber Helgas Augen stehen zum letzten Male offen; sie sieht ihn und starrt ihn an. Was begab sich da in Laurion, daß er mit allen Traditionen seines Standes brach? Wie einer, der in der Hitze des Gefechtes den Befehlen trotzt, auf eigene Faust die Führung an sich reißt, durch einen Akt der Insubordination das Rechte trifft, so vollzieht er keine Gebärde, läßt von äußern Zeichen ab, murmelt kein Gebet. Er schont auf seine Weise der schon so weit Entzogenen: er stört sie nicht. Die kosmische Luft, von Blitzen geladen, die in dieses Sterbezimmer schlug, umtost auch ihn. Mag der Glaube Berge versetzen, Anker darf er keine werfen, Wissen um letzte Dinge, ihr doppeltes Gesicht, ihrer Negationen Schoß offenbart er nicht. Von tausend Zungen lebt hier die Luft. Kein Ohr hat sie gehört, Helgas Lippen sind verstummt. Verabschiedet, hinausgeschleudert aus dem Erdenleben, schon von dem Tageslicht entlassen, schon geschieden von der Sonne, die noch zu ihr scheint. Bitterlich geweiht, liegt die erfahrene Helga. Mit sanften Fingern trocknet Laurion den Todesschweiß von ihrer Stirn. Seines Amtes gleichsam sich entkleidend, tritt er neu in seine Würden ein, den Begriff des Priesters, den die seelische Unrast des Menschen schuf, ganz und gar erfüllend. Blicke der Tröstung, der Beteuerung in diese untergehenden Augen tauchend, bringt er — als Lohn seiner Verzichte — ein Lächeln auf herrlichster Leidenschaft. Es ist das Lächeln eines himmlischen Verführers. Er hält, er trägt sie, sie stirbt in seinen Armen.