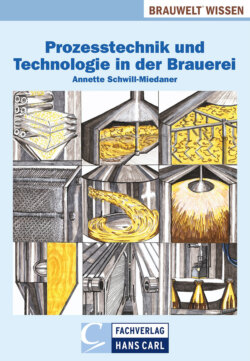Читать книгу Prozesstechnik und Technologie in der Brauerei - Annette Schwill-Miedaner - Страница 11
1.4.1.2Prallmühlen
ОглавлениеDie Prallmühlen dienen der Feinzerkleinerung. Der Energieeintrag erfolgt entweder durch einen schnell laufenden Rotor oder durch Gas- bzw. Dampfstrahlen. Demzufolge wird zwischen Rotorprallmühlen (Hammer-, Stift-, Pralltellermühlen) und Strahlprallmühlen unterschieden. In Ersteren werden Partikel-Werkzeug-Stöße, in Letzteren Partikel-Partikel-Stöße erzeugt.
Das Mahlergebnis von Prallzerkleinerungsmaschinen kann durch Umfangsgeschwindigkeit, Mahlspalte zwischen Rotor und Stator, Form, Größe und Anzahl der Zerkleinerungswerkzeuge, Mahlgutkonzentration im Mahlraum, Temperatur und Feuchtigkeit des Trägergases, Verweilzeit und Lochweite der Siebeinrichtung gesteuert werden. Da die Partikeln, je kleiner sie sind, eine umso höhere Festigkeit besitzen, müssen die Umfangsgeschwindigkeiten der Rotoren entsprechend größer sein, je feiner das Produkt vermahlen werden soll. [1.4, 1.18]. Der Einsatz zur Hartzerkleinerung ist aufgrund der starken Verschleißwirkung nachteilig.
Hammermühlen weisen im Prozessraum schnell umlaufende Rotoren auf. Ein Schlägerwerk zerkleinert das Malz zu Pulverschrot (> 70 % < 150 μm). An den Rotoren befinden sich gelenkig angeordnete hammerförmige Schläger (Flachstähle), die im Betriebszustand infolge der entstehenden Zentrifugalkräfte eine radiale Schlagstellung einnehmen (Abb. 1.16).
Abb. 1.16:Hammermühle [1.4]
Das Aufgabegut wird hauptsächlich durch Prall und Schlag beansprucht. Die Umfangsgeschwindigkeiten betragen zwischen 20 und 70 m/s [1.4]. Infolgedessen unterliegen die Zerkleinerungswerkzeuge einem nicht zu vernachlässigenden Verschleiß. Der hohen Vermahlungstemperatur muss durch eine ausreichende Ventilation entgegengewirkt werden. In der unteren Hälfte des Mahlraums befindet sich ein Siebmantel (0,5–1 mm), wodurch eine Feinheitseinstellung (Klassierung) der Partikeln erfolgt. Die Einstellung einer Inertgasatmosphäre schützt vor Explosionen. Ein hoher Energieeintrag ist erforderlich. Als spezifischer Kraftbedarf werden 7 bis 12 kWh/t [1.5, 1.15] bei bis zu 20 t/h genannt. Der Trend zu größeren Sieblochungen (≥ 2 bis 3 mm) führt zu einem geringeren Energieverbrauch sowie einer Verschleißminderung der Siebe und Hämmer. Die vertikale Ausführung der Hammermühle hat zudem einen um 30 % geringeren Energieverbrauch und benötigt keine Aspiration (Abb. 1.18) [1.19]. Außerdem ist die Beaufschlagung der Flachstähle (Flächenstoß) günstiger (Abb. 1.17).
Abb. 1.17:Auftreffen der Partikeln auf das Zerkleinerungswerkzeug (Flächenstoß/Kantenstoß) [1.4]
Abb. 1.18:Hammermühle, vertikale Ausführung [1.14]
Mit den oben beschriebenen Hammermühlen wird Schrot für Dünnschichtfilter hergestellt.
Stiftmühlen sind sieblos arbeitende Zerkleinerungsmaschinen (Abb. 1.19). Die Zerkleinerung erfolgt zwischen zwei mit konzentrischen Schlägerkreisen versehenen, ineinandergreifenden Schlägerscheiben. Es gibt zwei Ausführungen von Stiftmühlen: mit feststehender und umlaufender Stiftscheibe oder mit zwei gegenläufig rotierenden Scheiben. Das Mahlgut wird axial in den Prozessraum aufgegeben und durch die Zentrifugalbeschleunigung nach außen geschleudert. Dabei wird es durch die Schlägerkreise erfasst und überwiegend durch Prall, aber auch durch gegenseitigen Abrieb zerkleinert. Stiftmühlen werden für die Fein- und Feinstmahlung verwendet. Dazu sind Umfangsgeschwindigkeiten von bis zu 200 m/s notwendig. Eine Klassierung ist aufgrund der fehlenden Siebe nicht möglich.
Zur Feinstzerkleinerung und Desagglomeration werden Strahlmühlen eingesetzt, die ohne bewegte Maschinenteile arbeiten (Abb. 1.19). Es werden größere Stoßgeschwindigkeiten als in Rotorprallmühlen und infolgedessen höhere Feinheitsgrade erzielt. Das Mahlgut wird mithilfe eines sehr schnellen Gasstrahls auf 500 bis 1200 m/s beschleunigt und entweder gegen einen weiteren Gutstrahl aus einer anderen Richtung oder gegen relativ ruhendes Gut gelenkt, in seltenen Fällen auch gegen eine Prallplatte. Die Beschleunigung des Mahlguts erfolgt durch Druckluft oder überhitzten Dampf. Die Zerkleinerungswirkung beruht hauptsächlich auf gegenseitigem Partikelstoß, aber auch auf Reibung und Prall. Die Partikelgrößenverteilung wird über einen Sichter im Auslass der Strahlmühle reguliert [1.4, 1.18]. Es können Korngrößen < 2 μm erzielt werden. Der Nachteil liegt im geringen Durchsatz mit < 1t/h und dem hohen spezifischen Energiebedarf bis > 1000 kWh/t.
Abb. 1.19:Stiftmühle, Strahlmühle [1.4]