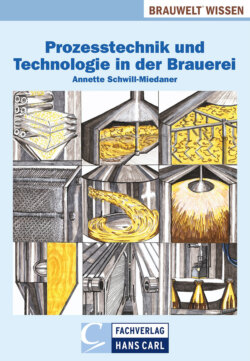Читать книгу Prozesstechnik und Technologie in der Brauerei - Annette Schwill-Miedaner - Страница 23
1.6.2MALZLÖSUNG
ОглавлениеDie Begriffe Malzqualität und Malzlösung stehen in engem Zusammenhang. Per Definition nach Lüers [1.30] liefert die Gesamtheit aller Methoden rückblickend ein Urteil über das Ausmaß der beim Mälzen stattgefundenen Veränderungen und vorausschauend Anhaltspunkte über die Verarbeitbarkeit des Malzes beim Brauprozess. Dies wird unter dem Begriff „Auflösungsgrad“ zusammengefasst. Die elementaren Veränderungen des Korns während des Keimprozesses betreffen neben den Wachstumserscheinungen des Blatt- und Wurzelkeims Umsetzungen im Mehlkörper, die durch bestimmte Enzymgruppen den Abbau hochmolekularer Reservestoffe in niedermolekulare Produkte bewirken. Palmer [1.31] stellte anlässlich des EBC-Congresses 1971 den Verlauf der Auflösung im Malzkorn schematisiert dar (Abb. 1.29).
Abb. 1.29:Gekeimtes Gerstenkorn [1.31]
Demnach verläuft die Auflösung vom Keimling parallel zum Schildchen auf der Rückenseite des Korns rascher. Diese Hypothese stellten Brown und Morris bereits 1890 auf [1.32]. Demzufolge ist das Korn unterschiedlich hart und man erhält ungleiche Mahlprodukte. Die Grobgrieße an der Spitze sind enzymarm sowie schwer aufschließbar und stellen beim Schroten einen Widerstand dar. Bei den Feingrießen, die sich bevorzugt in der unteren und z. T. mittleren Kornregion befinden, sind die Zellwände bereits abgebaut. Das bedarf keiner weiteren Zerkleinerung und liefert die Hauptmenge an Extraktbildnern. Sowohl Feingrieße als auch Mehl sind wasserlöslich oder enzymatisch gut angreifbar.
Fazit: Je knapper die Malzlösung ausfällt, desto härter ist das Korn und umso gröber fällt das Schrot aus. Je schlechter die Auflösung, umso wichtiger ist die Schrotbeschaffenheit.
Wird Malz infolge unsachgemäßer Lagerung feucht (6–10 %), so fällt das Schrot gröber aus und die Ausbeuteverluste steigen an. Dieser Negativeffekt kommt bei der Malzkonditionierung nicht zum Tragen, da nur vorwiegend der Wassergehalt der Spelzen erhöht wird.
Rein aus der Empirie äußert sich die Malzauflösung durch mechanische Zerreibbarkeit des Mehlkörpers. Im Lauf der letzten 80 Jahre wurden zahlreiche Methoden entwickelt, um die cytolytischen Vorgänge im Korn möglichst vollständig zu beschreiben [1.33]. Das Ziel, die Cytolyse nur durch eine Analyse zu erfassen, konnte bis heute nicht realisiert werden.
Tab. 1.5:Analysenmethoden zur Beurteilung der Cytolyse
| chemisch | mechanisch | |
| M/S-Differenz | ||
| Friabilimeter (inkl. ganzglasige) | ||
| Viskosität | Blattkeimentwicklung | |
| der Kongresswürzeder 65 °C-Würze | Schnittprobe (Längsschnitt) | |
| ß-Glucan | Härtetest nach Brabender | |
| der Kongresswürzeder 65 °C-Würze | ||
| Färbetest | Schrotsortierung (Prior 1896) | |
| MethylenblauCalcofluor | Pudermehlgehalt (Hartong 1939) Feinanteil über PGV 1994 |
Tabelle 1.5 gibt hierzu einen Methodenüberblick: Der Analyse der Mehl-Schrot-Differenz liegt der Gedanke zugrunde, dass mit zunehmender mechanischer Lösung des Mehlkörpers auch gröbere Schrotanteile infolge der ansteigenden Permeabilität ihren Extrakt ähnlich leicht hergeben wie das Feinmehl. Der Nachteil dieser Methode liegt in ihrem hohen analytischen Fehler. Die Viskosität der Kongresswürze lässt bei gut und sehr gut gelösten Malzen kaum Unterschiede finden. Die klassischen Analysen aus der Kongresswürze zur Charakterisierung der Mehlkörperlösung versagen bei inhomogenen Malzen. Aussagefähiger ist dagegen die in der VZ 65 °-Maische bestimmte Viskosität. Sie spiegelt die Wirkung des ß-Glucansolubilasenkomplexes wider, der die Esterbindung zwischen Eiweiß und Hemicellulose spaltet und damit hochmolekulares ß-Glucan, möglicherweise auch Pentosan [1.34] freisetzt. Demnach treten bei inhomogenen Malzen in der 65-°C-Maische gegenüber der konventionellen Kongresswürze erhöhte ß-Glucangehalte und Viskositätswerte auf. Der Verdacht auf Inhomogenität besteht dann, wenn bei ß-Glucan eine Differenz von > 150 mg/l zur Kongresswürze und bei der Viskosität ein Anstieg um 0,1 mPas vorliegen. Mit dieser geschilderten analytischen Weiterentwicklung kann das Inhomogenitätsproblem eingegrenzt werden. Das isotherme 65-°C-Maischverfahren führt zu einer praxisnäheren Beurteilung neuer Züchtungen und spiegelt die heute angewandten Maischverfahren mit kurzer Maischzeit und höherer Maischtemperatur besser wider. Deshalb und wegen der genaueren Differenzierung cytolytischer Merkmale löst das isotherme 65-°C- Maischverfahren das seit 1907 bestehende Kongressmaischverfahren für die Analytik von hellem Gerstenmalz künftig ab.
Die Schleif- und Färbemethoden (s. Bildanalyse) geben zwar gute Aussagen zur Auflösung und Homogenität, sind aber von der Präparationszeit und Auswertung her sehr aufwendig. Grundlage ist der direkte Nachweis hochmolekularer ß-Glucane im Malzendosperm. Im Kornlängsschnitt werden die ß-Glucane mit einem MG > 10000 D in den ungelösten und teilgelösten Endospermbereichen mit Calcofluor gefärbt, mit Fastgreen gegengefärbt und bei UV-Anregung als Fluoreszens sichtbar gemacht. Die Auswertung erfolgt über CCD-Kamera und Bildanalyse-Software. Über den Anteil des ungelösten (gefärbten) Bereichs zur Gesamtfläche des Malzkorns erfolgt eine Einteilung in die Auflösungsklassen. Ergeben sich Maxima in einzelnen Modifikationsklassen, ist das Malz inhomogen. Aus dieser Auswertung ergibt sich eine Prognose zum Ablauf bei der Würze- und Bierfiltration [1.35]. Ebenso kann zur Beurteilung der Läuterarbeit neben dem ß-Glucan-Gehalt die Analyse des Arabinoxylans (Pentosan) dienen [1.36].
Mit einer weiteren auf dem Einsatz von Calcofluor basierenden Methode ist es möglich, hochmolekulares ß-Glucan mittels Fließ-Injektions-Analyse zu quantifizieren.
In der Praxis ist häufig der Friabilimetertest, der als Screening bei der Malzanlieferung eingesetzt wird, zu finden. Die so ermittelte Mürbigkeit zeigt eine hohe Korrelation mit dem Anteil unterlöster Malze in Mischungen. Andererseits muss ein guter Friabilimeterwert (> 85 %) nicht zwingend eine günstige Viskosität und Mehl-Schrot-Differenz bedingen. Der Brabenderhärteprüfer kann als gedanklicher Vorläufer zum Friabilimeter gewertet werden, da die Kraft gemessen wurde, die nötig war, um vorgebrochenes Schrot weiter zu vermahlen. Nicht unerwähnt bleiben soll die Blattkeimentwicklung, wobei diese nicht parallel zur Auflösung des Malzes verlaufen muss. Auch die Bestimmung der Mehligkeit mittels Längsschnitt reichte allein nicht aus. In Zusammenhang mit der Laserbeugungs-Methode ist der Vorschlag von Prior 1896 hervorzuheben, Malz bei bestimmtem Walzenabstand zu schroten, um aus der Verteilung der einzelnen Schrotsortierungsanteile auf die Mürbigkeit zu schließen. Hartong griff diesen Gedanken 1939 auf und untersuchte die Pudermehlgehalte während der gesamten Keimzeit.
Basierend auf diesen geschilderten technologischen Zusammenhängen wurde untersucht [1.37], wie sich die unterschiedlichen Malzqualitäten auf die Feinfraktion des Schrots auswirken. Die zur Untersuchung herangezogenen Malze unterschiedlicher Lösung wurden durch Variation der Keimungsparameter (Temperatur, Zeit und Feuchte) aus ein und derselben Gerstensorte hergestellt.
Abb. 1.30:PGV von geschroteten Malzen unterschiedlicher Keimtemperatur [1.37]
Stellvertretend ist in Abbildung 1.30 die Partikelgrößenverteilung (PGV) der Malze aus der 12, 15, 18 °C-Keimung (44,5% Feuchte, 6 Tage) mit der zugehörigen Schwankungsbreite (3-fach-Ansatz, P = 95 %) dargestellt. Das Malz aus der 15-°C-Keimung weist, gefolgt vom Malz aus der 12-°C-Keimung, den höchsten Feinanteil auf. Den gängigen Malzanalysedaten entsprechend, ist es als gleichmäßig und gut gelöst zu charakterisieren. Aufgrund der niedrigeren Temperatur fallen die Umsetzungen beim 12-°C-Malz geringer aus. Bei der 18-°C-Keimung beginnt die Lösung zwar schneller und intensiver, doch verläuft sie sehr ungleichmäßig, was einen z. T. überlösten Mehlkörper mit harten, glasigen Spitzen („Lösungsgefälle“) zur Folge hat. Dies geht zu Lasten des Feinanteils. Die vergleichsweise großen Konfidenzintervalle lassen sich mit der Inhomogenität begründen, die aus der hohen Keimtemperatur resultiert. Die Messung erstreckt sich hinunter bis in den Größenbereich der Stärkekörner (5–30 μm).
Insgesamt zeigte sich, dass sich die Maßnahmen, die der Steigerung der Malzhomogenität förderlich sind, in der Partikelgrößenverteilung des Schrots (höherer Feinanteil) niederschlagen und stark inhomogene Malze anhand der geschilderten Methode unterschieden werden können.