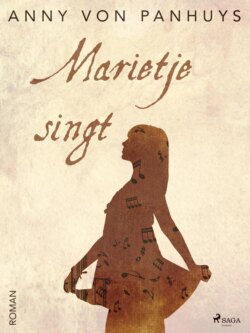Читать книгу Marietje singt - Anny von Panhuys - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III.
ОглавлениеMarietje war nicht zu bewegen gewesen, schon am Donnerstag mit der Sängerin und deren Vater von Marken abzureisen.
„Am Sonnabend erst kommt Heiko Barends heim,“ wiederholte sie auf jede Frage, „und ohne Abschied kann ich nicht von ihm gehen.“
Die Witwe erklärte dazu lächelnd, die beiden hätten sich gern, das wüsste jedes Kind auf Marken.
Als der alte Kapellmeister das hörte, versuchte er noch einmal, seine Tochter zu bestimmen, auf ihren Wunsch zu verzichten.
„Lass das Mädchen in seiner Heimat, lass sie bei ihrem Fischerburschen; so ein weltfremdes Ding gehört nicht in das verlogene Treiben unseres modernen Lebens. Hier wurzelt ihr Fühlen und Denken, reiss’ sie nicht heraus aus ihrem Erdreich.“
Gertrud lachte.
„Wie amüsant du bist, Papa. Sprichst gar nicht wie ein richtiger lustiger Berliner. Wenn Marietje erst mal in das Erdreich verpflanzt ist, in das sie ihrer Stimme wegen gehört, vergisst sie den Fischerburschen rasch genug.“
„Aber ob der Fischerbursche sie vergisst?“
„Aber, Papa, sei doch nicht so entsetzlich schwerfällig. Der Fischerbursche kann uns doch völlig gleich sein. Ich finde es nett genug von uns, unsere Abreise noch aufzuschieben, damit Marietje von ihm Abschied nehmen kann.“
Aber wenn auch der alte Mann seiner vergötterten Tochter nicht mehr laut widersprach, innerlich vermochte er sich jedoch nicht mit ihrem Vorhaben, die blonde Markenerin nach Berlin mitzunehmen, zu befreunden. Wenigstens jetzt nicht mehr, jetzt, da er wusste, dass es da einen jungen Fischerburschen gab, den Marietje lieb hatte. Hätte Gertrud nicht verstanden, die Habsucht der Witwe zu erwecken, wer weiss, ob Marietje sich jemals dazu bereit erklärt hätte, mitzukommen. Aber das „Vielgeldverdienen“ war der Köder gewesen, darauf die armen Weiber angebissen hatten.
Max Frenzau lächelte ein bisschen gerührt. Wenn aus dem Fischermädel erst einmal eine Dame geworden, die durch ihren Gesang imstande war, ein paar tausend Gulden zu verdienen, dann würde sie wahrscheinlich die Heimat einmal flüchtig besuchen, aber völlig dahin zurückkehren, um da zu leben wie vordem und vielleicht eine einfache Fischersfrau zu werden wie die Mutter und alle anderen ringsum — nein, dazu war die blonde Marietje dann wohl verdorben.
Schade um das hübsche Naturkind, dachte der Alte und beschloss, ein Auge darauf zu haben, dass Lüge und Heuchelei, die Marietje nicht kannte, sich nicht allzu dicht an sie heranwagten.
Gertrud Frenzau liess den Lehrer von Marken zu sich bitten.
Sie hielt den Wunsch der Witwe, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, für völlig gerechtfertigt und fand das heimliche Misstrauen, das hinter diesem Wunsche stand, ebenfalls begreiflich. Was wussten die weltabgeschiedenen Leute von Marken auch von ihrem Vater, dem einstigen kleinen unbekannten Kapellmeister, und von ihr, der berühmten Sängerin! Ihr Name war ihnen ein leerer Schall, der an ihrem Ohre vorüberschwebte, der ihnen nichts zu sagen hatte, gar nichts.
Und der Lehrer fand sich auf Gertrud Frenzaus Bitte in dem kleinen Gasthof am Strande ein. Er hatte schon mit der Witwe über alles gesprochen, das merkte Gertrud sofort, und wusste vollkommen, um was es sich handelte.
Er war auch ein Sohn des kleinen Inselreichs, und sein Wesen war bescheiden und zurückhaltend wie das der Markener. Er war ein noch junger Mensch, und seine breitschulterige Blondheit sass der weltgewandten schwarzäugigen Sängerin etwas befangen gegenüber. Aber trotzdem hatte er den Mut, seine Meinung zu äussern.
„Sehen Sie, Mevrouw,“ sagte er, „es ist etwas ganz Eigenes, dass ein Mädchen von Marken so weit fortgehen will. Das ist noch nicht dagewesen, und keiner der Markener wird Verstehen dafür finden. Offen heraus, Mevrouw, es liegt etwas Unnatürliches in solchem Tun, und es kann kein Segen daran hängen.“
In seinen blauen Augen, die vordem so versonnen dareinblickten, leuchtete es warm, heimatbegeistert auf.
„Wer auf Marken geboren ist, soll auf Marken bleiben, das ist ein altes, ungeschriebenes Gesetz, das mehr Gültigkeit besitzt als viele der geschriebenen Gesetze, die sich die Menschen da draussen gemacht haben.“
„Starre, ungeschriebene Gesetze sind dazu da, einmal von einem Mutigen gebrochen zu werden, einer muss doch den Anfang machen, sonst werden solche Gesetze zu Tyrannen, werden zu einem Zwang,“ widersprach die Sängerin.
„Ich denke anders darüber, Mevrouw.“ Der junge Lehrer ging jetzt mehr aus sich heraus. „Ohne solche ungeschriebenen Gesetze, die nur auf Äberlieferung beruhen und im Wesen und Charakter der Markener begründet sind, wäre die Bevölkerung der Insel wohl nicht mehr der alte, wetterfeste, seetüchtige Menschenschlag von einst, der sich durch Jahrhunderte rein und kraftvoll erhalten hat. Wie schwer und einförmig auch die Tage über Marken hinwegschweifen, Heimatluft lässt sie erträglich sein. Ewig ist unsere Inselheimat vom Meer bedroht, aber die unaufhörliche Angst um unseren, in den Augen der Fremden armseligen Besitz lässt sie uns teurer werden nach jedem Nordost, der unsere Deiche durchbrechen will. Mit trotzigem Fleiss verteidigt der Markener die Insel gegen das immer auf der Lauer liegende feindliche Meer. Immer müssen wir wach sein vor Gefahr. Die stete Gefahr hat uns schweigsam werden lassen, aber wenn wir es auch nicht so in Worte kleiden können, unser Herz, das hängt an der Heimat und hält daran fest. Und ich denke mir, eine richtige Markener Brust kann da draussen in der Fremde gar nicht atmen vor unsäglicher Sehnsucht nach unserer kleinen Insel. Ich habe das am eigenen Leibe erfahren, als ich ein paar Jahre in Amsterdam zubringen musste, wo ich lernte, um lehren zu dürfen. — Deshalb, Mevrouw,“ er schluckte ein paarmal, ehe er weitersprach, und der Ton ward schwerfälliger, „ist es besser, Marietje van Daalen bleibt hier, wo sie hingehört.“
Gertrud Frenzau errötete vor Ärger. Auf Widerstand von dieser Seite war sie nicht gefasst. Sie hatte gemeint, mit dem blonden tappigen Kerl würde sie rasch einig werden und unter ihren Glutblicken würde er kein Wort des Widerspruchs finden. Statt dessen hielt er ihr eine lange Rede von Heimatliebe und dergleichen.
„Sie haben mich vollkommen überzeugt, Herr Lehrer, das heisst, im allgemeinen überzeugt. Im besonderen ist’s aber doch etwas anderes. Marietje van Daalen besitzt eine herrliche Stimme, und es wäre sündhaft, wenn diese Stimme ungehört von aller Welt hier langsam alt und brüchig würde.“
„Wir freuen uns auf Marken alle, wenn Marietje singt,“ versetzte der Lehrer schlicht.
Gertrud lächelte. „Ach, Sie wollen mich nicht verstehen. Ich möchte, dass auch die grosse Welt den köstlichen Schatz kennenlernt, den Marietje van Daalen ihr eigen nennt.“
„Ich begreife das, Mevrouw,“ die Augen des Lehrers bekamen einen verlorenen, ins Weite schweifenden Blick, „aber Marietje passt nicht in die Welt, für die Sie sie fordern.“ Ein Lächeln huschte um seinen Mund: „Ich glaube, Mevrouw, der liebe Herrgott hat Marietje die schöne Stimme geschenkt, um seinen Markenern eine Freude zu bereiten, weil sie sonst so wenig Freude haben. Lassen Sie uns deshalb Marietje, Mevrouw, Marietje und ihre Mutter sind zwar fest entschlossen, weil sie die Aussicht auf das Geld blendet, aber ich denke, ich rede die beiden wieder zur Vernunft.“
Herrgott, war das ein halsstarriger Bursche! Gertrud ärgerte sich ernstlich.
„So kommen wir nicht weiter, Herr Lehrer,“ fing sie an, und ihre Hand fingerte nervös an der goldenen Lorgnette. „Ich bin mit Marietje und ihrer Mutter einig, es handelt sich ja nur noch darum, dass ich Ihnen einige Auskünfte über meinen Vater und mich erteile und Ihnen unsere Legitimationspapiere zeige, damit Sie wissen, dass Sie es mit anständigen Menschen zu tun haben — denn deshalb wünschte doch die Witwe van Daalen hauptsächlich, dass Sie sich mit mir besprechen,“ setzte sie mit leisem Lächeln hinzu.
„Jawohl, Mevrouw.“ Sehr kurz sagte es der Lehrer. Alle Redefreudigkeit schien wieder so plötzlich von ihm gewichen, wie sie gekommen.
Gertrud lächelte siegesgewiss. Also so musste man den Menschen behandeln. Sie erhob sich und holte ein Täschchen herbei, aus dem sie verschiedene Papiere nahm, die sie vor dem Lehrer ausbreitete.
Der betrachtete eingehend den Stempel des Passes, vertiefte sich darauf in einen Berliner Steuerzettel, den er wie eine seltene Kuriosität hin und her drehte, und meinte dann: „Soviel ich davon verstehe, stimmt wohl alles.“
Und mit wärmerem Klang in der Stimme: „Ich glaube ja auch nicht, dass Marietje bei Ihnen, in Ihrem Heim, irgend etwas Böses droht, aber ich bleibe dabei, wer auf Marken geboren ist, soll Marken nicht verlassen.“
Gertrud achtete gar nicht mehr darauf, was der blonde, breite Mensch sprach. Sie schrieb ihre Adresse auf und reichte sie dem Manne.
„Ich werde auch Marietjes Mutter eine Adresse dalassen,“ sagte sie, „für alle Fälle.“
„Marietjes Mutter kann nicht schreiben. Das verlernt sich wieder, wenn man nie Gelegenheit hat, die Finger zu üben.“
Der grosse Mensch erhob sich.
„Es genügt, wenn ich die Adresse besitze. Ich will sie mir zu Hause noch einmal in mein Merkbuch schreiben, damit ich sie nicht verliere.“
„Ich danke Ihnen, Herr Lehrer, dass Sie so gütig waren, zu kommen.“
Gertrud Frenzau neigte graziös den dunklen Kopf und zeigte ihr liebenswürdigstes Lächeln.
Unbeholfen verneigte sich der junge Recke, und während er sich zum Gehen wandte, sagte er treuherzig: „Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie recht viel Freude an Marietje erleben mögen.“ Jedoch vor der Tür murmelte er vor sich hin: „Es kann keinen Segen bringen, wenn eine von Marken in die Fremde geht und die Heimat verlässt um des Geldes willen.“
Als Heiko Barends an diesem Sonnabend in den Hafen eingefahren war, stand Marietje am Strande und wartete auf ihn.
Ganz selbstverständlich stand sie da, und ohne Worte wusste Heiko, Marietje hatte ihm etwas zu sagen. Als wäre es vorher so verabredet, schlugen sie einen Seitenpfad ein, der mit einem Umwege zu dem Hause der Witwe van Daalen führte.
„Ich möchte was reden mit dir,“ begann Marietje, nachdem sie sich hatte erzählen lassen, dass Heiko einen guten Fang gemacht.
Heiko nickte. Das hiess: Sprich nur.
„Ich will dir Lebewohl sagen, Heiko Barends, weil ich morgen mit der deutschen Herrschaft, die drunten am Strande wohnt, fortgehe.“
Der Fischer lachte leise. „Auf was für Witze du kommst, Marietje! Bist du so lustig gestimmt?“
„Es ist mein Ernst, Heiko,“ nickte sie. „Die Fremden haben mich singen hören, und die Dame sagt, mit solch einer Stimme, wie ich sie habe, könne man viel Geld verdienen. Tausende von Gulden.“
Heiko Barends spuckte kunstgerecht aus und schob den Tabak, den er kaute, in die andere Mundfeite. „Dummes Zeug, dafür bezahlt doch keiner was.“
„Doch, Heiko, doch!“ Marietje wiederholte, was Gertrud Frenzau darüber gesagt, und erzählte auch, dass der Herr Lehrer gemeint, es schienen sehr feine, reputierliche Leute zu sein, die Fremden, und er habe ihre Papiere gesehen und alles sei darin in Ordnung.“
„Wenn ich ein paar tausend Gulden beisammen habe, komme ich wieder,“ brachte sie ihr Sprüchlein an.
Der grosse Bursche zog ein verblüfftes Gesicht.
Ein paar tausend Gulden! Wie sicher Marietje die ihm riesenhaft dünkende Summe aussprach.
„Dass man für Singen so viel Geld bekommen soll!“ kopfschüttelte er wieder und wieder.
Leiser setzte er hinzu: „Es wäre aber trotzdem besser, die bliebest hier, Marietje, weil ich doch dachte“ — er warf einen halben Seitenblick auf das Mädchen — „nun, weil ich dachte, — weil ich meinte — —“ Er vollendete nicht.
Aber Marietje erglühte, als hätte ihr Heiko soeben eine feurige Liebeserklärung gemacht.
„Ja, Heiko, aber ich finde, auf ein paar Jahre kann’s doch nicht ankommen, ich bleibe doch nicht fort. Und wenn ich zurückkehre, bringe ich viel Geld mit und davon kannst du dir ein neues Boot kaufen und — — —“ Sie brach plötzlich ab, beinahe hätte sie auch von den neuen Netzen gesprochen, und die sollten doch eine Überraschung sein.
Heiko Barends rollte seinen Tabak von einem Mundwinkel in den anderen. „Das wäre fein!“ stiess er endlich hervor. Die Aussicht auf das später zu erwartende neue Boot erstickte alle Wenn und Aber.
„Der Herr Lehrer hat meine Adresse,“ Marietje lächelte, „und wenn du willst, kannst du mir öfters schreiben.“
„Ach, Marietje, allzu häufig wird daraus nichts werden.“ Und dann blieb Heiko stehen und zwang das Mädchen durch festen Druck auf den Arm, gleichfalls die Schritte anzuhalten.
„Aber eins möchte ich dir noch sagen, Marietje, ehe du gehst.“ Er sah ihr mit einem Blick voll unendlicher Liebe in die Augen. „Wenn einmal in der Fremde Sorge und Kummer an dich herantreten, und du dir nicht allein zu helfen weisst, dann schreibe mir, dann hole ich dich in die Heimat zurück.“
„Ja, Heiko, das verspreche ich dir,“ ernst und feierlich gelobte sie es.
„Dann will ich dir Lebewohl sagen, Marietje.“
Der Fischer streckte der vor ihm Stehenden die Rechte entgegen, und plötzlich legte sich ein heisser Männermund auf ihre kühlen, unberührten Lippen.
„Lebe wohl, meine Marietje.“ —
Heiko setzte sich in Trab, er wollte nicht weich werden, das Heulen war Weibersache.
Marietje erwachte wie aus wehmütig süssem Traume und fand sich allein. Gar zu schwer dünkte es ihr mit einem Male, Marken zu verlassen. Aber sie dachte an das neue Boot, an die neuen Netze — langsam schritt sie heimwärts.