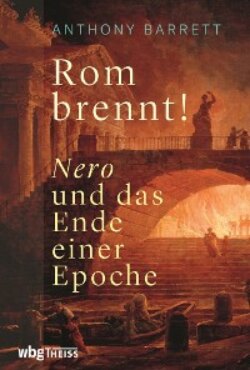Читать книгу Rom brennt! - Anthony Barrett - Страница 10
Das antike Rom
ОглавлениеDer Große Brand ereignete sich in einem bestimmten historisch-politischen Kontext. An sich war er jedoch ein physisches Phänomen, das in einer bestimmten physischen Umgebung auftrat und in gewissem Maße von ihr gestaltet wurde. Deshalb müssen wir jetzt noch einen letzten „Text“ betrachten, wie moderne Theoretiker es nennen würden: die Stadt Rom selbst. Natürlich ist dieser kurze Abschnitt nicht für Spezialisten der antiken stadtrömischen Topographie gedacht.15
Der Ort, aus dem sich die Stadt Rom entwickelte, wurde in erster Linie durch den Tiber geprägt, den größten Fluss Mittelitaliens. Er fließt von seinem Oberlauf im Apennin nach Südwesten ins Tyrrhenische Meer, ist stark, reißend und neigt sehr zu Überflutungen. Von Rom flussabwärts wird er für Fahrzeuge mit großem Tiefgang schiffbar. Dieser letztgenannte Faktor schuf in Verbindung mit dem zufälligen Vorhandensein einer Insel, die die Kraft der Strömung brach und einen Übergang ermöglichte, die idealen Voraussetzungen zur Entwicklung einer großen Stadt. Der Tiber spielte eine Schlüsselrolle im Verlauf des Großen Brandes, auch wenn er von keiner antiken Quelle in diesem Zusammenhang erwähnt wird. Anscheinend blieb das Feuer auf das Ostufer des Flusses beschränkt, da er ein natürliches Hindernis bildete, das die Flammen an der Ausbreitung nach Westen hinderte, so wie im 17. Jahrhundert die Themse den Großen Brand von London davon abhielt, sich massiv im Süden der Stadt auszubreiten.
Die alte Brücke über den Tiber, der Pons Sublicius (dessen Verteidigung durch Horatius Cocles so berühmt ist), führte den Reisenden aus westlicher Richtung in den ältesten bewohnten Teil Roms, der tatsächlich älter war als Rom selbst – auf das Forum Boarium, das sich zwischen dem Kapitol und dem Aventin am Fluss entlangzog. Seine Topographie machte es zu einem natürlichen Treffpunkt und Handelsplatz, auch wenn es vielleicht nie ein Viehmarkt gewesen ist, wie manchmal gern vermutet wird (bos = Rind). Dass es so alt und beengt war, bedeutete, dass es ständig für schwere Brände anfällig blieb (siehe Kapitel II). Als Markt wurde das Forum Boarium später vom künftigen Herzen der Stadt ersetzt, vom Forum Romanum, das östlich vom Kapitol lag und von diesem Hügel, der Velia und dem Palatin eingerahmt wurde. Dieses spätere Forum war vermutlich anfangs ein schlichter Marktplatz, vielleicht auf den unteren Hängen des Palatins, und wuchs, als das Areal, das es später einnahm, durch den großen Abwasserkanal (die Cloaca Maxima) entwässert wurde, dessen Anfänge traditionell in die Königszeit datiert werden.16
Das alles beherrschende Geländemerkmal auf dem Ostufer des Tiber waren die berühmten Hügel der Stadt, alte Höhenzüge, die durch Erosion oberhalb des Schwemmlandes um den Fluss entstanden waren.17 Natürliche Vorgänge und menschliche Eingriffe haben ihre Umrisse stark abgeflacht; folglich dürften sie in der Antike weit steiler gewesen sein als heute. Im Norden des Forum Boarium erhob sich schroff der Kapitolinische Hügel. Sein steiles Profil machte ihn zu einer natürlichen Festung, und angeblich war er der einzige Teil der Stadt, der 390 v. Chr. unversehrt die Plünderung durch die Gallier überstand (siehe Kapitel II). Der Hügel wurde zu einem wichtigen Kultzentrum, zum Standort des wohl wichtigsten religiösen Bauwerks Roms, des Tempels des Jupiter Optimus Maximus.
Nördlich des Kapitols erstreckte sich zwischen dem Quirinal und dem Pincius einerseits sowie dem Fluss andererseits die Fläche des Marsfeldes (Campus Martius), die ungefähr 250 Hektar umfasste. Das anfangs häufig überschwemmte Marsfeld lag bis in die Kaiserzeit, als es schon zu weiten Teilen bebaut war, außerhalb der offiziellen Stadtgrenzen. Diesen Bezirk wählte Augustus als Standort einiger seiner wichtigsten Bauten aus, darunter das Pantheon und sein Mausoleum. Der Großteil des Gebiets scheint von dem Brand des Jahres 64 n. Chr. verschont worden zu sein, und es wurde zum Zufluchtsort für jene, die obdachlos geworden waren.18
1.1. Die klassischen Hügel Roms. Zeichnung von A. Louis.
Südlich vom Forum Boarium lag der Aventin, der südlichste der traditionellen sieben Hügel Roms. Zu Neros Zeit war dieser steil abfallende Hügel ein gesuchtes Wohngebiet geworden. Brände auf dem Aventin sind zwar von Zeit zu Zeit belegt, aber es gibt keine klaren Hinweise, dass er direkt vom Großen Brand betroffen war.
Im Norden blickten die Hänge des Aventins, die dort sanfter abfielen, auf ein flaches Tal, durch das ursprünglich ein Bach verlief. Auf dieser Fläche stand später der Circus Maximus, und hier brach 64 n. Chr. der Große Brand aus, ebenso eine Reihe früherer und späterer Brände. Nördlich vom Circus Maximus erhob sich der Palatin, dessen oberes Plateau später ein riesiger flavischer Palast prägte. Der Palatin, besonders seine Südwestecke, spielt eine wichtige Rolle in der Frühgeschichte Roms und war der ursprüngliche Standort der alten, ummauerten Stadt. In republikanischer Zeit wurde er zu einer gefragten Wohngegend für römische A-Prominente. Cicero besaß ein Haus auf dem Hügel, Augustus wurde hier geboren, ließ sich auch hier nieder und vermachte sein Anwesen am Ende den späteren Kaisern, womit er ungewollt auch das Wort „Palast“ und ihm verwandte Begriffe an mehrere Sprachen vererbte. Laut den erzählenden Quellen lag der Palatin im Mittelpunkt der Feuersbrunst von 64 n. Chr., und viele seiner Bauten wurden zerstört.
Östlich vom Palatin lag der Caelius, der die Südostgrenze der traditionellen sieben Hügel markiert. Es handelt sich um einen langen, schmalen, wurstförmigen Vorsprung, etwa zwei Kilometer lang und kaum einen halben Kilometer breit. Angeblich war er ursprünglich mit Eichenwäldern bewachsen, dann wurde er zur Zeit der Republik dicht besiedelt und 27 v. Chr. durch einen Großbrand verwüstet; beim anschließenden Wiederaufbau wurde er zu einer gesuchten Wohngegend für Wohlhabende.19 Keine Quelle erwähnt, dass es dort 64 n. Chr. zu Schäden kam, doch sprechen einige archäologische Indizien dafür, dass der Caelius sehr wohl in Mitleidenschaft gezogen worden sein könnte (siehe Kapitel III).
Nördlich vom Palatin stieß ein Bergsporn vor, der in der Antike als Velia bekannt war. Ursprünglich war die Velia anscheinend hoch und steil und dürfte das Südostende des Forum Romanum überragt haben (so wie das Kapitol seinen Nordwesten beherrschte).20 Doch durch intensive Bautätigkeit, darunter der Bau des Eingangsbereichs zu Neros Goldenem Haus nach dem Brand von 64 und des von Hadrian errichteten Tempels der Venus und Roma, der dieses Vestibül ersetzte, wurde der Hügel schrittweise abgetragen. Schließlich verschwand er unter der großen faschistischen Aufmarschstraße, der Via dei Fori Imperiali, die Mussolini 1932 eröffnete.
Die Velia war Teil eines Höhenzugs, der den Palatin in nördlicher Richtung mit einem der ausgedehntesten Hügel Roms, dem Esquilin, verband. Über die Nomenklatur dieses Vorsprungs herrscht eine gewisse Unsicherheit, aber anscheinend bestand er entweder ganz oder unter anderem aus zwei getrennten Anhöhen, dem Cispius und dem Oppius. Auf dem Esquilin befanden sich mehrere große Anwesen, darunter die Gärten des Lamia und die Gärten des Maecenas, die zu Neros Zeit in kaiserlichen Besitz übergegangen waren. Der Frühphase des Brandes ist der Esquilin anscheinend entgangen, da das Feuer am Fuß des Hügels zum Stillstand kam, aber der folgende Neuausbruch könnte ihn schwer getroffen haben.21 Der Südausläufer, der Oppius, war unter Nero Schauplatz umfangreicher Bauarbeiten und enthält den am besten erhaltenen Gebäudeteil seines Goldenen Hauses, der unmittelbar nach dem Brand gebaut (oder wiederaufgebaut) wurde. Zwischen dem Esquilin/Oppius im Norden und dem Palatin sowie dem Caelius im Süden erstreckte sich ein Tal, das 64 n. Chr. offenkundig verwüstet wurde. Es wurde von Nero neu bebaut, dann ein zweites Mal von Vespasian, teils um Platz für dessen (später als Kolosseum bekanntes) großes Amphitheater und die angrenzende Gladiatorenschule zu machen.
Zwar stellt das grobe physische Gesamtbild des antiken Rom die Forschung vor keine besonderen Probleme, doch die Details seiner Topographie sind ein akademischer Albtraum. Fragen wie der Standort eines Gebäudes oder der Verlauf wichtiger Straßen, die in den erzählenden Quellen oft nur auf ganz beiläufige oder mehrdeutige Weise erwähnt werden, sind ein Dauerthema großer wissenschaftlicher Debatten und Kontroversen. Jeder Versuch, den Verlauf und die Ausdehnung des Brandes oder die folgenden Initiativen zum Wiederaufbau Roms zu untersuchen, wird durch den fehlenden Konsens über die Topographie der Stadt bisweilen zur Qual.