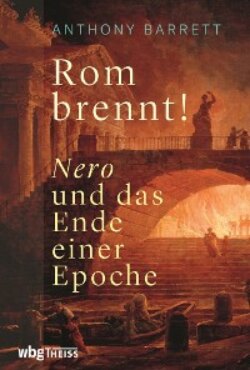Читать книгу Rom brennt! - Anthony Barrett - Страница 13
II
Brände im antiken Rom
ОглавлениеFeuer ist im städtischen Leben eine Alltagserfahrung der bitteren Art, und sicher vergehen nur wenige Tage im Jahr, ohne dass irgendwo auf der Welt ein Großbrand ausbricht. Da überrascht es kaum, dass schon im 1. Jahrhundert v. Chr. der Redner und Staatsmann Cicero Brände (zusammen mit Stürmen, Schiffbruch und einstürzenden Häusern) zu den großen Gefahren im römischen Leben zählte. Und nicht lange danach verrät uns der Dichter Horaz, wovor sich reiche Römer am meisten fürchteten: vor Diebstahl und Bränden.1 Doch so schrecklich Brände einem im ersten Moment vorkommen, die bei Weitem meisten Feuer sind schnell vergessen. Nur eine winzige Anzahl ist zum bleibenden Bestandteil unseres kollektiven Gedächtnisses geworden – und dafür müssen sie, grob gesprochen, normalerweise zwei Eigenschaften aufweisen: Das Feuer muss dramatische Ausmaße erreichen und so eindrucksvoll sein, dass es sich von der Masse der Allerweltsbrände abhebt. Hilfreich ist auch, einen wortgewaltigen Zeugen zu haben. Der Große Brand von London im Jahr 1666 war zwar ein bestürzend zerstörerisches Ereignis, aber er würde nicht noch heute die Phantasie der Allgemeinheit anregen, hätte nicht Samuel Pepys ihn in seinem Tagebuch dokumentiert und dabei so unvergessliche Bilder hinterlassen wie seinen eigenen hektischen Versuch, im Garten seines Hauses unterhalb des Tower Hill seinen geliebten Parmesankäse zu vergraben, während von Westen her die Flammen immer näher kamen. Und wäre der Große Brand von Chicago solch ein ikonisches Ereignis, wenn es nicht den fesselnden Bericht gäbe, den John Chapin im Harper’s Weekly veröffentlichte? Der Große Brand von 64 n. Chr. scheint, soweit wir das beurteilen können, was Verluste an Menschenleben und Besitz betrifft, nicht weniger katastrophal gewesen zu sein und ist ebenfalls gut bedient mit Chronisten, wird er doch von drei antiken Autoren, Tacitus, Sueton und Cassius Dio, anschaulich und ausführlich geschildert. Das macht ihn einmalig.2 Zu anderen römerzeitlichen Bränden besitzen wir üblicherweise nur verstreute Informationsfetzen. Die meisten haben einfach keine Spur in den Aufzeichnungen hinterlassen.
Selbst ohne alarmistische Kommentare wie die von Cicero und Horaz könnten wir nicht daran zweifeln, dass die Menschen in den Städten der Antike in ständiger Angst vor Bränden lebten. Diese Angst kommt schon im 2. Jahrtausend v. Chr. im berühmten Codex Hammurabi aus Babylon zum Ausdruck, wo als Strafe für Plünderei während eines Feuers die Verbrennung bei lebendigem Leib vorgesehen ist.3 Die Strenge der Strafe sollte vermutlich den Ernst des Problems widerspiegeln. Einige Jahrhunderte nach Hammurabi sahen die Vorschriften der hethitischen Hauptstadt Hattuša noch drakonischere Strafen für diejenigen vor, die sich bloße Fahrlässigkeit zuschulden kommen ließen. Sollte ein Tempel niederbrennen, und sei es auch nur durch das Versehen eines ansonsten schuldlosen Tempeldieners, so gilt diese Fahrlässigkeit als Verbrechen und „der, der dieses Verbrechen begeht, wird zusammen mit seinen Nachkommen untergehen“.4
Das römische Recht kann natürlich kein ebenso hohes Alter beanspruchen. Das älteste römische Äquivalent zu den nahöstlichen Texten ist das als Zwölftafelgesetz bekannte Corpus aus Bestimmungen, die Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr. formuliert wurden.5 Diese Gesetze schrieben einen Zwischenraum von zweieinhalb Fuß zwischen zwei benachbarten Häusern vor, zumindest teilweise wohl auch, um die Ausbreitung von Bränden einzudämmen, und mit Sicherheit war dies auch der Zweck der Vorschrift, wonach ein Holzstoß für Leichenbestattungen nicht näher als 60 Fuß am Haus eines Nachbarn errichtet werden durfte, ohne dessen Erlaubnis einzuholen.6 Detaillierter ist die Regelung, wonach jeder, der ein Gebäude oder einen Getreidehaufen in der Nähe eines Gebäudes abbrennt, den Schaden ersetzen muss, wenn der Brand ein Versehen war, und den Tod durch Verbrennen erleidet, wenn er vorsätzlich handelte.7
Zweifellos nahmen die frühen Römer diese Dinge nicht weniger ernst als die Babylonier vor ihnen. Aber konkrete Belege über spezifische Brände gibt es aus der Frühzeit der Geschichte einfach nicht, und der erste in einer Schriftquelle erwähnte römische Brand geschah nicht vor dem 4. Jahrhundert v. Chr. Sicher wird es schon vorher zahlreiche Fälle gegeben haben, doch über sie hat niemand geschrieben, und wenn doch, dann sind diese Berichte nicht erhalten geblieben. Deshalb müssen wir die Archäologie zu Hilfe nehmen. Über die begrenzte Aussagekraft archäologischer Befunde ist schon gesprochen worden (Kapitel I), und angesichts der dort bereits geäußerten Vorbehalte müssen wir entsprechend viel Vorsicht walten lassen, wenn wir uns mit dem allerersten römischen Brand beschäftigen, der einigen Forschern zufolge eine Spur in der archäologischen Überlieferung hinterlassen hat.
Laut der bekanntesten Version der Legende wurde Rom 753 v. Chr. von Romulus gegründet. Er war der erste von insgesamt sieben Königen, die die Stadt regierten, bis zum allerletzten, dem bösen Tarquinius Superbus, dessen Sturz 509 den angeblich glatten Übergang zur Republik einleitete. Archäologen haben jedoch die Vermutung aufgestellt, dass das Ende der Monarchie weit mehr Gewalt innerhalb der realen Stadt ausgelöst haben könnte, als die erzählenden Quellen nahelegen. Die physischen Indizien dafür bestehen in einer Schicht aus Brandschutt, die sich laut einigen Interpretationen ansammelte, als im späten 6. Jahrhundert v. Chr. drei Gebäude abbrannten: a) die Regia, der Königspalast, angeblich erbaut von dem für seine Frömmigkeit verehrten König Numa zwischen Roms Hauptstraße, der Sacra Via, und dem Tempel der Vesta; er wurde später in ein Sakralgebäude umgewandelt, in dem das Priesterkollegium sich zu seinen Sitzungen traf; b) das Comitium, die alte Freifläche für die Volksversammlungen, die im Nordwesten des Forums lag; und c) Roms ältester bekannter Tempel, der wahrscheinlich der Mater Matuta geweiht war.8 Der Überlieferung zufolge wurden der Mater-Matuta- und der Fortuna-Tempel gemeinsam von König Servius Tullius auf einem einzigen großen Podium im Bereich der heutigen Kirche Sant’Omobono erbaut (auf dem Forum Boarium – siehe Kapitel I).9 Alle drei Gebäude – Regia, Comitium und Tempel – brannten laut einigen Forschern gegen Ende der Königszeit nieder und scheinen nicht lange danach wieder aufgebaut worden zu sein.10 Diese Theorie eines Großbrandes im Jahr 509 ist verlockend und gar nicht abwegig, aber wir müssen uns vor Augen halten, dass sie auf der hochspekulativen Datierung der fraglichen Brandschicht ins späte 6. Jahrhundert beruht. Zumindest ein gewisser Grad an Vorsicht ist angebracht.
Der erste Brand, der einen Platz nicht in der archäologischen, sondern in der schriftlichen Überlieferung fand, war schon für sich genommen ein wichtiges Ereignis, ist aber auch im Kontext unseres Themas von besonderer Bedeutung, weil es bei den Römern mehr als vier Jahrhunderte später, zur Zeit des Großen Brandes von 64, immer noch nachhallte und die Menschen damals symbolische Parallelen zwischen den beiden Katastrophen zogen (siehe Kapitel III). An die traditionell auf 390 v. Chr. datierte Plünderung Roms durch die Gallier erinnerten sich die Römer als eine der verheerendsten Episoden in der Geschichte der Stadt. Womöglich übertreffen die Brände, die sie auslöste, in ihrer Wirkung auf die nationale Psyche sogar die neronische Katastrophe. Und beiden Ereignissen ist insoweit eine frustrierende Eigenschaft gemeinsam, als beide den entscheidenden Unterschied zwischen Information und Wissen unterstreichen. Zwar zählen sie zu den bestbezeugten Ereignissen in der Geschichte Roms, aber in beiden Fällen lässt uns die relative Informationsfülle in relativer Unkenntnis darüber, was geschah.
Wie es scheint, überquerte zu Anfang des 4. Jahrhunderts ein beträchtlicher Teil einer gallischen Ethnie – der Senonen, die sich im sogenannten Ager Gallicus („Galliergebiet“) in der Poebene niedergelassen hatten – den Apennin und zog nach Etrurien. Als sie durch das Tal des Tiber auf Rom vorrückten, stießen sie an der Mündung der Allia in den Tiber mit einer römischen Armee zusammen und schlugen sie der Überlieferung zufolge am 18. Juli 390 v. Chr. vernichtend.11 Fortan verzeichneten die römischen Kalender die Niederlage als größte Katastrophe der eigenen Geschichte. Teile der römischen Armee flohen in Panik nach Norden ins nahe Veii, eine Stadt, die die Römer unter ihrem Feldherrn Camillus erst sechs Jahre zuvor eingenommen hatten. Jetzt lag Rom selbst schutzlos da. Ohne Widerstand drangen die Gallier am nächsten Tag, dem 19. Juli, in die Stadt ein, und zufällig war dies derselbe Tag, an dem 64 n. Chr. der Große Brand ausbrach – ein Zusammentreffen, das nicht unbemerkt blieb. Sobald die Gallier dort waren, gingen sie laut Livius, dem großen Historiker der augusteischen Zeit, an die Plünderung der Stadt, zerstörten die Häuser und steckten sie in Brand. Das Plündern und Brennen dauerte mehrere Tage an; am Ende lag die Stadt in Trümmern. Das Kapitol scheint der Zerstörung entgangen zu sein, aber die dort verschanzten Römer ergaben sich schließlich und mussten den Galliern ein Lösegeld in Gold zahlen.12 Rasch nahm Camillus, den man zuvor wegen Unterschlagung von Beute aus dem Feldzug gegen Veii verbannt hatte, die Befreiung Roms in Angriff. Er brach die Verhandlungen mit den Galliern ab und besiegte sie anschließend im Kampf.13 Rom war zurückgewonnen, jetzt aber waren viele dafür, die zerstörte Stadt aufzugeben und geschlossen nach Veii umzuziehen. Unter Führung von Camillus plädierten die Senatoren für den Verbleib und den Wiederaufbau, und ihre Sichtweise setzte sich durch. Nach dem Großen Brand von 64 wurde in witziger Weise auf diese uralte Debatte angespielt. Beim folgenden Wiederaufbau nahm Nero angeblich so viel Land für sein prächtiges Goldenes Haus in Anspruch, dass ein Spottgedicht in Umlauf kam, welches die Bürger drängte, nach Veii umzuziehen – falls diese Stadt nicht auch schon von dem Haus verschlungen worden sei!14
Livius, der detailreichste Chronist der gallischen Zerstörung, behauptet, die Brände, die während der brutalen Plünderung ausbrachen, hätten mehr oder weniger ganz Rom vernichtet. Interessanterweise räumt er ein, dass sie sich am ersten Tag nicht so weit ausbreiteten, wie man hätte erwarten können – doch darauf sei es zu ausgedehnter Verwüstung gekommen. Die kleine Einheit aus römischen Soldaten, die noch in der Stadt war, musste von ihrer Befestigung auf dem Kapitol herab zusehen, wie „alles in Flammen und Ruinen eingeebnet“ wurde.15 Von dieser Zitadelle abgesehen, so Livius, sorgten die Gallier dafür, dass in den rauchenden Ruinen der eingenommenen Stadt nichts übrigblieb.16 Rom „lag in Asche“. Häuser waren in großem Umfang niedergebrannt worden, die Getreidevorräte zerstört, die Aufzeichnungen der Priester und andere wichtige Dokumente waren von den Flammen verzehrt worden.17 Doch Livius’ gesamten Bericht muss man mit äußerster Vorsicht lesen. Inzwischen herrscht weithin die Überzeugung, dass die Zerstörung einschließlich der Brände weit weniger umfassend gewesen sein könnte als geschildert. Die Gallier dürften in erster Linie an Beute interessiert gewesen sein, weniger daran, Gebäude niederzubrennen, und heute vermutet die Forschung, dass das Ausmaß der Zerstörung durchaus begrenzt und ihre räumliche Auswirkung tatsächlich ziemlich gering war. Doch das hat wenig zu sagen. Die mythische Aura, welche die ganze Episode umgab, sollte sich auf ihre Art als weitaus stärker erweisen denn die simple historische Wahrheit.18
Den Mangel an unmittelbaren Quellen für die Frühzeit der römischen Geschichte führt Livius auf die Zerstörung der alten Archive im Galliersturm zurück. Ob das nun eine zutreffende Behauptung ist oder nicht, jedenfalls ist sie ein nützlicher Hinweis auf die massiven Lücken in der Feuerchronik des alten Rom. Selbst für ein so prominentes Ereignis wie den Großen Brand von 64 n. Chr. herrscht ein gravierender Mangel an spezifischen Details, was teilweise zweifellos an der dürftigen Archivierungspraxis liegt. Die Art Verlust, die Livius erwähnt, taucht wieder und wieder auf. In den späten 80er- und frühen 70er-Jahren des 1. Jahrhunderts v. Chr. wurde das Tabularium (das Staatsarchiv) samt allen Akten durch Brandstiftung zerstört. Im Jahr 58 v. Chr. zündete der Demagoge Publius Clodius angeblich den Tempel der Nymphen (auf dem Marsfeld) an, der Zensusunterlagen und andere öffentliche Archive beherbergte, von denen Clodius, wie es heißt, einiges verschwinden lassen wollte. Solche Verluste hielten auch nach dem Großen Brand an. Laut Dio wurden 192 n. Chr. unter Commodus bei einem Brand Staatsarchive zerstört.19 Nach 64 müssen detaillierte Berichte über die Zerstörungen des Großen Brandes entstanden sein, die man für die verschiedenen anschließend aufgelegten Entschädigungsprogramme brauchte. Wenn das der Fall ist, scheinen die erzählenden Quellen diese Unterlagen wenig oder gar nicht genutzt zu haben, sei es aus Desinteresse, vielleicht aber auch, weil sie nur 16 Jahre später, 80 n. Chr., bei einem weiteren Brand, der Rom abermals verwüstete, zerstört wurden.
Nach dem Galliersturm gibt es in Rom mehr als ein Jahrhundert lang keinen belegten Brand, doch man darf fest davon ausgehen, dass die lange Lücke in unserer Überlieferung die brüchige, ja fast willkürliche Natur der historischen Quellenlage widerspiegelt und nicht etwa die Feuerfestigkeit der Stadt. Im 3. Jahrhundert v. Chr. erscheinen in der Literatur abermals Anspielungen auf Brände, und es wird erstmals möglich, den Großen Brand von 64 in einen umfassenderen historischen Kontext städtischer Feuerschäden einzuordnen und einen ungefähren Eindruck davon zu bekommen, wie anfällig die Römer für solche Ereignisse waren und wie gut sie mit ihnen fertig wurden. Aber der Weg dazu ist alles andere als leicht. Die Liste der Brände in republikanischer Zeit ist bestenfalls Stückwerk, und was in sie Eingang fand, ist eher willkürlich. Bestimmte Gebäude berührten Roms Identitätsgefühl. Beispielsweise erscheinen sehr häufig Tempel in den Berichten über Brände. Natürlich standen sie oft an erhöhten Orten und waren deswegen Blitzschlägen ausgesetzt. Tempel waren aber außerdem wichtige öffentliche Bauten, und Schäden an ihnen betrachtete man als Fragen von öffentlicher Relevanz. Besonders den Tempel der Vesta sah man metaphorisch im Herzen der Stadt angesiedelt, und so ist es verständlich, dass dort auftretende Brände penibel dokumentiert wurden. Im Vergleich zu der Bedeutung, die man bestimmten Gebäudetypen zumaß, galten andere Bauten der Stadt eindeutig als ausgesprochen uninteressant. So hat beispielsweise ein Brand, der kurz nach 14 n. Chr. zur Zeit des Tiberius in den Bauten rund um die Naumachia ausbrach – einem von Augustus angelegten künstlichen Wasserbecken, in dem Seeschlachten inszeniert wurden – ein einmaliges und erstaunliches Charakteristikum mit dem Brand eines Hauses gut dreieinhalb Jahrhunderte später, im Jahr 375, gemeinsam, das dem Vater des Autors Symmachus gehörte. Die Verbindung besteht darin, dass diese beiden Brände auf dem Westufer des Tiber (im Wohnbezirk des heutigen Trastevere) die einzigen sind, für die es in der gesamten antiken Geschichte Roms Belege gibt. Bestimmte Teile dieses Viertels waren arm und dicht bevölkert, also müssen Brände dort zweifellos häufig gewesen sein.20 Aber solche einfachen Wohnlagen befanden sich generell außerhalb des historischen Horizonts. Und natürlich haben Autoren häufig ein ganz persönliches Motiv, sodass reichlich banale Brände weit mehr Aufmerksamkeit bekommen können, als sie verdienen. Beispielsweise überrascht es kaum, dass Cicero es angemessen fand, den Brand im Haus seines Bruders zu vermerken, ein überaus wichtiges Ereignis für die Familie, das prompt seinen Platz in der Geschichte antiker Brände fand, aber in Wahrheit für die Gesellschaft insgesamt ein Nicht-Ereignis war.
Das Schlimmste ist die frustrierende Eigenart antiken Quellenmaterials und die Frage, wie viel Glauben wir ihm schenken dürfen. An der ersten „nachgallischen“ Notiz über einen Brand wird lebhaft deutlich, welche Herausforderungen die literarische Überlieferung mit sich bringt – Herausforderungen, die uns mit Macht wieder einholen werden, wenn wir zur Untersuchung des neronischen Brandes von 64 n. Chr. kommen. Der Tempel der Salus (Sicherheit und Wohlergehen), der in einer beherrschenden Position auf dem Quirinal stand, wurde 275 v. Chr. vom Blitz getroffen und beim folgenden Brand angeblich zerstört. Das wahrscheinlich 302 von Gaius Junius Brutus, dem römischen Feldherrn gegen die Samniten, geweihte Gebäude wurde nach dem Feuer von 275 wieder aufgebaut, später mindestens noch zweimal vom Blitz getroffen, nämlich 207 und 166 v. Chr. (das Ausmaß der Schäden in diesen beiden Fällen ist unklar), und dann während der Herrschaftszeit des Claudius erneut durch ein Feuer zerstört.21 Bei dieser Bilanz gibt es ein Problem: Der Künstler Gaius Fabius Pictor („Maler“) war berühmt für seine spektakulären Gemälde auf den Innenwänden (parietes) genau dieses Tempels, die er nach dessen erster Einweihung vollendete. Tatsächlich war Pictor so stolz auf die Bilder, dass er sie signierte, was für diese Zeit unüblich war.22 Und die Römer wiederum waren so stolz auf ihn und seine Werke in dem Tempel, dass sie Fabius den Ehrennamen „Pictor“ gaben. Der christliche Autor Orosius aus dem frühen 5. Jahrhundert sagt ausdrücklich, der Tempel der Salus sei 275 völlig zerstört (dissoluta) worden. Ungeachtet der angeblich totalen Zerstörung des Tempels bei dieser Gelegenheit blieben die Gemälde wie durch ein Wunder unversehrt, denn Plinius behauptet, sie hätten bis in seine Zeit (ad nostram memoriam), mehr als drei Jahrhunderte später, überlebt, obwohl sie tatsächlich den ersten Tempel geschmückt hatten, der zerstört und 275 v. Chr. durch den Tempel ersetzt wurde, den Plinius gesehen haben würde.23 Irgendetwas stimmt hier nicht. Eindeutig zeigt die Geschichte dieses Tempels, wie vorsichtig wir im Umgang mit den antiken Berichten über Brände sein müssen.
Die Zerstörung, die 275 über den Tempel der Salus hereinbrach, wenn er denn zerstört wurde, scheint auf dieses Bauwerk selbst beschränkt gewesen zu sein und zog höchstens ein, zwei benachbarte Bauten in Mitleidenschaft. Weitaus furchtbarer waren Brände, die ganze Bezirke verwüsteten. Davon gab es zwei Grundtypen. So viele Vergleiche man später auch zwischen der Gallierinvasion des 4. Jahrhunderts und dem Großen Brand von 64 n. Chr. gezogen haben mag, diese beiden Ereignisse waren grundverschiedene Phänomene. So schrecklich und verheerend es war, stellte das Feuer, das 64 durch Rom raste, im Grunde doch einen konventionellen Brand mit den üblichen Merkmalen eines urbanen Feuers dar, wenn auch in sehr großem Maßstab. Die Plünderung durch die Gallier war etwas völlig anderes – sie war der vorsätzliche Überfall einer feindlichen Streitmacht auf die Stadt, deren unvermeidliche Folgen Tod und Zerstörung waren, und die Brände, so beträchtlich sie auch waren, bildeten letztendlich nur Randerscheinungen eines viel größeren Ereignisses. Wenn wir die vagen archäologischen Hinweise auf einen massiven Brand gegen Ende der Königszeit beiseitelassen, dann taucht der erste konventionelle Großbrand in der Geschichte Roms, der zur selben Klasse wie der Große Brand von 64 n. Chr. gehört, wenngleich auf einer niedrigeren Stufe, nicht vor dem späten 3. Jahrhundert v. Chr. in der Überlieferung auf.
Zu dieser Zeit waren in der Stadt die Bedingungen für einen Großbrand gegeben. Da Rom zur Vormacht des Mittelmeerraums wurde und seine Bevölkerung wuchs, muss ein unwiderstehlicher Druck geherrscht haben, immer dichter zu bauen – was angesichts der natürlichen Gegebenheiten nur „immer höher“ heißen konnte. Dies führte letztendlich zum Bau der berüchtigten Todesfallen, der großen Mietskasernen oder insulae (wörtlich „Inseln“), die im antiken Rom ein so vertrauter Anblick wurden. Einige Details über ihren Bau erfahren wir aus einem Bericht, der in eine viel spätere Zeit gehört, dem berühmten, einflussreichen Architekturwerk De architectura, das Vitruv Ende des 1. Jahrhunderts v. Chr. verfasste. Dort heißt es, dass Hausmauern, die an öffentliche Straßen angrenzten, auf eine Dicke von anderthalb Fuß begrenzt waren. Aber anderthalb Fuß dicke Ziegelmauern können keine Obergeschosse tragen. Die Folge war, dass, um den Bedarf einer schnell wachsenden Bevölkerung zu decken, mehrgeschossige Wohnhäuser um Mittelpfeiler aus Ziegeln oder unbehauenen Steinen herum gebaut wurden, die die Balken der Decken mehrerer zusätzlicher Etagen trugen.24 Daher die Bemerkung Juvenals, der gut ein Jahrhundert später schrieb, die Römer lebten in einer Stadt, die sich zum Großteil auf einen schmalen Träger stütze (tenui tibicine fultam).25 Wann die Insulae allmählich zu einem typischen Merkmal Roms wurden, wissen wir nicht, aber einen indirekten Hinweis, dass die ersten nicht später als Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. auftauchten, liefert Livius. Zu den für den Winter 218/17 v. Chr. vermeldeten Wundern gehört ein Ochse, der in den dritten Stock eines solchen Gebäudes auf dem Forum Boarium kletterte und inmitten des folgenden Chaos und Tumults in den Tod sprang.26 Dichte Bebauung, ein üblicher Brandbeschleuniger, war also spätestens zu dieser Zeit ein Kennzeichen Roms geworden. Und in den Quellen gibt es außerdem Hinweise, dass in diesen dicht gefüllten Gebäuden höchst entflammbares Material verbaut wurde. So berichtet uns Plinius der Ältere, bis ins frühe 3. Jahrhundert (sein zeitlicher Bezugspunkt ist der Krieg Roms mit König Pyrrhos von Epirus 280–275 v. Chr.) seien für die Hausdächer ausschließlich Holzschindeln statt Dachziegeln aus Ton verwendet worden, und die Umstellung von Holz auf Keramik, von der Plinius implizit berichtet, sie sei in dieser Zeit erfolgt, erwuchs höchstwahrscheinlich aus dem Wunsch, die Brandgefahr zu verringern.27
Das erste große Feuer seit den Galliern datiert Livius ins Jahr 213 v. Chr. Er berichtet, dass es sich zwei Nächte und den Tag dazwischen ungehindert ausbreitete und alles dem Erdboden gleichmachte (solo aequata omnia). Der Brand wütete in dem Gebiet zwischen dem Aventin und dem Tiber nahe der Befestigungslinie, die König Servius Tullius zugeschrieben wird und daher als Servianische Mauer bekannt ist.28 Eine frappierende Eigenheit war, dass diese alten Stadtmauern kein Hindernis für einen Großbrand darstellten. Livius sagt ausdrücklich, dass sie nicht ausreichten, um das Feuer einzudämmen, das sich über sie hinweg ausbreitete und große Schäden an religiösen wie weltlichen Bauten anrichtete. Das ist eine ernüchternde Beobachtung, die wir im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir die Berichte über den Brand von 64 lesen: Auch Tacitus vermerkt, dass es, als das Feuer im Circus Maximus begann, keine Hindernisse gab, die seine Ausbreitung begrenzen konnten.29 Beide Ereignisse zeigen, dass man, sobald ein Feuer sich erst richtig entwickelt hatte, nur sehr wenig tun konnte, um es unter Kontrolle zu bringen – und dass ein Brand von gewaltigen Ausmaßen, so absolut verständlich es sein mag, dass Leute davon ausgehen, er könne schlicht nur das Ergebnis irgendeines teuflischen Plans sein, tatsächlich nichts weiter sein konnte als Ausdruck eines blinden Wütens der Natur und eher starken Winden als großer Niedertracht zuzuschreiben war. Der Brand von 213 verwüstete einen Großteil des alten Forum Boarium und zerstörte die Tempel der Mater Matuta (siehe oben), der Fortuna und der Spes.30 Bei ihren Ausgrabungen am Standort des Mater-Matuta-Tempels in den Jahren 1961–62 datierte Liliana Mercando den Abbruch verschiedener Architekturelemente dieses Komplexes und die Verlegung eines neuen Pflasters auf den Wiederaufbau, der dem Brand von 213 folgte.31 Angeblich wurde die Statue des Servius Tullius im Tempel der Fortuna von Vulcanus höchstpersönlich gerettet.32
Feuer können versehentlich oder absichtlich entstehen. Unter den Letzteren sind manche die fast unvermeidliche Begleiterscheinung militärischer Konflikte. Dann gibt es jene Brände, die in generell friedlichen und geordneten Zeiten vorsätzlich gelegt werden, manchmal mit einem rationalen Motiv – Brandstiftung ist ein Verbrechen, das häufig Personen mit psychischen Problemen reizt. Nur Tacitus räumt ein, dass einige Geschichtsschreiber den Großen Brand in die Kategorie der Unglücke einstuften.33 Alle anderen Quellen, die sich zu diesem Feuer äußern, geben ohne Zögern Nero die Schuld; unsicher sind sie sich allein darin, ob die Brandstiftung eine absichtliche und durchdachte Handlung war oder Ergebnis des abnormen Verhaltens eines Irren. Der erste bekannte Fall einer mutmaßlichen Brandstiftung in Rom, die nicht das Nebenprodukt kriegerischer Handlungen war, lässt sich exakt auf den 18. März 210 v. Chr. datieren.34 Wie Livius berichtet, brach 210 in der Nacht vor den Quinquatrus, dem vom 19. bis 23. März gefeierten Fest der Minerva, ein Feuer aus.35 Es führte zur Zerstörung mehrerer Teile des Forum Romanum. Dazu zählten Läden und Privathäuser rund um das Forum, der Fischmarkt und der Wohnsitz des Oberpriesters (das atrium regium), der völlig zerstört wurde. Den Tempel der Vesta retteten die Löschbemühungen von 13 Sklaven, die zur Belohnung später vom Staat angekauft und dann freigelassen wurden. Im Anschluss an diesen Brand kam es zu Spekulationen, die auf faszinierende Weise denen nach dem Großen Brand von 64 n. Chr. gleichen. In dem Umstand, dass das Feuer von 210 anfangs an mehreren verschiedenen Stellen ausbrach, sah man einen Beweis für Brandstiftung. Die Täter wurden durch die Aussage eines ihrer Sklaven aufgespürt und erwiesen sich anscheinend als Adlige aus Capua, die Zorn über die Behandlung ihrer Väter während der brutalen römischen Eroberung Capuas im Vorjahr empfanden. Ob es sich nun um einen echten Fall von gemeinschaftlicher Brandstiftung handelte oder ob eine aufgebrachte Bevölkerung eine unbeliebte Gruppe zum Sündenbock machte, können wir nicht sagen, doch sollten wir uns bewusst sein, dass die einleitende Aussage des Sklaven eines Capuaners möglicherweise unter der Folter erzwungen wurde. Wie der Große Brand noch zeigen wird, war dies gewiss nicht das letzte Mal, dass Brandstiftungsvorwürfe gegen eine unbeliebte Minderheit unter fragwürdigen Umständen die Runde machten.
Ein weiterer Fall mutmaßlicher Brandstiftung ereignete sich 83 v. Chr., als es zu einer großen Katastrophe auf dem Kapitol kam. Zuvor war 88 v. Chr. der Kriegsherr Cornelius Sulla auf die Stadt vorgerückt und hatte das Kapitol eingenommen, wobei seine Soldaten Brandfackeln schleuderten oder vielleicht eine Art Artillerievorrichtung benutzten, um die Brandgeschosse ins Ziel zu bringen.36 Es gibt keine Hinweise darauf, wie schwer bei dieser früheren Gelegenheit das berühmteste Bauwerk auf dem Hügel, der große und uralte Tempel des Jupiter Optimus Maximus, möglicherweise beschädigt wurde. Aber nur fünf Jahre später ereilte den Tempel eine totale Katastrophe, als er einschließlich seiner Kultstatue und eines Exemplars der heiligen Sibyllinischen Bücher bis auf die Grundmauern niederbrannte.37 Wie im Fall des Großen Brandes von 64 und überhaupt vieler Großbrände ist die Ursache unbekannt, aber es gab Spekulationen, dass es sich um Brandstiftung handelte. Die Quellen drücken sich hier vorsichtig aus. Ebenso wie Tacitus, der von einer geteilten Meinung hinsichtlich der Schuldfrage am Großen Brand spricht, vermerkt auch Appian, ein griechischer Historiker des 2. Jahrhunderts n. Chr., dass sich der Verdacht im Jahr 83 v. Chr. gegen den Volkstribunen des Jahres 90, Carbo, als einen Agenten Sullas richtete, aber auch gegen die damaligen Konsuln. Wie Tacitus räumt auch Appian ein, er sei sich, was die wahre Brandursache betreffe, nicht sicher.38 Der Brand des Kapitols im Jahr 83 war ein symbolträchtiges Ereignis, das insofern viele Parallelen zum Großen Brand aufweist, als der Verdacht in mehrere Richtungen ging, aber kein zweifelsfrei identifizierbarer Schuldiger herauskam. Der Wiederaufbau des Tempels wurde 69 v. Chr. in einem verschwenderischen Ausmaß vollendet, das seine einstige Herrlichkeit widerspiegelte.
Das letzte Jahrhundert der römischen Republik war eine Zeit politischer Auflösung, in der rivalisierende Warlords um die Macht rangen und die ihrem Befehl unterstehenden Truppen zur Verfolgung ihrer persönlichen Ziele einsetzten. Ihre Gewalt richtete sich hauptsächlich gegen ihre Gegner, weitete sich aber zwangsläufig auch auf das Gefüge der Stadt aus. Brandstiftung, ob als kalkuliertes Mittel oder als Begleiterscheinung aggressiver Politikausübung, wurde zu einem vertrauten Aspekt des Alltags; Brände waren jetzt nicht nur ein Symptom regellosen städtischen Wachstums, sondern auch des politischen Zusammenbruchs und sozialer Unruhen. Außerdem wurde schon der bloße Vorwurf der Brandstiftung offenkundig zum gängigen und wirksamen Werkzeug, um den Unmut gegen die eigenen Widersacher zu schüren. Das zeigt sich in den Invektiven Ciceros, der den Zorn des Volkes gegen Feinde wie Catilina, Clodius oder Antonius anfachte, indem er sie als Brandstifter hinstellte.39 Angeblich geschah dies auch in den letzten Jahren der Herrschaft Neros. Nicht nur gab es Gerüchte, Nero habe 64 n. Chr. Rom niedergebrannt, sondern man behauptete auch, er habe während seiner letzten Herrschaftsmonate im Jahr 68 unabhängig davon einen weiteren Plan geschmiedet, die Stadt niederzubrennen (Kapitel IV).
Der Verdacht der Brandstiftung war nicht der einzige Faktor, der große Empörung wachrief. Es bestand auch allgemein der Eindruck, manche Leute seien zwar keine Brandstifter, profitierten aber von den Bränden in der Stadt. Auch das war eines der beherrschenden Themen nach dem Feuer von 64, als Nero laut Tacitus die Katastrophe in der Stadt zum Bau seines Goldenen Hauses ausnutzte, und Sueton beharrlich behauptete, die Geste Neros, auf seine Kosten Schutt und Leichen wegzuräumen, sei ein Trick gewesen, um ihm den Zugriff auf Wertsachen zu ermöglichen.40 Für den Verdacht, hier versuche jemand, sich persönlich zu bereichern, gab es einen Präzedenzfall. Während der Proskriptionen, die der zweiten Einnahme Roms durch Sulla Ende 81 v. Chr. folgten, kam ein einzelner Mann enorm gut weg. Marcus Licinius Crassus nutzte sein Familienerbe, um durch den Aufkauf beschlagnahmten Besitzes ein riesiges Finanzimperium aufzubauen. Mehr noch: Mit einer schnellen Eingreiftruppe aus 500 Sklaven eilte er zu Brandstellen und kaufte die abgebrannten Gebäude und dazu benachbarte Grundstücke auf, die die Eigentümer oft zum Schnäppchenpreis abzugeben bereit waren. Ausdrückliche Angaben, dass Crassus einen regelrechten Feuerwehrdienst bereitstellte, finden sich zwar in keiner Quelle, aber vermutlich löschte sein Team zumindest die Brände auf Grundstücken, die er erworben hatte. Plutarch behauptet, auf diese Art habe Crassus den Großteil oder wenigstens einen „sehr großen“ Teil Roms aufgekauft. Anschließend habe er die zerstörten Bauten durch hochpreisige Mietshäuser ersetzt, wobei ihm Sklaven mit Spezialkenntnissen als Baumeister und Architekten dienten.41 In ebenso übertriebener Weise wurde auch Nero beschuldigt, Roms Zerstörung für seine eigenen persönlichen Zwecke auszunutzen, nämlich zum Bau seines Goldenen Hauses, und die Flavier suchten zweifellos aus derselben Art von Unmut Kapital zu schlagen, den man in der späten Republik gegen Crassus empfunden hatte.
Die Tätigkeit einer Person wie Crassus zeigt deutlich, dass es in Rom kein ausgereiftes, zentralisiertes System der Feuerbekämpfung gab. Dabei war es nicht so, dass man das Problem nicht erkannt hätte. Schon im späten 4. Jahrhundert v. Chr. begegnet uns der erste Versuch, in der Stadt eine rudimentäre Feuerwehr zu schaffen, deren Aufgaben von Personen wahrgenommen wurden, bei denen es sich im Prinzip um Amtsträger mit Polizeifunktion gehandelt haben dürfte. Livius berichtet, einige Zeit vor dem Ende jenes Jahrhunderts sei ein Kollegium aus drei Magistraten geschaffen worden, die später als tresviri capitales bekannt waren. Tresviri bedeutet „drei Männer“, während sich das Namenselement capitales von ihrer Aufsicht über das Gefängnis ableitete, das hauptsächlich dazu diente, Angeklagte bis zum Prozess festzuhalten, gelegentlich aber auch als Hinrichtungsstätte fungierte.42 Die genaue Art der Amtspflichten der tresviri ist zwar unklar, den Berichten über ihre Tätigkeit können wir jedoch entnehmen, dass von Anfang an eine enge Verbindung zwischen Brandbekämpfung und allgemeinen Polizeiaufgaben bestand. Das ist sehr einleuchtend. Brandstiftung und Plünderung sind bei Bränden in Städten überall vertraute Faktoren. Außerdem sah man eine Verbindung zwischen sozialen Unruhen und Brandstiftung aus kriminellen Motiven, die bei den Römern zu einer Art fixer Idee wurde. Noch vor der Gallierinvasion hören wir für 419/18 v. Chr. von einer Verschwörung unter Sklaven, die an mehreren Stellen der Stadt Feuer legen wollten. Angeblich planten sie, im darauf folgenden Durcheinander Schlüsselpositionen wie das Kapitol zu besetzen. Tatsächlich wurde der Plan verraten, die Verschwörer wurden verhaftet und bestraft und die Informanten mit der Freilassung und einer großen Menge Bronze belohnt – schnippisch bemerkt Livius, damals habe man Bronzeklumpen noch als Reichtum betrachtet.43
Auf ihren nächtlichen Rundgängen sollten die tresviri Ausschau nach Bränden halten. Bezeichnend ist allerdings, dass von ihnen außerdem erwartet wurde, die Bevölkerung im Zaum zu halten, wobei sie von einer Truppe unterstützt wurden, die der Komödiendichter Plautus, der gegen Ende des 3. Jahrhunderts schrieb, als „acht starke Männer“ bezeichnet.44 Im Quellenbestand dominiert die Polizeiarbeit deutlich. Während des 2. Punischen Krieges im späten 3. Jahrhundert, so hören wir, sei ein gewisser Publius Munatius so dumm gewesen, von der Statue des Satyrn Marsyas – wohl das große Bildnis auf dem Forum – einen Blumenkranz zu entfernen und sich selber aufzusetzen. Kaum ein Schwerverbrechen, möchte man denken, doch die tresviri verurteilten den Mann dazu, in Ketten gelegt zu werden.45 Erneut bei der Arbeit finden wir die drei 198 v. Chr., als ein Sklavenaufstand ausbrach. Es gelang den Rebellen, die Stadt Setia südlich von Rom einzunehmen, aber der Aufstand wurde niedergeschlagen, als 500 von ihnen, die im Begriff standen, Praeneste (Palestrina) östlich von Setia anzugreifen, gefangengenommen und hingerichtet wurden. Die Lage in Rom war angespannt – Wächter patrouillierten auf den Straßen, die niederen Beamten wurden angewiesen, Inspektionen durchzuführen, und die tresviri erhielten den Befehl zu erhöhter Wachsamkeit, was wohl eher auf eine Polizei- als auf eine reine Feuerwehrfunktion hindeutet.46 Eine Schlüsselrolle spielten sie den Quellen zufolge auch bei der Niederschlagung der berüchtigten Unruhen, zu denen es 186 v. Chr. rund um die Bacchusriten kam; die tresviri wurden ausdrücklich angewiesen, Brandwache zu halten, ein neuerlicher Beleg für die enge Verbindung, die die Römer zwischen Bränden und Unruhen herstellten.47 Bemerkenswert ist, dass noch zur Zeit des Großen Brandes von 64 n. Chr., als die Organisation zur Brandverhütung große Fortschritte gemacht hatte und die dafür aufgestellte Truppe viel erfahrener war als in der Frühzeit der tresviri, diese Doppelverantwortung als Polizisten und Feuerwehrleute fortbestand. Davon abgesehen war die am klarsten umrissene Pflicht der tresviri die Aufstellung einer nächtlichen Feuerwehr, unterstützt durch vom Staat gestellte Sklaven.48 Die Brandprävention galt eindeutig als ernstzunehmende Aufgabe; wir wissen, dass die tresviri bei einer Gelegenheit ihre Pflicht versäumten und zu spät bei einem Brand eintrafen, der in der Sacra Via ausgebrochen war. Das wurde als derart schwerer Pflichtverstoß angesehen, dass es zur Verurteilung der drei durch die Tribunen vor der Volksversammlung führte.49
Das Amt der tresviri capitales überlebte in der Kaiserzeit und bestand noch im späten 3. Jahrhundert n. Chr., obwohl inzwischen anscheinend andere Institutionen ihre Rolle bei der Brandverhütung übernommen hatten. Ironischerweise fanden sie sich in mindestens einem Fall in Sachen Brandstiftung gewissermaßen auf der anderen Seite wieder, als man sie aufforderte, bestimmte verbotene Bücher zu vernichten. Auf Befehl Kaiser Domitians verbrannten die tresviri im späten 1. Jahrhundert n. Chr. Gedichte, die das Lob prominenter, aber geistig allzu unabhängiger zeitgenössischer Römer sangen.50
Wie es scheint, hatte man in der Republik bei der Entwicklung einer wirksameren Methode der Brandbekämpfung, wenn überhaupt, nur geringe Fortschritte gemacht. Möglicherweise setzte eine solche Reform den starken Zentralisierungsschub voraus, den der Prinzipat später mit sich brachte. Jedenfalls sehen wir erst in der Zeit des Augustus tiefgreifende Veränderungen in der Art und Weise, wie die Römer mit dem Problem umgingen. Außerdem bemerken wir nun ein wachsendes wissenschaftliches Interesse am Phänomen Feuer. Der prominente griechische Geograph Strabon, ein Zeitgenosse des Augustus, verweist auf Feuer als Wirtschaftsfaktor und äußert sich zu dem großen Holz- und Steinmarkt in Rom, der durch den beunruhigenden Umstand immer weiter wuchs, dass ständig Häuser abbrannten.51 Die wichtigsten Einblicke gewährt uns Vitruv, der uns interessante Hinweise liefert, wie die Römer über Brandprävention dachten; einige deuten voraus auf die von Nero in Kraft gesetzten Präventionsmaßnahmen nach 64 n. Chr. In der gesamten römischen Welt war es gängige Praxis, Mauern aus Flechtwerk mit Lehmbewurf zu errichten; dabei wurde ein Geflecht aus Zweigen mit einer Mischung aus Lehm, Stroh und anderen Beimengungen verputzt. Es ist ein billiges und schnell zu verarbeitendes Baumaterial, Vitruv jedoch verwirft es aufgrund der hohen Brandgefahr und erklärt, die Leute wären besser beraten, wenn sie in die teureren Ziegel investierten.52
Der Flechtwerkbau war nicht der einzige Schuldige. Ebenso verweist Vitruv auf die Nachteile bestimmter weicher Steinsorten. Sie neigten zum Bröckeln, seien nicht frost- und regenbeständig und litten unter Salzfraß, wenn sie in Gebäuden in Meeresnähe verwendet würden. Der vielleicht schwerwiegendste Mangel: Sie seien nicht hitzefest und zersprängen bei Bränden. Tiburtiner Stein (aus der Gegend des heutigen Tivoli) besitze gewisse positive Eigenschaften, diese aber nur eingeschränkt. Er widerstehe rauer Witterung und könne große Lasten tragen, sei aber nicht hitzefest, denn, so Vitruv, er enthalte wenig Feuchtigkeit, stattdessen jedoch viel Luft, durch die das Feuer eindringen und so seine Hitze auf den Stein übertragen könne. Vitruv empfiehlt ein Gestein, das man am Rand der etruskischen Region Tarquinii findet, und zwar in Steinbrüchen, die er anicische nennt (vielleicht, weil sie von einem Zweig der Familie der Anicii betrieben wurden). Hauptsächlich finde es sich in der Umgebung des Lacus Volsiniensis (Lago di Bolsena) und im Gebiet von Statonia (in der südlichen Toskana). Dieser Stein sehe aus wie Peperin (leichtes Vulkangestein mit dunklen, an Pfeffer erinnernden Einschlüssen) und besitze eine Reihe hervorragender Eigenschaften. Nicht zuletzt gelte er als sehr wasser- und wenig lufthaltig; deshalb sei er bei Regen wie bei Feuer ein ausgezeichnetes Material.53 Nero war es Ernst mit der Verwendung feuerbeständigen Steins, und so schrieb er dessen Gebrauch beim Wiederaufbau Roms nach dem Großen Brand vor (siehe Kapitel VI).54
Wo Holz verwendet wurde, musste man unbedingt sicherstellen, dass es das richtige Holz für die jeweilige Funktion war. Eine besonders feuergefährliche Stelle in römischen Häusern sieht Vitruv unter den Dachtraufen, wo zu Isolierzwecken Holzpaneele verbaut wurden. Die Römer wären gut beraten, meint er, sich auf eine feuerfeste Lärchenart umzustellen. Auf diesen Baum war Caesar während seiner Feldzüge in Gallien gestoßen, als er ohne Erfolg versuchte, einen Turm in der (sonst unbekannten) feindlichen Siedlung Larignum anzuzünden. Deshalb nannte er das Holz „Lärche“ (larigna, das Adjektiv zum Nomen larix). Diese Spezialeigenschaft der Lärche geht laut Vitruv darauf zurück, dass sie voller Wasser und Erde ist und keine Poren hat, durch die Feuer eindringen kann. Sie wurde an den Ufern des Po und an der Adriaküste angepflanzt, nach Ravenna transportiert und dort verwendet, wurde zu Vitruvs Zeit aber offenbar noch nicht regelmäßig nach Rom importiert.55 Immerhin erwähnt Plinius einen riesigen Balken aus Lärchenholz, den größten, den Rom je gesehen habe, 120 Fuß lang und durchweg zwei Fuß im Durchmesser. Er sei in Raetien (der heutige Südosten Deutschlands und große Teile der Schweiz) geschlagen und anfangs von Tiberius nach Rom gebracht worden, um zur Reparatur der niedergebrannten Bauten rund um die Naumachia des Augustus verwendet zu werden. Der Balken sei jedoch zunächst nicht verbaut, sondern als Kuriosum ausgestellt worden. Schließlich habe Nero ihn für sein Amphitheater auf dem Marsfeld verwendet.56
Um die Gefahr tödlicher Brände in den Wohnblöcken (insulae) zu verringern, führte Augustus laut Strabon eine maximale Höhe von 70 Fuß (ca. 20 m) ein.57 Diese Baugrenze musste Nero nach dem Großen Brand und viele Jahre nach ihm auch Trajan erneut festschreiben. Es war beinahe so, als seien die Höhenbeschränkungen nur dazu eingeführt worden, ignoriert zu werden. Diese Fahrlässigkeit führte zu der von Juvenal beschriebenen gefährlichen Situation, in welcher der dritte Stock eines Wohnblocks bereits voller Rauch sein konnte, ohne dass jemand im obersten Stockwerk auch nur merkte, dass es brannte.58
Auch am Ende der Republik blieb Rom großen Bränden schutzlos ausgeliefert. Ein besonders düsteres Jahr war 23 v. Chr. Offensichtlich hatte irgendeine Epidemie die Stadt erfasst und brachte vielen den Tod: Marcellus, der Neffe des Augustus und wohl auch der von ihm vorgesehene Nachfolger, starb, und Augustus selbst erkrankte schwer. Außerdem stand das Jahr im Zeichen von Überschwemmungen, Stürmen – und Feuern.59 Über letztere sind keine genauen Informationen erhalten, möglich ist jedoch, dass diese ersten schweren Brände seiner Herrschaftszeit Augustus veranlassten, ernsthaft über die Schwächen der bestehenden Systeme zur Brandvermeidung und -bekämpfung nachzudenken. Zudem mögen politische Fragen im Spiel gewesen sein, die aus den gefährlichen Umtrieben eines gewissen Marcus Egnatius Rufus erwuchsen. Egnatius kennen wir von Dio und Velleius Paterculus, letzterer ein zur Zeit des Tiberius tätiger Historiker.60 Anscheinend diente Egnatius 22 v. Chr. als Ädil, also als Magistrat, der mit verschiedenen Aspekten der öffentlichen Verwaltung befasst war. Während seiner Amtszeit bemühte er sich um Beliebtheit, indem er seine Sklaven zum Löschen brennender Häuser einsetzte. Das trug ihm beträchtlichen Rückhalt in der Bevölkerung ein, und so konnte er gleich die nächste Stufe in der Ämterlaufbahn, die Prätur, erreichen, ohne vor der Wahl 20 v. Chr. das übliche zeitliche Intervall zwischen Ämtern einhalten zu müssen. Velleius berichtet, dass Egnatius sodann das höchste Amt, den Konsulat, ins Auge gefasst und darauf gehofft habe, seine frühere Taktik wiederholen und unmittelbar nach seiner Zeit als Prätor in den Wahlen 19 v. Chr. Konsul werden zu können. Der amtierende Konsul weigerte sich, seine Kandidatur zuzulassen. In ihren Berichten über Egnatius’ Reaktion auf diesen Rückschlag heißt es bei Dio, er habe sich „anmaßend“ verhalten, während Velleius klarer und zugleich schärfer urteilt, wobei er soweit geht zu behaupten, Egnatius habe sogar geplant, Augustus zu ermorden, und dafür eine Gruppe von Männern „seines eigenen Zuschnitts“ um sich geschart. Die Verschwörung wurde entlarvt, Egnatius hingerichtet. Sein Verhalten, wie das des Crassus vor ihm, warf ein Schlaglicht auf die allgemeine Unfähigkeit Roms, sich auf staatlicher Ebene wirksam dem Brandproblem zu widmen, und zeigte, wie politisch ehrgeizige Personen die ziemlich chaotischen Verhältnisse, die herrschten, zur Förderung ihrer eigenen Interessen und Ambitionen ausnutzen konnten. Damit erklärt diese Episode in Verbindung mit dem Feuer von 23 v. Chr. vielleicht bis zu einem gewissen Grad, warum wir ausgerechnet im Jahr 22 v. Chr. auf den allerersten systematischen Versuch des Augustus stoßen, eine Art organisierter Truppe zur Brandverhinderung aufzustellen, auf die vermutlich viele der einst bei den tresviri capitales angesiedelten Aufgaben übergingen.
Die Maßnahmen des Augustus erfolgten im Kontext einer Neufestlegung einiger Aufgaben der verschiedenen Ämter. Bis dahin waren die fünf großen römischen Spiele (ludi) die Aufgabe der Ädile gewesen, und zur Deckung ihrer Ausgaben wurde diesen Beamten ein Geldbetrag aus Staatsmitteln zugewiesen. Doch bislang hatte es keine Höchstgrenze für die zusätzlichen Gelder gegeben, die die Ädile möglicherweise ausgeben wollten, und so wetteiferten sie miteinander, um immer prächtigere Spiele zu veranstalten, weil sie hofften, auf diese Weise populär zu werden und so ihre politischen Karrieren zu befördern. Dieses System wurde jetzt beendet. Die Verantwortung für die Spiele wurde den nächsthöheren Amtsträgern, den Prätoren, übertragen, mit der Maßgabe, niemand von ihnen dürfe mehr ausgeben als seine Kollegen. Vielleicht als Ausgleich dafür, dass er den Ädilen die Spiele weggenommen hatte, wies Augustus ihnen – wie Dio berichtet – die Aufgabe der Brandbekämpfung zu und stellte ihnen eine Mannschaft aus 600 Sklaven zur Verfügung.61 Offensichtlich wollte er diese Dienstleistung entpolitisieren und schrieb fest, dass der Umgang mit Bränden fortan Teil der Routineaufgaben eines Ädils sein sollte und nichts, was sich ausschlachten ließ, um politische Beliebtheit zu erlangen. Interessanterweise – und das passt zur Ansicht des Augustus, wonach der Princeps bloß ein primus inter pares sei – fiel für ihn zu dieser Zeit der Feuerwehrdienst nicht in die Verantwortlichkeit des Kaisers selbst. Einstweilen verblieb er in der Zuständigkeit eines traditionellen römischen Magistrats, eines Beamten, der mindestens nominell durch Wahl ins Amt gelangt war.
Irgendwann kurz vor 7 v. Chr. gab es einen Großbrand auf dem Forum Romanum. Davon erfahren wir nur zufällig. Für dieses Jahr spricht Dio von Leichenspielen zu Ehren Agrippas, die in den Saepta Julia stattfanden, der großen Einfriedung aus Säulenhallen auf dem Campus Martius, die Caesar begonnen, Agrippa selbst aber vollendet hatte. Angeblich war der Ort deshalb gewählt worden, weil das Forum nicht verfügbar war (das seit der Frühzeit der Schauplatz öffentlicher Darbietungen wie etwa Gladiatorenkämpfe gewesen war).62 Dort habe es, erfahren wir, ein großes Feuer gegeben, vielleicht im selben Jahr, und mehrere Gebäude seien abgebrannt, sodass das Forum als Veranstaltungsort ausfiel.63 Hier macht Dio einen Exkurs und schiebt die Verantwortung für die Katastrophe Schuldnern in die Schuhe, die auf einen Schuldenerlass gehofft hätten, falls ihr Eigentum bei dem Brand zerstört würde. Wieso sie diese Erwartung hegten, wird nicht deutlich, und so weist der Vorfall auf die Existenz einer gesetzlichen Bestimmung hin, von der wir nicht wissen.64 Doch Dios Behauptung ist alles andere als überzeugend und erinnert in vielem an die späteren wilden Gerüchte über Nero und den Brand von 64 n. Chr. Wenn dies wirklich das Motiv der Verschuldeten war, so scheint ihr Plan jedenfalls nicht aufgegangen zu sein.
Obwohl uns die Details fehlen, war dieser Brand offensichtlich so schwer, dass Augustus sich veranlasst sah, einschneidende Änderungen an jenem Brandschutzsystem vorzunehmen, das er 15 Jahre zuvor eingeführt hatte. Die neuen Maßnahmen waren Teil seiner Neuorganisation der Stadtverwaltung. Rom bestand aus einer ganzen Reihe von Stadtvierteln (vici) – wie viele genau es damals waren, ist nicht sicher (zur Zeit des älteren Plinius, der 79 n. Chr. starb, waren es 265). Jetzt wurden sie unter die Aufsicht lokaler Bezirksvorsteher, der vicomagistri, gestellt, die sich aus freigeborenen Römern und freigelassenen Sklaven rekrutierten; sie genossen beträchtliches Ansehen, wie ihr Privileg beweist, Amtskleidung zu tragen und von zwei Liktoren begleitet zu werden (bei denen es sich im Grunde um Leibwächter handelte, die einen Magistrat begleiteten – ein starkes Prestigesymbol). Den vicomagistri wurde die Aufgabe übertragen, Brände zu bekämpfen, und sie erhielten nun jene Einheit aus 600 Sklaven zugewiesen, die vorher den Ädilen zur Verfügung gestanden hatte. Dies war eine äußerst wichtige Neuerung, denn sie entzog die Verantwortlichkeit für den Brandschutz den traditionell gewählten Beamten und siedelte sie bei Menschen aus einfachen Kreisen an, die direkt vom Kaiser persönlich ernannt wurden. Dieser Schritt in Richtung kaiserliche Aufsicht ist überaus wichtig und markiert ein entscheidendes Stadium in der Entwicklung einer hochorganisierten, zentral gesteuerten Feuerwehr, wie sie etwas mehr als zehn Jahre später eingerichtet werden sollte.
Wie genau die vicomagistri ihre Feuerschutzaufgaben organisierten und wie sie ihr Vorgehen bei einem Großbrand koordinierten, ist unbekannt. Doch im selben Abschnitt seines Textes erwähnt Dio anschließend, Augustus habe die alte republikanische Aufteilung der Stadt in vier Bezirke aufgelöst und sie durch die zu Dios Zeit vertraute Gliederung in 14 Distrikte (regiones) ersetzt. Es ist sehr gut möglich, dass diejenigen vicomagistri, deren Viertel gemeinsam in einem dieser größeren Gebiete lagen, bei schweren Bränden zusammenarbeiteten. Wir wissen es schlicht nicht. Aber bei der nächsten, weiter unten beschriebenen Umorganisation der Feuerwehr, die 6 n. Chr. erfolgte, wurde diese Aufgabe sehr wahrscheinlich auf der Grundlage der 14 regiones geregelt. Tatsächlich sollte diese Einteilung der Stadt Augustus lange überleben und galt noch in der Spätantike.65
An dieser Stelle bietet sich ein knapper, aber notwendiger Exkurs an. Beim Jahr 5 n. Chr. unterbricht Dio seine Schilderung und gibt einen Überblick über die Militärverbände in der Stadt Rom. Zu ihnen zählt er die Prätorianergarde und außerdem eine Einheit, die er auf Griechisch die „Stadtwachen“ (poleōs phrouroi) nennt, auf Lateinisch die cohortes urbanae (normalerweise spricht man daher von den Stadtkohorten). Diese spezielle Einheit wurde nicht eigens zur Brandbekämpfung geschaffen, muss hier aber kurz betrachtet werden, damit das System der Brandabwehr, das Augustus im Folgejahr schuf, in den richtigen Kontext rückt. Die Stadtkohorten bestanden aus drei Kohorten, die in Rom in Garnison lagen (Vespasian erhöhte ihre Zahl auf vier) und wohl je 500 Mann stark waren. Ihr Auftrag lautete, wie Sueton es ausdrückt, die Stadt dauerhaft sicher zu machen (in urbis … custodiam).66 Man verstand sie eindeutig als Erweiterung der neun Prätorianerkohorten (Cohors I–IX), worauf auch die Tatsache hinweist, dass die drei anfänglichen Stadtkohorten die Nummern X–XII erhielten und in der Prätorianerkaserne untergebracht waren. Aber die neuen Kohorten wurden – vielleicht, damit die Prätorianerpräfekten nicht zu viel Macht bekamen – dem Kommando des Stadtpräfekten unterstellt. Die Wirkung dieses geteilten Kommandos zeigte sich nach der Ermordung Caligulas, als Claudius als Kandidat der Prätorianer hervortrat, während die Stadtkohorten loyal zum Senat standen.67 Später wurden Stadtkohorten auch in anderen wichtigen Bevölkerungszentren aufgestellt, darunter Puteoli, Ostia und Lugdunum. Vermutlich waren die Stadtkohorten bereits 5 n. Chr. aktiv, wie ihr Erscheinen in Dios Truppenkatalog nahelegt, aber wann sie aufgestellt wurden, lässt sich nicht sagen. Prinzipiell bestand ihre Aufgabe in Rom darin, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, anfangs jedoch trugen sie wahrscheinlich eine gewisse Verantwortung für die Kontrolle von Bränden – und zwar so gut wie sicher in den Bereichen Plünderung und Brandstiftung –, obwohl wir dafür keine direkten Belege haben.68 Und falls dies zu ihren ursprünglichen Aufgaben gehörte, muss sich das Arrangement als nicht zufriedenstellend erwiesen haben, und seine Mängel wurden möglicherweise während der katastrophalen Brände im nächsten Jahr offenbar.
2.1. Die augusteischen regiones. Zeichnung von J. Skinner.
Zurück zu dem Bericht über die Zeit des Augustus. Im Jahr 6 n. Chr. wurde Rom von einem Großbrand verheert. Laut Dio wurden „viele Teile“ der Stadt (pollà tēs poleōs) zerstört; Ulpian, ein im 3. Jahrhundert n. Chr. tätiger Jurist, vermerkt, dass an einem einzigen Tag mehrere Brände ausbrachen.69 Diese überaus mageren Informationsbröckchen sind alles, was wir über Ausmaß und Wirkung des Feuers wissen, und wir können kein einziges betroffenes Gebäude benennen. Offensichtlich war die Lage aber sehr ernst, und die paranoide Stimmung, die anschließend in Rom herrschte, erinnert an das, was wir nach dem Brand von 64 n. Chr. antreffen. Die Katastrophe des Jahres 6, so berichtet Dio, fiel in eine Phase großer allgemeiner Unzufriedenheit, als eine Hungersnot und hohe Steuern die Menschen ohnehin schon bedrückten. Als dann noch die Brände dazukamen, wurde plötzlich von Aufruhr geredet, was manche mit Intrigen im Kaiserhaus verbanden. Ein Untersuchungsausschuss wurde eingesetzt, und wie vermutlich auch 64 n. Chr fand man einen passenden Sündenbock, in diesem Fall war es ein gewisser Publius Rufus, dem man Brandstiftung vorwarf. Personen des öffentlichen Lebens wurden aufgefordert, als Zeugen auszusagen.70 Genau zur richtigen Zeit trafen Getreideschiffe aus Ägypten ein und linderten die Lebensmittelknappheit, was zur Beruhigung der Stimmung im Volk beitrug, und Tiberius (jetzt der Adoptivsohn des Augustus) veranstaltete gemeinsam mit dem allseits bewunderten Germanicus Spiele zur Erinnerung an den überaus erfolgreichen römischen Feldherrn Drusus (den Bruder des Tiberius und Vater des Germanicus) – und um die Leute auf andere Gedanken zu bringen. Die üble Stimmung im Volk scheint Augustus davon überzeugt zu haben, dass die Neuerungen von 7 v. Chr. für den Umgang mit Bränden in der Stadt nicht ausreichten. Offensichtlich brauchte es radikalere Maßnahmen. Am dringlichsten war es, den Feuerwehrdienst dem viel festeren Zugriff des Kaisers zu unterstellen.
Im selben Jahr 6 n. Chr. erleben wir die wichtigste Veränderung in der Geschichte der Brandbekämpfung im antiken Rom: Augustus schuf eine Sonderformation aus Männern, die als Vigiles (Wächter) bekannt wurden.71 Hauptaufgabe dieser Einheit war die Brandbekämpfung; wenn nötig, konnte man sie auch bei Aufruhr einsetzen, aber wir kennen keinen eindeutigen Fall, in dem dies auch geschah.72 Anfangs wurden sie unter den Freigelassenen rekrutiert, die nach sechs (später drei) Dienstjahren das römische Bürgerrecht erwerben konnten.73 Sieben Kohorten wurden aufgestellt; das Kommando erhielt ein römischer Ritter im neu geschaffenen Amt eines Präfekten der Vigiles (praefectus vigilum). Ihn ernannte der Kaiser direkt, der damit eine strikte Kontrolle über das ganze Unternehmen ausübte.74 In gewissem Sinne handelte es sich um eine paramilitärische Einheit, und Sueton beschreibt sie mit militärischen Begriffen: Er sagt ausdrücklich, ein Freigelassener, der bei den Vigiles diene, tue dies als miles (Soldat).75 „Kohorte“ ist ein Terminus technicus für eine Militäreinheit als Teil der römischen Armee; er wurde bereits für die neun Einheiten der Prätorianergarde und die drei Stadtkohorten verwendet. Es ist viel darüber gestritten worden, ob die Kohorten der Vigiles anfangs quingenar (das heißt 500 Mann stark) oder miliar, tausend Mann stark, waren (wir wissen, dass sie zu Anfang des 3. Jahrhunderts cohortes miliariae waren); dies waren die beiden Kohortenstärken, die man normalerweise bei den aus Nichtbürgern bestehenden Auxiliarverbänden der römischen Armee antrifft (in den regulären Legionen betrug die übliche Kohortengröße 500). Es ist nicht möglich, die Größe der Vigiles-Kohorten im Jahr 6 n. Chr. zu ermitteln, und tatsächlich kann es sein, dass sie sich nicht ins Auxiliarschema von 500 oder 1000 einfügten.76
Angeblich war die Maßnahme des Augustus als vorübergehende gedacht, aber offenbar erwies sie sich als wirksam und entwickelte sich zu einer festen Institution. Dio bemerkt, dass die Vigiles zu seiner Zeit, im 3. Jahrhundert, immer noch bestanden, und ergänzt, dass sie inzwischen nicht mehr exklusiv aus Freigelassenen bestanden. Dies bestätigt eine Inschrift aus der Zeit von Kaiser Septimius Severus (193–211), Dios Zeitgenossen, die innerhalb der Truppe mehr Freigeborene als Freigelassene nennt.77 Das könnte darauf hinweisen, dass sich mit der Organisation ein wachsendes Prestige verband.
Im Jahr 7 v. Chr. hatte Augustus Rom bereits in 14 Regionen eingeteilt, und diese Regelung nutzte er, um den Vigiles eine Organisationsstruktur zu geben. Paulus, ein Jurist des 3. Jahrhunderts, berichtet, dass die sieben Kohorten so über die Stadt verteilt waren, dass jede Kohorte für zwei Regionen zuständig war – vermutlich war das System flexibel genug, um bei Großbränden eine schnelle Abordnung in andere Bezirke zu erlauben.78 Außerdem ist es nun einmal so, dass Brände durch Zufall oder Absicht entstehen können, und nicht immer ist die Grenze zwischen Brandstiftung und anderen Verbrechen eindeutig. Daher fiel den Vigiles zu einem unbekannten Zeitpunkt auch die Zuständigkeit für Plünderung, Betrug, Einbruch und entlaufene Sklaven zu, wie viel später belegt ist.79 Zwar spielten sie bei politischen Ereignissen nicht die zentrale Rolle, wie sie die Prätorianer einnahmen, aber schon früh stellen wir den Einsatz der Vigiles zumindest am Rand eines solchen Geschehens fest – vor allem 31 n. Chr., in der Spätzeit des Tiberius, als sie unter ihrem Präfekten Macro Teil des komplizierten Intrigenspiels waren, das zum Sturz des berüchtigten Prätorianerpräfekten Seianus führte.80 Außerdem wurden die Vigiles 69 n. Chr. in die Machtkämpfe nach Neros Tod verwickelt, als sie sich mit den Stadtkohorten gegen die Prätorianer verbündeten.81
Brände bekämpften sie mit Äxten, Eimerketten, Mauerhaken, Leitern und in Essig getränkten Matten.82 Irgendwann kamen Feuerspritzen (sipones) dazu, und Inschriften der Severerzeit erwähnen „Spritzenmänner“ (siponarii).83 Es ist nicht sicher, ob pumpenbetriebene Spritzen schon zur Zeit Neros verfügbar waren, aber im frühen 2. Jahrhundert wurde das Fehlen von sipones in der normalen Feuerwehrausrüstung in Bithynia-Pontus (einer Provinz in Kleinasien) in der Korrespondenz zwischen Plinius dem Jüngeren, dem Provinzstatthalter, und Kaiser Trajan zum Thema, was darauf schließen lässt, dass sie spätestens zu diesem Zeitpunkt als etwas Selbstverständliches vorausgesetzt werden konnten.84 Spätere Inschriften erwähnen außerdem ballistae – im Grunde Artilleriegeschütze, die man vermutlich zur Zerstörung von Gebäuden benutzte, auf die sich ein Feuer zubewegte. Als Seneca dem jungen Nero Leitlinien für seine Kaiserherrschaft vorgeben will, bemerkt er trocken, wenn ein Feuer in einem Privathaus ausbreche, könnten die Familie und die Nachbarn damit fertig werden, indem sie einfach Wasser darauf gießen, aber ein Großbrand, der schon viele Häuser verschlungen habe, lasse sich nur durch die absichtliche Zerstörung eines Teils der Stadt aufhalten – eindeutig ein Verweis auf das vorsätzliche Einreißen von Häusern, um eine Feuerschneise zu schaffen, eine Methode, die beim Brand von 64 n. Chr. verwendet wurde.85
Für Kasernen der Vigiles haben wir in augusteischer und selbst in neronischer Zeit noch keine Belege, und es kann sein, dass die Vigiles in ihrer Frühzeit vorübergehend an verschiedenen Stellen der Stadt einquartiert wurden. In späterer Zeit erwähnt eine Reihe von Inschriften Unterkünfte, und in Rom sind Überreste von Wohngebäuden gefunden worden.86 Wie wir wissen, stellte Hadrian eine Vigiles-Einheit für Ostia auf, deren Anwesenheit durch die Reste eines großen Kasernengebäudes bezeugt ist, das gegen Ende seiner Herrschaftszeit repariert wurde. Der Häuserblock in Ostia besteht aus einem großen, nicht überdachten Hof, den eine Portikus mit mindestens einem Obergeschoss umgab. Die meisten Räume waren Unterkünfte für die Männer. Möglicherweise wurde derselbe Bauplan in Rom verwendet, wie ein Fragment des severischen Marmorplans aus dem frühen 3. Jahrhundert nahelegt (vgl. Kapitel I). Das dort abgebildete Gebäude besteht aus drei parallelen, von Räumen umschlossenen rechteckigen Höfen. Insgesamt misst der Bau 155 × 175 m.87
Schwer einzuschätzen ist, wie wirkungsvoll die Vigiles wohl als Feuerwehrmänner waren. Wenn sie gute Arbeit leisteten, konnten sie kleinere Brände daran hindern, sich auszubreiten, und die große Mehrzahl der Vorfälle, die ihren Einsatz verlangten, fand dementsprechend keinen Eingang in die Quellen. Ausdrücklich genannt werden sie in den Berichten über den Großen Brand nur einmal, nämlich bei Dio, aber das kann uns kaum überraschen – ihre Anwesenheit bei einem Brand wird schlicht eine Selbstverständlichkeit gewesen sein.88 Und fast sicher handelt es sich bei ihnen um die namenlosen finsteren Gestalten, von denen die Schriftquellen berichten, sie würden die Brände schüren, die aber in Wirklichkeit vermutlich Feuerschneisen schufen. Jedenfalls beschäftigen Brände die Römer auch rund ein Jahrhundert nach der Schaffung der Vigiles noch ausreichend. Neben Gebäudeeinstürzen und Dichterlesungen nennt Juvenal das Feuer als einen der Schrecken, wenn man in Rom lebt, womit er einen Eindruck wiederholt, den Martial häufig äußert.89
Immerhin besitzen wir aus der Literatur der neronischen Zeit einige indirekte Zeugnisse, dass die Vigiles gute Arbeit leisteten. So schildert Seneca die Vorbereitungen für Gäste, darunter ein schönes warmes Feuer, das aber mäßig groß sein solle, nicht wie die großen Feuer reicher Leute, welche die Vigiles so beunruhigen. Eine unterhaltsame Skizze, was passieren konnte, wenn man deren Aufmerksamkeit erregte, finden wir in den berühmten Satyrica des Petronius. Dieses wilde, hemmungslose Sich-Austoben in Serie mit seinen absurd überzeichneten Charakteren ist der älteste erhaltene römische Roman und wurde mit ziemlicher Sicherheit in neronischer Zeit geschrieben. Nach Trimalchios Gastmahl, das an einen imaginären Ort in Süditalien stattfindet, aber eine Parodie auf Rom darstellt, furzt ein Sklave so laut, dass die Vigiles, die in der Nähe patrouillieren, fest überzeugt sind, es brenne, und mit Äxten und Eimern das Haus stürmen.90 Man konnte von der Reform des Augustus nicht erwarten, dass sie ganz allein das Problem der Brände in der Stadt löste, aber Fakt ist, dass für die acht Jahre zwischen 6 n. Chr., als die Vigiles entstanden, und dem Tod des Princeps im Jahr 14 kein Brand in Rom dokumentiert ist.
Zwei weitere Aspekte der Brandbekämpfung in der Kaiserzeit verdienen Erwähnung. Der erste Ausbruch eines Feuers nach dem Tod des Augustus ist relativ unwichtig und hat es schlicht und einfach deshalb in die Überlieferung geschafft, weil ein Witz daran hing. Drusus, der unsolide Sohn von Augustus’ Nachfolger Tiberius, war ein schwerer Säufer, der seinen Wein nach römischer Sitte wohl mit warmem Wasser verdünnte. Wir erfahren, dass er einmal (Datum unbekannt) zusammen mit den Prätorianern jemandem zu Hilfe kam, dessen Anwesen brannte, und er, als nach Wasser gerufen wurde, den Gardisten befahl, dafür zu sorgen, dass es schön warm sei (der römische Humor war selbst im besten Fall so gewöhnungsbedürftig wie der warme Wein). Der Ort des Brandes – falls die ganze Geschichte nicht einfach frei erfunden ist – ist unbekannt, wird aber mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit in der Nähe der Kaiserresidenz auf dem Palatin gelegen haben, sonst wäre die Anwesenheit Drusus’ und der Prätorianer schlecht erklärbar. So platt die Anekdote im Grunde ist, in zwei Punkten ist sie hochinteressant. Man beachte, dass Drusus zu den Prätorianern stieß, nicht zu den Vigiles, und seine Anwesenheit bei ihnen nicht weiter kommentiert wird. Das überrascht nicht. Die offizielle Aufgabe der Prätorianer war es, den Kaiser (und dessen Familie) zu bewachen, aber sie sind auch in einer Vielzahl anderer Funktionen bezeugt: Sie verhörten Verbrecher, zogen Steuern ein, sorgten für die Ordnung auf den Straßen Roms, und so ist ihre Beteiligung an der Brandbekämpfung vielleicht zu erwarten, besonders bei Bränden, die den Kaiser oder seine Verwandten betrafen.91 Der Prätorianertribun Subrius Flavus befand sich bei Nero, als der Kaiser sich 64 n. Chr. damit beschäftigte, den Brand auf dem Palatin unter Kontrolle zu bringen (siehe Kapitel IV).92
Das andere interessante Detail besteht darin, dass der Sohn des Kaisers sich persönlich um den Vorfall kümmerte; das wirft ein Licht auf eine im Kaiserhaus entstandene Tradition, wonach dessen Mitglieder direkte und persönlich-zupackende Verantwortung in der Brandbekämpfung übernahmen; Nero erbte diese Tradition und stellte sie 64 offensichtlich unter Beweis. Und das betraf nicht allein die Männer. Bei einer Gelegenheit tadelte Tiberius seine Mutter Livia, weil sie sich in Dinge eingemischt habe, die, wie er fand, Männersache seien. Dazu zählte Livias Beteiligung an den Anstrengungen, ein Feuer zu bekämpfen, das den Tempel der Vesta bedroht hatte. Wie Sueton erwähnt, hatte Livia tatsächlich zu Lebzeiten des Augustus regelmäßig solche Hilfe geleistet, was indirekt darauf hinweist, dass Augustus selbst an solchen Aktivitäten teilgenommen haben könnte (einen direkten Beleg gibt es in seinem Fall nicht). Später begleitete Neros Mutter, Agrippina die Jüngere, in ähnlicher Weise ihren Gatten Claudius, wenn er sich um die Brandbekämpfung kümmerte.93 Selbst ein insgesamt verantwortungsloser Princeps wie Caligula stürzte sich persönlich mitten ins Getümmel und arbeitete Seite an Seite mit den Feuerwehrleuten während eines schweren Brandes im Jahr 38 im Bezirk Aemiliana.94 Derselbe Bezirk erlebte nicht viel später während der Herrschaft von Caligulas Nachfolger Claudius eine zweite verheerende Feuersbrunst.95 Erneut kümmerte der Kaiser sich persönlich darum, und Sueton beschreibt, wie Claudius zwei Tage lang energisch die Brandbekämpfung organisierte und freiwillige Helfer bar bezahlte. Gut möglich, dass dies die Gelegenheit ist, von der (die Epitome von) Cassius Dio spricht, als Claudius während eines Großbrandes von seiner Frau Agrippina, Neros Mutter, begleitet wurde.96 Selbst Commodus, der vielleicht nutzloseste aller römischen Kaiser, kehrte 191 aus dem Umland der Stadt nach Rom zurück, um persönlich die Soldaten und Zivilisten in ihrem vergeblichen Bemühen zu unterstützen, das riesige Feuer zu löschen, das einen Großteil Roms verwüstete.97 Und 64 stürzte sich Nero während der Frühphase des Großen Brandes energisch in die Brandbekämpfung. Außerdem half er, indem er auf eigene Kosten Brandschutt wegräumen ließ. In ähnlicher Weise verfuhr auch Vespasian, nur sehr viel „zupackender“, und am Wiederaufbau des Kapitols nach einem Großbrand beteiligte er sich, indem er zusammen mit anderen eigenhändig den Schutt wegtrug.98
Brände scheinen zu jenen Katastrophen zu gehören, bei denen wir irgendwie erwarten, dass unsere Führungspersönlichkeiten sich ganz persönlich engagieren. Während des Brandes von London 1666 beispielsweise leisteten König Karl II. und mehr noch sein Bruder Jakob, der Duke of York (und spätere Jakob II.), demonstrativ Hilfe vor Ort. Überliefert ist, dass beide Brüder gemeinsam knöcheltief in der Themse standen und Wasser pumpten, um die Flammen zu bekämpfen.99 Aber nirgends, scheint es, wurde dieses Konzept der Herrscherverantwortung so ernst genommen wie im antiken Rom. Brände brachten eindeutig das Beste in den römischen Kaisern zum Vorschein und motivierten sie, nicht nur während des eigentlichen Geschehens tätig zu werden, sondern auch hinterher außerordentliche Großzügigkeit zu zeigen. Für Letzteres gab es eine Art republikanisches Vorbild. Auf den Tod Caesars 44 v. Chr. war eine Phase großer Unruhen gefolgt, und drei Jahre später sind für 41 v. Chr. gewaltsame Zusammenstöße zwischen Banden städtischer Armer und entlassenen Veteranen überliefert, die die Einlösung versprochener Geschenke verlangten. Zwar besaßen die Soldaten bessere Waffen und waren ausgebildet, aber die Einheimischen kannten sich in der Stadt aus und bedienten sich einer Art urbanen Terrors, indem sie Brandfackeln von den Dächern herabschleuderten. Das Ganze mag leicht wie ein weiterer Fall ganz normaler städtischer Gewalt erscheinen, die zu Brandstiftung führte. Tatsächlich aber war die Lage sehr ernst und hatte weitreichende Folgen. Zahllose Häuser brannten ab, und um die sozialen Folgen zu mildern, wurden den Städtern in gewissem Umfang die Mieten erlassen (weil das Problem weite Kreise zog, gab es Hilfsmaßnahmen auch in anderen Städten Italiens).100 Das war ein bemerkenswerter Schritt, die früheste uns bekannte Intervention einer zentralen römischen Instanz zur Hilfeleistung nach einem Brand, wie sie dann in der Kaiserzeit zur vertrauten Erscheinung werden sollte, als die Kaiser es politisch ratsam fanden, ihre Freigebigkeit publik zu machen.
Im Jahr 27 n. Chr. wurde der Caelius von einem verheerenden Feuer getroffen. Tacitus behauptet, der gesamte Hügel sei zerstört und alles ausgelöscht worden, mit einer bedeutenden Ausnahme: Eine Statue des Tiberius, die im Haus eines Senators namens Junius stand, blieb unversehrt, und die Leute verglichen sie mit der Statue der Claudia Quinta im Tempel der Magna Mater (der Großen Mutter). Auch diese war bei einem viel früheren Brand auf wundersame Weise verschont geblieben. Claudia war dafür berühmt, dass sie den schwarzen Meteoriten in Empfang nahm, der für die Göttin Kybele stand, als er im späten 3. Jahrhundert aus dem phrygischen Pessinus nach Rom gebracht wurde. Es heißt, sie habe das Schiff mit dem Stein ganz allein den Tiber aufwärts gezogen. Angesichts dieser heroischen Anstrengung erscheint es vielleicht nur angemessen, dass ihre Statue im Vorraum des Magna-Mater-Tempels aufgestellt wurde, den Marcus Junius Brutus 191 v. Chr. auf dem Palatin weihte, und ebenso angemessen, dass dieselbe Statue wie durch ein Wunder gerettet wurde, als der Tempel 111 v. Chr. niederbrannte, womit sie einen schönen Präzedenzfall für die Tiberiusstatue viele Jahre später abgab. Tiberius entschädigte alle, deren Eigentum 27 n. Chr. zerstört worden war, und wehrte sich damit gegen die Klagen, irgendwie sei er schuld, nicht als Brandstifter, wohl aber wegen seiner Unheil verheißenden Abwesenheit von Rom (natürlich weilte er auf Capri). Dann brannte 36 n. Chr. ein Teil des Circus Maximus nieder. Die Fasti Ostienses berichten, Tiberius habe die Tradition kaiserlicher Freigebigkeit angesichts solcher Katastrophen fortgesetzt, indem er die Eigentümer in voller Höhe für ihre verlorenen Werte entschädigte und 100 Millionen Sesterze an Wiedergutmachung auszahlte, womit er die enge Verbindung zwischen dieser Art staatlicher Beihilfen und dem Kaiser persönlich bestätigte – was besonders beachtlich war, weil Tiberius für seine Sparsamkeit bekannt war.101 Zu den guten Eigenschaften von Tiberius’ Nachfolger Caligula zählt Sueton dessen Großzügigkeit nach Bränden. Tatsächlich zählt der Vorfall (in den Aemiliana), bei dem Dio von Caligula berichtet, der Kaiser habe nicht nur bei der Brandbekämpfung geholfen, sondern auch Entschädigungen für die erlittenen Verluste gezahlt, zu den ganz wenigen positiven Handlungen, die aus Caligulas Herrschaftszeit überliefert sind.102 Nero erhält diese Tradition kaiserlicher Großzügigkeit nach 64 aufrecht. Damals setzte er Hilfsmaßnahmen in Kraft (Kapitel III), obwohl diese Geste, wie man sich denken kann, die erzählenden Quellen nicht beeindruckt hat.
Die Nachwelt hat schon immer eine enge Verbindung zwischen Nero und dem katastrophalen Brand von 64 gezogen, doch seine Bilanz bei der Brandbekämpfung und -verhütung insgesamt scheint nicht schlechter als die seiner Vorgänger zu sein. Für seine fast 14-jährige Herrschaft ist in Rom nur ein einziger weiterer schwerer Brand belegt. Tacitus berichtet, 62 sei Neros Gymnasion bis auf die Grundmauern niedergebrannt.103 Er hatte es auf dem Marsfeld nahe dem Pantheon neben seinem großen Thermenkomplex erbaut und alles zusammen im Jahr 60 in Verbindung mit der ersten Feier der Neronia, eines seiner großen Festspiele, eingeweiht. Tacitus erwähnt das ziemlich unheilvolle Detail, der Brand habe eine Statue Neros in eine formlose Masse verwandelt – ganz im Gegensatz zu der wundersamen Verschonung der Statuen des Tiberius 27 n. Chr., der Claudia Quinta 111 v. Chr. und noch früher der Statue des Servius Tullius, als 213 der Tempel der Fortuna abbrannte.
Für den Rest von Neros Herrschaft sind keine weiteren Brände überliefert, und so können wir einigermaßen sicher sein, dass es in den vier Jahren bis zu seinem Tod keinen Großbrand gab.104 Um aber das Beweismaterial für den Großen Brand von 64 richtig einschätzen zu können, müssen wir die Geschichte über Nero hinaus fortsetzen und ein späteres Feuer einbeziehen, das die Interpretation dieser Belege zu einer besonderen Herausforderung macht.
Im Jahr 80 n. Chr., nur 16 Jahre nach dem Großen Brand, verwüstete ein weiteres schweres Feuer Rom, angeblich ein Vorzeichen des Weggangs von Kaiser Titus (79–81) aus der Stadt.105 Dieser spätere Brand, der möglicherweise fast ebenso schwer war wie sein Vorgänger, wütete drei Tage und Nächte lang und zerstörte weite Teile des Marsfeldes und das Kapitol. Sueton erwähnt ihn lediglich als Teil der furchtbaren Katastrophen während Titus’ kurzer Herrschaftszeit (zusammen mit dem Vesuvausbruch und einer Epidemie), Dio aber hilft uns mit Einzelheiten weiter und zählt die zerstörten Gebäude auf: den Tempel für Isis und Serapis, die Saepta Julia, die Basilika des Neptun, die Agrippathermen, das Pantheon, das Diribitorium, das Balbustheater, das Bühnenhaus des Pompeiustheaters, die Portikus der Octavia samt ihren Bibliotheken und den Jupitertempel auf dem Kapitol (der schon einmal 69 bei den Zusammenstößen zwischen den Anhängern des Vitellius und Vespasians abgebrannt und anschließend durch Vespasian ersetzt worden war).106 Die von Dio beschriebenen Zerstörungen scheinen Gebiete betroffen zu haben, von denen wir nicht wissen, ob sie vom Brand des Jahres 64 erreicht wurden. Allerdings sollten wir uns angesichts des Qualitätsstandards der Berichte über Brände im antiken Rom vor der Annahme hüten, Dios Bericht sei ausführlich oder gar vollständig. Als der Dichter Statius in einem wahrscheinlich 91 oder kurz danach geschriebenen Gedicht eine Reiterstatue Kaiser Domitians besingt, spricht er davon, dass sie auf die umliegenden Gebäude blickt, und fragt: „Oder erheben sich die neuen Bauten auf dem Palatin, die Flammen verachtend (contemptis […] flammis), schöner als zuvor?“107 Da Domitians Palast 92 fertiggestellt wurde, gut 26 Jahre nach dem neronischen Brand, muss man die Möglichkeit, dass sich Statius trotz Dios Schweigen auf den späteren Brand des Jahres 80 bezieht, durchaus in Betracht ziehen – was uns vor blindem Vertrauen in die erzählenden Quellen warnen sollte.
Wie Nero im Jahr 64 war auch Titus beim Ausbruch des Brandes nicht in der Stadt (er kümmerte sich in Kampanien um die Folgen des Vesuvausbruchs), und wie Nero scheint ihn die Katastrophe in die Stadt zurückgeholt zu haben, denn Sueton sagt, nach einem persönlichen Blick auf die Zerstörungen sei Titus der Ansicht gewesen, seine Welt sei zu Ende (periisse testatus – an dieser Stelle ist die handschriftliche Überlieferung sehr unsicher). Eilig begann er den Wiederaufbau und stiftete Kunstgegenstände aus seinem eigenen Palast zur Ausstattung der öffentlichen Bauten und der Tempel. Doch lebte Titus nicht lange genug, um die Sache zu Ende zu bringen, und Domitian schloss die Arbeiten dann ab. Der domitianische Wiederaufbau des Jupitertempels auf dem Kapitol erfolgte in großartigem Maßstab.
Um die mögliche Bedeutung des Feuers von 80 n. Chr. für ein korrektes Verständnis des Brandes von 64 einschätzen zu können, müssen wir uns einer Eigenheit archäologischer Befunde bewusst sein. Ein Schlüsselelement in der Archäologie ist die Stratigraphie. Wechselnde Phasen menschlicher Anwesenheit an einer Fundstätte verraten sich durch entsprechende Siedlungsschichten. Im Idealfall erinnern die vertikalen Schnitte, die eine Ausgrabung ansetzt, an eine vielschichtige Torte: Die unterschiedlich gefärbten Zutaten, die für aufeinanderfolgende Stadien menschlicher Tätigkeit stehen, sind dann in einer sauberen Abfolge waagerechter Schichten erhalten. Aber nur selten sind archäologische Fundorte so ordentlich oder so einfach. Die stratigraphische Folge kann von den Fundamenten späterer Gebäude zerschnitten sein, und es kann schwierig werden, die derart unterbrochenen und nur als über die gesamte Fundstelle verteilter Flickenteppich erhaltenen Einzelschichten miteinander in Beziehung zu setzen. Am frustrierendsten ist vielleicht, dass Materialien in benachbarten horizontalen Schichten möglicherweise einander ähneln und, falls sie sich chronologisch nahestehen, eventuell datierbare Stücke umfassen, die leicht zu verwechseln sind – normalerweise in Form zerbrochener Keramikscherben, die oft nur sehr schwer genau zu datieren sind. Gerade dieses letztere Problem quält die Archäologie. Wir müssen uns vor Augen halten, dass stellenweise vermeintliche archäologische Belege für den neronischen Brand von 64 tatsächlich auf den großen flavischen Brand von 80 verweisen könnten.
Diese sehr knappe Übersicht über die Probleme, die sich bei Bränden in Rom stellen – von den Anfängen der Republik 509 v. Chr. bis zum Großen Brand von 64 n. Chr. und noch ein bisschen später –, ist durch eine Reihe konstanter Charakteristika gekennzeichnet. Egal in welcher Zeit wir uns bewegen, wir sind weitgehend den verfügbaren Quellen ausgeliefert. Dabei stellt sich oft weniger die Frage, ob überhaupt Informationen verfügbar sind, als vielmehr die Frage ihrer Qualität. Mehrere Themen, die wir in den Berichten zum Jahr 64 finden, wiederholen sich während des gesamten Zeitraums. Wir stellen fest, dass bestimmte Gebiete Roms offenbar besonders feueranfällig waren. Dazu zählt vor allem der Circus Maximus, wo der Brand von 64 ausbrach – ein Faktor, an den wir uns erinnern müssen, wenn wir einschätzen wollen, ob dieses Ereignis auf menschliche Einwirkung zurückging. Außerdem bemerken wir eine wiederkehrende Tendenz, nach Schuldigen zu suchen, die gelegentlich zur Anprangerung leicht identifizierbarer und unbeliebter Gruppen führt, seien die Sündenböcke nun Capuaner oder Christen. Damit verbunden ist die besondere Feindseligkeit gegenüber jedem, der verdächtigt wird, einen Brand gelegt zu haben, und eine vielleicht noch tiefere Feindschaft gegenüber denen, die irgendwie von einem Feuer zu profitieren scheinen. Und die späteren Brände offenbaren darüber hinaus einen der positiven Aspekte des Prinzipats – die Vorstellung vom Kaiser als Beschützer des Volkes, der sich um die Brandverhütung kümmert, seine persönliche Beteiligung an der Bekämpfung einmal ausgebrochener Feuer und schließlich das Bemühen um das Wohlergehen aller Feuergeschädigten, alles Teil der besonderen Verantwortung des Kaisers. Nero ging später sogar noch weiter, indem er sich um eine gute Stadtplanung als Schlüssel zur künftigen Reduktion des Brandrisikos bemühte.
Doch so sehr sich all diese Muster wiederholen: Das schreckliche Ausmaß des Großen Brandes von 64 n. Chr. und seine tiefgreifenden Folgen heben ihn klar aus den vielen anderen Feuern in Rom heraus, ebenso seine Verbindung mit einem der bekanntesten und eigenwilligsten Herrscher Roms und die langfristigen Folgen für diesen. Seinen Platz in der Geschichte hat das Feuer sicher.