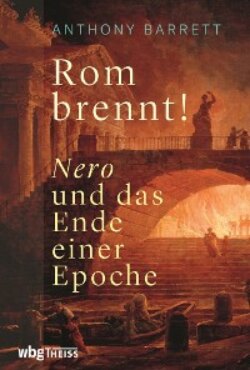Читать книгу Rom brennt! - Anthony Barrett - Страница 7
Prolog
ОглавлениеAm Abend des 19. Juli 64 n. Chr. brach in der Nähe von Roms großer Wagenrennbahn, dem Circus Maximus, ein kleines Feuer aus. Es sollte den Lauf der Geschichte ändern. Den eindrucksvollen Bau des Circus säumte ein dichtgedrängtes Sammelsurium kleiner Läden und billiger Restaurants, und solange es hell war, herrschte eine fröhliche, lautstarke Atmosphäre. Obstverkäufer, Astrologen, Parfümhändlerinnen, Prostituierte, Korbflechter, Wahrsager – sie alle sind für die Gegend bezeugt. Bei Einbruch der Nacht wurde es hier sehr viel ruhiger und in gewisser Weise gefährlicher – nicht wegen der Kriminellen, sondern einfach, weil weniger Menschen in der Nähe waren, die ein Auge auf die dort gelagerten unordentlichen Warenstapel haben konnten, von denen viele relativ leicht entflammbar waren und wie Zunder wirken konnten. In diesem Fall begann der Brand im Lager eines unbekannten Händlers. Anfangs wird man sich deswegen kaum Sorgen gemacht haben. Zufällig aber herrschte in dieser Nacht starker Wind aus wechselnden Richtungen, und die Flammen griffen zunächst auf die übrigen Stände über, dann, was viel bedrohlicher war, auf den Bau des Circus selbst, dessen obere Etagen nach wie vor hauptsächlich aus Holz bestanden. Die starken Windstöße waren derart unberechenbar, dass die Flammen vom Circus auf den Fuß des vornehmen Palatins, der nordöstlich davon lag, überspringen konnten, wo sie rasch den Hang aufwärts kletterten und dann auf dem Kamm des Hügels eine Schneise der Verwüstung durch die imposanten Anwesen der Kaiserfamilie und die prunkvollen Behausungen der oberen Zehntausend Roms schlugen. So verheerend das alles war, im Grunde war es nur der Anfang. Das Feuer breitete sich über den Hügel und abwärts durch die tieferen Wohnlagen aus, und jetzt begann es, unerbittlich die überfüllten Mietshäuser der dichtbewohnten Armenviertel zu verschlingen. Es ist erstaunlich, dass die Flammen insgesamt neun entsetzliche Tage wüteten. Wenn wir antiken Berichten glauben, war das Grauen unvorstellbar. Menschen saßen in den brennenden vielstöckigen Gebäuden in der Falle; wer es nach draußen schaffte, lief Gefahr, auf der Flucht totgetrampelt zu werden, und weil der Wind ständig die Richtung wechselte, fanden sich diejenigen, die meinten, den Flammen entkommen zu sein, plötzlich auf dem Weg mitten hinein in neue Feuerstürme wieder, die plötzlich aus dem Nichts aufzuflackern schienen. Um der allgemein herrschenden Verzweiflung die Krone aufzusetzen, gab es Gerüchte, wonach der Kaiser, Nero, in einem Theaterkostüm gesichtet worden sei, wie er von einem sicheren hohen Turm auf dem Esquilinhügel auf die sich ausbreitende Zerstörung herabblickte, blind gegenüber dem Leid unter ihm, einzig konzentriert darauf, sich durch das grausige Inferno dichterisch inspirieren zu lassen, während er sein großes Epos über den Fall Trojas vortrug.
Das Feuer, das als zufälliger Funke in einem ganz alltäglichen Warenstapel begonnen hatte, erwies sich als verheerendster Brand in der Geschichte Roms, und ganze Bezirke der alten Stadt waren danach nur noch eine rauchende Einöde. Die Menschen, die die Katastrophe überlebt hatten, wurden wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens von dem Erlebten verfolgt. Aber hatte der Brand auch eine Bedeutung, die über seine Auswirkungen auf das persönliche Leben einer relativ begrenzten Anzahl von Römern hinausging? Es gibt starke Gründe dafür, dass dies tatsächlich so war und dass der Brand Ereignisse in Gang setzte, die zu tiefen Umbrüchen im Verlauf der römischen Geschichte führten. Die historische Forschung streitet schon lange über das Konzept von „Wendepunkten“, doch wie im Fall der meisten Begriffskonstrukte in den Geisteswissenschaften scheint eine allgemein anerkannte Definition solcher Ereignisse nach wie vor leider unerreichbar zu sein.
Dennoch herrscht zumindest Einigkeit darüber, dass es sich bei einem historischen Wendepunkt um ein Ereignis handeln muss, das nicht nur zum Zeitpunkt seines Eintritts als einschneidend empfunden wurde, sondern auch aus der Rückschau nachweislich einen bleibenden Einfluss auf die folgende Geschichte hatte. Letzteres ist entscheidend. Zwar ist die berühmte, vielzitierte Antwort des chinesischen Politikers Zhou Enlai auf die Frage nach dem Stellenwert der Französischen Revolution – es sei noch zu früh für ein Urteil – ihm so gut wie sicher nur in den Mund gelegt worden (wahrscheinlich meinte Zhou stattdessen die Studentenunruhen von 1968), aber die Pointe der zweifelhaften Anekdote bleibt gültig. Ein Ereignis wie beispielsweise der New Yorker Börsencrash 1929, der von den Zeitgenossen als wahrhaft katastrophal empfunden worden sein muss, dessen globale Folgen sich aber kaum mehr als zehn Jahre später verflüchtigt hatten, lässt sich nicht sinnvoll als Wendepunkt bestimmen. Und selbst dort, wo die Auswirkungen langanhaltend sind, ist die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung oft mehrdeutig und umstritten. Um nur ein Beispiel von vielen zu nennen: Der Fall von Konstantinopel 1453 gilt allgemein als einer der großen historischen Wendepunkte, aber Mitte des 15. Jahrhunderts war das Byzantinische Reich durch innere Konflikte derart geschwächt und wirkten die Osmanen umgekehrt dermaßen unbesiegbar, dass die Eroberung praktisch unvermeidlich war, ob sie nun 1453 stattfand, zehn Jahre früher oder zehn Jahre später. Dennoch kann das Jahr 1453 mit Recht als Wendepunkt betrachtet werden, einfach, weil die Ereignisse damals tatsächlich einen neuen Lauf nahmen. Dieselbe Argumentation lässt sich auf andere große Wendepunkte der Geschichte anwenden, sei es die Schlacht von Gettysburg, Caesars Überquerung des Rubikon, die Unterzeichnung der Magna Carta oder Luthers Anschlag der 95 Thesen an der Tür der Wittenberger Schlosskirche. Und dieselbe Argumentation lässt sich auch auf den Brand des Jahres 64 n. Chr. anwenden.
Die Auswirkungen des Großen Brandes erwiesen sich als in verhängnisvollem Ausmaß zerstörerisch, und zwar nicht nur für die unglücklichen Römer, die von den Flammen eingeholt wurden, sondern letztendlich auch für Nero selbst. Bis dahin hatte er einen sagenhaft guten Ruf genossen, hatte die Dinge zu Hause wie in den Provinzen im Griff gehabt, und das mit so großem Erfolg, dass die Leute bereit waren, darüber hinwegzusehen, dass er gelegentlich über die Stränge schlug. Doch die Gerüchte über Neros Verhalten während des Brandes, die Unfähigkeit der unter seiner Verantwortung operierenden Brandbekämpfungsdienste, die Katastrophe zu einem schnellen Ende zu bringen, und dazu noch ein dem Anschein nach kaltschnäuziges Projekt, auf Grundstücken, die das Feuer ihrer schönen alten Immobilien beraubt hatte, einen riesigen Palastkomplex zu errichten, führten zu einem massiven Vertrauensverlust und erzeugten eine irreparable Kluft zwischen dem Kaiser und Roms mächtiger Elite. Angeblich versuchte Nero, den schon vorher unbeliebten Christen die Schuld in die Schuhe zu schieben, und unterzog sie grausamen Strafen. Falls es wirklich dazu kam, half es ihm nicht. Neros verlängerte Flitterwochen waren ein für alle Mal vorbei: Seit 64 n. Chr. war seine Herrschaft von Argwohn und Verschwörungen überschattet, die sich am Ende zu einer offenen Rebellion auswuchsen und zum Tod des Kaisers unter ausgesprochen erbärmlichen Umständen führte.
Und weil Neros eigenes Ende auch das Ende der julisch-claudischen Herrscherdynastie bedeutete, zu der er gehört hatte, stand der Brand für die erste Stufe eines Prozesses, der das Auswahlverfahren der Herrscher Roms verändern sollte. Fortan stammten sie nicht mehr aus dem Geschlecht des ersten Kaisers Augustus, jenem roten Faden des Konsenses und der Stabilität in dieser Zeit. Kaum vier Jahre nach dem Brand, 68 n. Chr., wurde die Führungsposition im Römischen Reich für ein Bieterverfahren zwischen Konkurrenten geöffnet, und dieses Phänomen bestand als stark destabilisierender Faktor mit Unterbrechungen fort, solange dieses Reich existierte. Natürlich steht außer Frage, dass Nero, selbst wenn er seine mächtigen Kollegen nicht wegen des Brandes verärgert hätte, zweifellos andere Möglichkeiten gefunden hätte, sie gegen sich aufzubringen, und dass er angesichts seiner offenkundigen Fehler beinahe garantiert irgendwann ein schlimmes Ende gefunden hätte; ebenso wahr ist, dass die julisch-claudische Dynastie, wäre sie nicht mit Nero zu Ende gegangen, eines Tages auf jeden Fall zu Ende gegangen wäre, wie es im Lauf der Geschichte allen Herrscherdynastien widerfuhr, ob Habsburgern, Welfen oder Hohenzollern. Neros vorzeitiger Tod und das Ende der Julio-Claudier mögen beide unvermeidlich gewesen sein, als es aber dazu kam, geschah es als Folge der Auswirkungen des Großen Brandes. Ihre letztendliche historische Unvermeidlichkeit nimmt dem Ereignis nichts von seinem Charakter als Wendepunkt.
Es gab noch andere wichtige Entwicklungen, die sich zu Recht mit dem Großen Brand verknüpfen lassen. Das hinterher von Nero angestoßene Bauprogramm, für das sein Goldenes Haus (die Domus Aurea) steht, wies eine Anzahl revolutionärer technischer Neuerungen in der Architektur auf. Es konnte mit der ersten in Rom gebauten Kuppel aufwarten, und der ideenreiche Einsatz von Zement beim Gewölbebau war außerordentlich innovativ. Und auch eine äußerst negative ökonomische Folge der Katastrophe gab es. Roms Silbermünze – der Denar, der Dreh- und Angelpunkt aller Handelsgeschäfte – wurde 64 n. Chr. zum ersten Mal stark abgewertet, mit ziemlicher Sicherheit als Folge der Finanzkrise nach dem Brand. Das führte zu einer Reihe späterer, immer stärkerer Abwertungen bis ins 3. Jahrhundert, als die „Silber“währung faktisch so gut wie gar kein Silber mehr enthielt. Zweifelsohne hatte diese Form der Geldentwertung große Auswirkungen auf die römische Wirtschaft. Auch ohne den Brand wäre irgendein anderer Herrscher wohl irgendwann der fast unwiderstehlichen Versuchung erlegen, durch Herabsetzen des Metallgehalts die Geldmenge zu erhöhen. Doch Tatsache bleibt, dass die Münzverschlechterung genau im Jahr 64 geschah und alle etwaigen Folgen auf dieses Jahr zurückgingen.
Noch ein anderer Aspekt der Ereignisse des Jahres 64 n. Chr sichert dem Brand von Rom einen besonderen Platz in der Reihe „Großer Brände“. Jeder „große“ Stadtbrand ist einmalig. So wie es keine zwei identischen Städte gibt, können auch jene Brände niemals identisch sein, die diese Städte mit verlässlicher und bedrückender Regelmäßigkeit verwüsten. Davon abgesehen gleichen sich große und auch kleinere Brände immer in gewisser Weise. Das gilt überall – in Chicago, London und sogar im finnischen Oulu (das zwischen 1652 und 1916 gleich acht große Brände aufweisen kann). Aber der Brand, der im Juli 64 n. Chr. weite Teile Roms verheerte, scheint sich von jedem anderen „großen“ Brand der Geschichte insofern zu unterscheiden, als er so eng mit einer einzelnen Person verbunden ist. Und dieser Einzelne, Kaiser Nero, gilt zu Recht oder Unrecht weithin als Inbegriff des launenhaften Tyrannen. Die Ereignisse des Großen Brandes von Rom und das angeblich unerhörte Verhalten Neros vor, während und nach dem Feuer sind auf eine Weise untrennbar miteinander verflochten, die einfach bei keinem anderen Großen Brand anzutreffen ist. Und weil der Brand so eng mit Nero verbunden ist, müssen wir ihn zum Verständnis seiner Ursachen, seines Verlaufs und der Folgen nicht nur in den Kontext früherer und späterer Brände einordnen (wie das etwa bei einer Studie des Brandes von London oder von Chicago der Fall wäre), sondern ihn außerdem als eines der bedeutenden politischen Ereignisse seiner Zeit begreifen.
Dementsprechend liegt der Schwerpunkt im ersten Kapitel weniger auf dem Brand selbst als auf dem historischen Hintergrund der Regierungszeit Neros, darauf, welche Quellen zu ihm verfügbar sind, welchen Einfluss die Katastrophe auf seine Herrschaft hatte und wie die Stadt beschaffen war, die das Feuer derart verwüstete. Die in diesem Kapitel gebotenen Informationen sind ausdrücklich für Nicht-Fachleute gedacht und können problemlos von denen überschlagen werden, die einige Kenntnisse der frühen römischen Kaiserzeit mitbringen. Das nächste Kapitel (II) ordnet den Großbrand von 64 n. Chr. in die uns bekannten Aufzeichnungen zu Bränden in Rom ein und untersucht die Maßnahmen, welche die Römer zu ihrer Bewältigung ergriffen. Es folgt eine Rekonstruktion des Brandgeschehens (III), anschließend ein Kapitel über die Stichhaltigkeit der Vorwürfe gegen Nero als Hauptverdächtigen (IV). Anschließend behandeln zwei Kapitel die unmittelbaren Auswirkungen – eines beschäftigt sich mit der Frage, wie die Christen als willkommene Sündenböcke ins Visier genommen wurden (V), in dem anderen geht es um den architektonischen Wandel der verwüsteten Stadt (VI). Das letzte lange Kapitel beurteilt den Stellenwert des Brandes für den weiteren Verlauf der römischen Geschichte (VII). Ein kurzer Epilog gilt Nero und dem Großen Brand als Kulturphänomene, die sich von ihrer eigenen Zeit bis in unsere gehalten haben. Den Abschluss bilden Übersetzungen der Berichte über den Brand in den drei wichtigsten antiken Schriftquellen – Tacitus, Sueton und Cassius Dio –, gefolgt von einem Glossar mit Begriffen, die Nichtspezialisten wahrscheinlich nicht vertraut sind.
Jede eingehende Studie des Großen Brandes von Rom stellt insofern ein besonderes Problem dar, als sie nicht nur eine gründliche Untersuchung der antiken erzählenden Quellen und der Forschungsliteratur, das ihr Verständnis vertieft hat, einbeziehen muss, sondern auch, was nicht weniger wichtig ist, die Ergebnisse der bedeutenden archäologischen Forschungen zu berücksichtigen hat, die in jüngerer Zeit neue Belege für den Brand geliefert haben und von Forschern außerhalb der akademischen Gemeinschaft Italiens bis heute gewöhnlich übergangen werden. Hinzu kommen natürlich die generellen Schwierigkeiten eines derartigen Buches, das sich gleichzeitig an ein allgemein interessiertes Publikum und an die Fachwelt richtet. Auf ein und derselben Seite können sich grundlegende, sehr einfache Informationen neben sehr komplexen und, wie manche denken mögen, weit hergeholten Gedankengängen finden. Die Karte auf S. 6 zeigt die meisten wichtigen Bauten, von denen im Text die Rede ist. Die genaue Lage einiger dieser Bauten ist sehr umstritten, daher soll die Karte lediglich als grobe Handreichung dienen, ohne Anspruch auf topographische Exaktheit zu erheben. Besonders ärgerlich für eine Studie dieser Art sind die von Land zu Land unterschiedlichen Maßeinheiten. In archäologischen Fragen bin ich im Allgemeinen der üblichen Konvention gefolgt und habe das metrische System verwendet. Wo ich jedoch ältere Archäologen zitiere, die Überschlagsrechnungen ohne Anspruch auf Genauigkeit vornehmen, oder antike Quellen anführe, die Maße in römischen Fuß oder Meilen angeben, wäre eine Umrechnung ihrer Zahlen grotesk gewesen. Daher habe ich stellenweise die originalen britischen oder römischen Maßeinheiten übernommen. Zu dieser Inkonsequenz sehe ich leider keine praktikable Alternative.