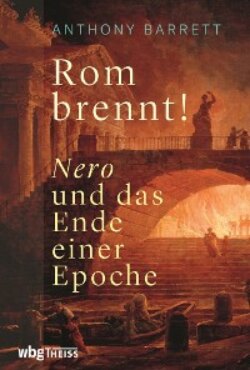Читать книгу Rom brennt! - Anthony Barrett - Страница 11
Die Bevölkerung des antiken Rom
ОглавлениеAuch inmitten der manchmal abstrakten Forschungskontroversen, zu denen der Große Brand und seine Folgen geführt haben, sollte man sich stets daran erinnern, dass es sich in erster Linie um eine menschliche Tragödie handelte. Es muss uns sehr nachdenklich stimmen, dass wir außerstande sind, auch nur eine der Personen beim Namen zu nennen, die während dieser Katastrophe ums Leben kamen. Ebenso wenig haben wir am anderen Ende der Skala eine klare Vorstellung von der Gesamtzahl an Todesopfern. Ein grobes Gespür für das Ausmaß des Unglücks kann uns Tacitus’ Behauptung vermitteln, dass es der schlimmste römische Brand aller Zeiten gewesen sei, sowie Dios allgemeine Bemerkung, es sei die schwerste Katastrophe gewesen, die Rom bis zum 3. Jahrhundert, Dios eigener Zeit, getroffen habe, ausgenommen nur die Gallierinvasion.22 Aber es ist unmöglich, die Zahl der Toten auch nur annähernd tatsächlich zu beziffern.
Das größte Problem dabei ist, dass wir die Einwohnerzahl Roms zur Zeit Neros nicht kennen – eine Frage, die nicht weniger umstritten ist wie die oben erwähnten großen Probleme der Topographie. Pionierarbeit in diesem Bereich leistete der gelehrte deutsche Einzelgänger Karl Julius Beloch vor mehr als 130 Jahren mit seiner großen demographischen Studie. Sie war der erste Versuch, antike Bevölkerungszahlen mit einigermaßen wissenschaftlichen Methoden zu messen, und noch heute nimmt fast jede diesbezügliche Diskussion von dieser Studie ihren Ausgang.23 Die Debatte über Roms Stadtbevölkerung wird üblicherweise im Zusammenhang mit dem Streit über die Gesamtbevölkerung Italiens geführt. Für sie liegen uns einige Daten in Form von Zensusergebnissen vor, die während der regelmäßigen Zählungen der römischen Bürgerschaft zusammengestellt wurden und gelegentlich in den erzählenden Quellen erhalten sind. Die jüngsten verfügbaren Zahlen für einen voraugusteischen Zensus beziehen sich auf das Jahr 70/69 v. Chr. und nennen 900 000 Bürger.24 Anschließend liefert Augustus in dem Bericht über seine Lebensleistungen, den Res gestae, Zahlen für drei Zählungen unter seiner Verantwortung.25 Für 28 v. Chr. hält er fest, dass 4 063 000 Römer in die Bürgerliste eingetragen worden seien. Zwanzig Jahre später, im Zensus von 8 v. Chr., betrug die Gesamtzahl 4 233 000. Im dritten und letzten Zensus, den Augustus für sein letztes Lebensjahr 14 n. Chr. aufführt, zählte man 4 937 000 römische Bürger.
Die Veränderung zwischen den Jahren 28 und 8 v. Chr. stimmt insgesamt mit dem überein, was man erwarten würde. Der Unterschied zwischen 8 v. Chr. und 14 n. Chr. jedoch ist überraschend. Wirklich verblüffend jedoch ist der Abstand zwischen den Zahlen des de facto letzten republikanischen Zensus, für den wir Daten besitzen, im Jahr 70/69 v. Chr. und der ersten Zählung unter Augustus 28 v. Chr. Die Zahl römischer Bürger scheint sich schlagartig mehr als vervierfacht zu haben. Wie lässt sich dieser Sprung interpretieren? Man hat verschiedene Erklärungen bemüht. Eine führt die zu geringe Erfassungsdichte in republikanischer Zeit an. Außerdem gilt es, die Ausdehnung des Bürgerrechts auf das Galliergebiet nördlich des Po (die Gallia Transpadana) mit in Betracht zu ziehen. Eine Theorie besagt, dass die republikanischen Zahlen nur jene Bürger erfassten, die im richtigen Alter waren, um in die römischen Legionen eingezogen zu werden. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Augustus, anders als seine republikanischen Vorgänger, Frauen und Kinder mit in die Gesamtzahlen einschloss. Zu all diesen Fragen existiert kein breiter Konsens.
Ohnehin erfassen diese Zahlen nur Bürger, die das römische Bürgerrecht besaßen und von denen die meisten Rom wahrscheinlich nie betreten haben.26 Für die Einwohner der Stadt selbst verfügen wir über annähernd ähnliche Zahlenkategorien, die uns vor vergleichbare Probleme stellen. Augustus liefert uns Informationen zu seinen Congiarien, Geldgeschenken und Lebensmittelverteilungen an die römische Stadtbevölkerung. Er prahlt, bis 12 v. Chr. hätten nicht weniger als 250 000 Menschen seine Spenden empfangen. Außerdem schreibt er, bei seinem Congiarium 5 v. Chr. sei diese Zahl auf 320 000 gewachsen. Im Jahr 2 v. Chr. schenkte er allen Geld, die auf den Listen für die staatliche Getreideverteilung standen, und bei dieser Gelegenheit beliefen sich die Empfänger auf knapp über 200 000, eine Zahl, die Dio bestätigt.27 Die Schwankungen zwischen diesen drei Zahlen sind verwirrend. Noch schwerer wiegt jedoch, dass wir auch diesmal nicht wissen, wen sie erfassen – wahrscheinlich, aber nicht sicher, nur die männlichen Haushaltsvorstände. Aber wenn das stimmt, wie viele Ehefrauen, Kinder und nicht zuletzt Sklaven müssen wir dann hinzufügen, um auf die Gesamteinwohnerzahl zu kommen? Und sind in Augustus’ Zahlen auch Menschen enthalten, die außerhalb der offiziellen Stadtgrenze lebten, aber mühelos nach Rom kommen konnten? Beloch behauptete, auch Menschen, die 20 oder 30 römische Meilen weit weg lebten, also auch die Einwohner von Ostia, hätten an der staatlichen Getreideverteilung teilnehmen können.28 Zu dieser ohnehin schon komplizierten Situation kommt noch die mögliche Bevölkerungsentwicklung in den 50 Jahren zwischen Augustus und dem Brand unter Nero hinzu.
Offensichtlich sind die Daten zu Zensuszahlen und Congiarien weniger hilfreich, als man hätte hoffen können. Man hat daher noch auf andere Methoden zurückgegriffen. So wurden auf der Grundlage der Getreideversorgung Berechnungen angestellt, aber unterschiedliche Forscher haben unterschiedliche Schlüsse aus ihnen gezogen.29 Ein weiterer Ansatz bestand in dem Versuch, die Bevölkerung aus der Fläche der antiken Stadt zu extrapolieren, nicht ganz 14 km2, aber auch er hat keinen größeren Konsens herbeigeführt.30 Ganz grob könnte man – ohne damit jüngeren Überlegungen in der Forschung zu viel Gewalt anzutun – spekulieren, dass die Gesamtbevölkerung Roms zur Zeit Neros irgendwo zwischen 500 000 und einer Million Menschen lag … doch die Betonung liegt hier auf dem Wort „spekulieren“.31 Und zu allem Überfluss können wir unmöglich wissen, wie hoch der Anteil der Bevölkerung war, der bei dem Brand ums Leben kam. Zwar berichten die antiken Autoren über die furchtbaren Erlebnisse in seinem Verlauf. Aber trotz der aufwühlenden Beschreibungen qualvollen Sterbens sind dieselben Autoren alles andere als auskunftsfreudig, was auch nur die ungefähre Größenordnung der Gesamtzahl der Opfer angeht – ein möglicher Hinweis darauf, dass die Zahl, relativ gesehen, nicht ganz so hoch war, wie die Autoren anzudeuten scheinen.32 Aber auch das ist kaum mehr als Spekulation. Kurz gesagt, wir müssen uns widerstrebend damit abfinden, dass wir keine begründete Vorstellung von der Opferzahl des Großen Brandes von 64 n. Chr. haben.
Das heutige Rom, eine Stadt von mehr als vier Millionen Einwohnern, steht, oberflächlich betrachtet, dieser großen Tragödie gleichgültig gegenüber. Die vertraute Stadtansicht weist keine Narbe jenes Infernos auf, das vor so langer Zeit so furchtbare Verwüstungen anrichtete. Doch es ist ein ernüchternder Gedanke, dass unter dieser Oberfläche, sogar an Stellen, die viele Meter unter den vollen, lauten, vor Leben und Geschäftigkeit pulsierenden Straßen von heute liegen, Spuren der antiken Katastrophe den Lauf der Jahrhunderte überdauert haben, friedlich eingehüllt in dicke Schichten aus angesammeltem Schutt. Diese vergrabenen Ablagerungen aus Asche, Keramikscherben, verarbeitetem Metall und zwangsläufig auch verkohlten Fragmenten von Menschenknochen haben fast zweitausend Jahre lang unter den geschäftigen Straßen ein tiefes Schweigen bewahrt, erstarrt in einer ewigen Totenwache unter der berühmten Ewigen Stadt.