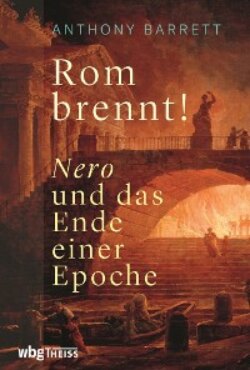Читать книгу Rom brennt! - Anthony Barrett - Страница 9
Die erzählenden Quellen
ОглавлениеFür welche historische Epoche wir uns bei unseren Forschungen auch entscheiden, stets sind wir auf Gedeih und Verderb von den verfügbaren Quellen abhängig. Die Alte Geschichte hält hier ihre eigenen besonderen Probleme bereit. Selbst dort, wo die Quellenlage relativ üppig ist – und über die Julio-Claudier sind wir viel besser informiert als beispielsweise über das Frühmittelalter –, kann die Qualität des Materials noch sehr zu wünschen übriglassen. Daher scheint eine knappe Einführung in dieses Thema angebracht, da es mit Nero und dem Großen Brand zu tun hat. Dieser kurze Abschnitt ist alles andere als vollständig und beabsichtigt gar nicht erst, alle antiken Quellen anzusprechen, die in diesem Buch vorkommen. Bei vielen von ihnen sind nur Einzelheiten wichtig, und dort, wo es relevant erscheint, werden an der entsprechenden Stelle einige Hintergrundinformationen gegeben. Hier soll der Schwerpunkt auf den drei wichtigsten erzählenden Quellen zum neronischen Brand liegen, deren Berichte gegen Ende des Buches abgedruckt sind.
Keiner unserer drei wichtigsten Gewährsmänner zu dem Brand – Tacitus (ca. 55–ca. 120er-Jahre n. Chr.), Sueton (ca. 70–ca. 130er-Jahre n. Chr.) und Cassius Dio (ca. 165–ca. 235 n. Chr.) – war zu der Zeit, als er schrieb, Neros Zeitgenosse. Sie alle stützten sich auf ältere Schriften. Diese sind heute fast vollständig verloren, und selbst die Identität ihrer Verfasser ist sehr schwer zu ermitteln. Eine noch erhaltene Quelle gibt es jedoch, die sowohl Sueton als auch Tacitus hauptsächlich zitieren: den erstaunlichen älteren Plinius (23/24–79 n. Chr.), ein Universalgelehrter, dessen Forscherbegeisterung ihn beim Ausbruch des Vesuvs in den Tod führte. Das große enzyklopädische Werk Plinius’ des Älteren, die Naturalis historia, erschien 77 n. Chr. in 37 Buchrollen und ist erhalten geblieben. Sie ist eine Fundgrube faszinierender Informationen zu fast jedem Teilbereich der antiken Welt, einschließlich der Herrschaftszeit Neros. Über das gesamte Werk verstreut finden sich Verweise auf den Kaiser. Der Tonfall dieses Materials ist unverhohlen negativ, wobei der Akzent auf Neros Extravaganz und eigenwilliger Exzentrizität liegt. Zu dem Brand und Neros potenzieller Schuld gibt Plinius keinen einzigen spezifischen und potenziell wichtigen Kommentar ab, doch ist der Informationsgehalt der Quelle durch ein Problem der handschriftlichen Überlieferung stark beeinträchtigt (siehe Kapitel III). Außerdem verfasste Plinius ein konventionelleres Geschichtswerk in 31 Büchern, die Historiae.4 Leider ist es heute verloren, aber Tacitus hat die Historiae noch benutzt und zitiert daraus für Informationen über die große Verschwörung, die auf den Brand folgte.5
Publius (?) Cornelius Tacitus gilt weithin als der herausragende Historiker für die julio-claudische Zeit. Unter der Dynastie der Flavier, die ihr folgte, machte er eine erfolgreiche Politikerkarriere, die er mit einer Reihe wichtiger Geschichtswerke abrundete. Vor 110 hatte er bereits seine Historien geschrieben, die den Aufstieg der Flavier zur Macht und ihre verschiedenen Herrschaftszeiten abdeckten; von diesem Werk sind nur die ersten vier Bücher und der Anfang des fünften erhalten geblieben. Anschließend wandte er sich einer früheren Epoche zu und legte sein letztes, sein Meisterwerk vor, die Annalen, die sich mit den Jahren vom Herrschaftsantritt des Tiberius 14 n. Chr. bis zu Neros Tod im Jahr 68 befassen. Wann er damit begann, wissen wir nicht, aber 116 war er noch an der Arbeit.6 Anscheinend bestanden die Annalen aus 18 Büchern, doch einige davon fehlen; die wichtigsten Lücken betreffen die gesamte Zeit Caligulas und den Anfang der Herrschaft des Claudius sowie die letzten beiden Jahre Neros.
Unter dem Prinzipat scheint es Tacitus prächtig gegangen zu sein, sogar unter dem verhassten Domitian, wie er selbst im Vorwort zu den Historien einräumt. Dennoch kann an seiner hasserfüllten Feindschaft gegenüber dem Kaisertum, die in den Annalen durchbricht, kein Zweifel bestehen. Natürlich konnte er die Verdienste einzelner vernünftiger Herrscher wie Trajan anerkennen, das System selbst jedoch fand er zutiefst schädlich. Daher müssen wir Tacitus’ berühmter Äußerung zu Beginn der Annalen mit Skepsis begegnen, er könne „ohne bösen Willen oder Voreingenommenheit“ (sine ira et studio) schreiben, ein Echo seiner früheren Behauptung in den Historien, er arbeite „ohne Sympathie und ohne Voreingenommenheit“ (neque amore … et sine studio).7 Sicher hat Tacitus nicht die Angewohnheit, Tatsachen gezielt falsch darzustellen. Doch hinter der Schilderung schlichter Tatsachen lauern seine persönlichen Vorurteile. Die Motive, die er Personen zuschreibt, und sein offenes Ohr für Gerüchte und „angeblich“ allgemeine Überzeugungen hinterlassen beim Leser ihre Spuren. Allerdings verleitet seine Voreingenommenheit ihn dennoch nicht dazu, die Gerüchte für bare Münze zu nehmen, und bei jenen seltenen Gelegenheiten, wo er seine Quellen namentlich zitiert, kann er sie durchaus kritisieren.
Tacitus’ Beschreibung des Brandes ist ein ausgezeichnetes Beispiel für sein großes Erzähltalent. Als ernsthafter Historiker äußert er gebührende Skepsis, was Neros Schuld angeht, und zwar als einziger der drei wichtigsten Autoren; die Quellen seien, wie er festhält, in dieser Frage geteilter Meinung. Doch seine Feindseligkeit gegenüber dem Kaiser ist so groß, dass der Leser am Ende seiner Schilderung den schwer zu beschreibenden, aber dennoch seltsam zwingenden Eindruck hat, Neros Verhalten sei auf irgendeine Art so abscheulich gewesen, dass man ihn für das, was geschah, trotzdem verantwortlich machen müsse. Das ist eine bemerkenswerte schriftstellerische Leistung (siehe Kapitel IV).
Obwohl Tacitus’ Bericht über das Feuer weit detailreicher ist als der von Sueton und Cassius Dio, liefert er relativ wenige Detailinformationen darüber, welche Gebäude konkret zerstört oder beschädigt wurden. Immerhin vermerkt er die Zerstörung des Circus Maximus und von Neros Residenz auf dem Palatin, den Brandausbruch auf dem Grundstück des Tigellinus in den Aemiliana und den Verlust von fünf namentlich genannten religiösen Bauten beträchtlichen Alters – des Tempels der Luna, des Herculesaltars, des Tempels des Jupiter Stator, der Regia und des Vestatempels.8 Doch auf jeden Fall hatte er Zugang zu weitaus mehr potenziellen Informationen, da er die Berichte jener älteren Einwohner der Stadt kannte, die dort zur Zeit des Brandes gelebt hatten.9 Leider scheint er sich entschlossen zu haben, sie, wenn überhaupt, nur relativ sparsam zu nutzen.
Gaius Suetonius Tranquillus kam um das Jahr 70 n. Chr. zur Welt, vielleicht in Nordafrika. Als Mitglied des römischen Ritterstandes wurde er unter den Kaisern Trajan und Hadrian auf eine Reihe von Verwaltungsposten berufen. Er schrieb zahlreiche Werke zu einem breiten Themenspektrum, unter denen das bekannteste seine Viten der zwölf Caesaren sind.
Sueton ist Biograph, kein Historiker. Sein Material ordnet er beinahe durchweg eher thematisch als in chronologischer Reihenfolge an und scheint einfach vorauszusetzen, dass seine Leserschaft mit den Grundzügen des Themas vertraut ist. Selten interessieren ihn große politische Fragen, es sei denn, sie beleuchten den Charakter seiner Hauptperson, auf die er sich vollständig konzentriert. Insgesamt treibt ihn nicht jene tiefsitzende Feindseligkeit, die Tacitus bewegt zu haben scheint. Suetons Hauptschwäche besteht nicht in ira et studium, vielmehr nimmt er im Fall Neros (und anderer Kaiser) Einzelheiten auf, die, wie er sagt, nicht auf Kritik stoßen (nulla reprehensione).10 Schwerer wiegt da schon, dass er bereit ist, all den unbelegten Geschichten Glauben zu schenken, die in der Tradition überliefert sind. Eigentlich war Sueton zu seriöser Forschung durchaus imstande; er nutzt häufig Akten und Archivmaterial und kann gegenüber den erzählenden Quellen sehr skeptisch sein. Doch bei all dieser vorbildlichen Skepsis schreckt er nicht davor zurück, den leichtfertigen Tratsch aus eben diesen Quellen nachzuerzählen, und saftigen Anekdoten kann er nicht widerstehen, sondern überlässt es munter dem Leser, sich ein Urteil zu bilden – was heutige Historiker für ihre eigene Aufgabe halten würden. Außerdem nimmt er gern isolierte Einzelfälle und Details und stellt sie dann so dar, als spiegelte sich in ihnen das ständige und konsequente Verhalten seiner Hauptpersonen.
Nirgendwo im Nero nennt Sueton ausdrücklich seine Quellen. Wir können nicht sagen, ob er Tacitus benutzte und ob die Nero-Kapitel der Annalen überhaupt schon zugänglich waren, als Sueton seinen Nero schrieb; die Beziehung zwischen beiden Werken ist überaus umstritten. Außerdem ist Suetons Schilderung des Brandes hochgradig tendenziös. Sein Hauptziel ist es, das Ereignis auszuschlachten, um Neros Grausamkeit und Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid der Römer hervorzuheben. Er versucht gar nicht erst, einen vielschichtigen oder investigativen Bericht über die Katastrophe oder deren Ursachen vorzulegen. Daher können wir Suetons Nero nur mit äußerster Vorsicht benutzen, wenn wir Rückschlüsse ziehen wollen, wen die Schuld an den Ereignissen trifft.
Unsere dritte wichtige erzählende Quelle ist Cassius Dio Cocceianus, ein Senator aus Nikaia (heute Iznik) in Kleinasien. Seine Römische Geschichte (Rhōmaikē histōría), die über mehr als zwanzig Jahre in griechischer Sprache entstand, scheint mit den ersten Königen Roms begonnen und in der Herrschaftszeit von Severus Alexander (222–235 n. Chr.) geendet zu haben. Insgesamt gilt Dio nicht als besonders analytisch vorgehender Historiker.11 In seinem Gesamtwerk zitiert er nur sehr selten ältere Autoren (die einzigen als Informationsquellen eigens genannten Personen sind Augustus und Hadrian), obwohl seine eingestreuten Bemerkungen zu Schriftstellern wie Livius nahelegen, dass er sie wohl zurate zog. Daher überrascht es nicht, dass er in den Abschnitten seines Berichts über den Brand, die noch erhalten sind, keine einzige seiner Quellen nennt. Dabei muss man allerdings beachten, dass uns für die Zeit Neros (wie auch für andere Teile der Römischen Geschichte) Dios Originaltext fehlt und wir uns auf Auszüge verlassen müssen, die in byzantinischer Zeit angefertigt wurden. Da diese Auszüge aber eher eine Auswahl als eine Zusammenfassung bieten, besteht das Risiko, dass wichtige Themen, die Dio ursprünglich behandelte, heute vollständig ausgelassen sind.
Der Hauptwert Dios besteht, allgemein gesprochen, darin, dass sein Erzählstil zwar vielfach überaus biographisch und in mancher Hinsicht beinahe eine Mischung aus Sueton und Tacitus ist, dass Dio jedoch genau wie Tacitus sein Material annalistisch behandelt und es grob nach den Jahren ordnet, in denen die jeweiligen Ereignisse eintraten.12 Folglich verknüpft er die Ereignisse der letzten beiden Herrschaftsjahre Neros, die Teil der Schlüsselperiode nach dem Brand sind. Das ist deshalb besonders hilfreich, weil diese Jahre in Tacitus’ Annalen fehlen, die in der Mitte des Jahres 66 abbrechen. Aber weil er möglicherweise in gewissem Sinne Biograph und Annalist ist, hat Dio eine ebenso große Schwäche für Tratsch und Verleumdung wie Sueton und bemüht sich ebenso wenig wie dieser, zwischen dem Plausiblen und dem Lächerlichen zu unterscheiden. Zudem sieht er die Welt sehr stark aus der Perspektive eines Senators. Daher überrascht es nicht, dass er in seinem Bericht über den Brand – wie auch bei anderen Episoden aus dieser Zeit – äußerst feindselig gegenüber Nero ist.
Dios Beschreibung des Brandes enthält Einzelheiten, die sich auch bei Sueton und Tacitus finden, etwa Neros dichterischer Auftritt vor der Kulisse der brennenden Stadt. Diese Information geht eindeutig auf einen gemeinsamen Ursprung zurück, doch gibt es Unterschiede in den Details, und wahrscheinlich nutzte jeder der drei Autoren unabhängig von den anderen einen gemeinsamen Quellenbestand sowie zusätzliche Quellen, die von den beiden anderen nicht verwendet wurden.
Natürlich sind die literarischen Zeugnisse nicht unsere einzige Informationsquelle zur Vergangenheit. Hinzu kommen die Befunde der Archäologie. Allerdings müssen wir gleich zu Beginn eine Warnung aussprechen. Einem recht gefährlichen Glaubenssatz zufolge gilt das, was in der archäologischen Überlieferung erhalten ist, ipso facto als zuverlässiger denn Informationen aus literarischen Quellen. Diesen verbreiteten Trugschluss müssen wir vermeiden – denn ganz so einfach liegen die Dinge in Wirklichkeit nicht. Mag das physische Quellenmaterial an sich auch unmanipuliert sein, so ist es für sich allein doch praktisch nie so aussagekräftig wie seine literarischen Pendants, und unser Verständnis dieses Materials hängt stark davon ab, wie der Archäologe es interpretiert und uns präsentiert. Und da die Archäologie sehr oft die angeordnete Zerstörung der zu untersuchenden Fundstelle mit sich bringt und das Inventar des Fundorts sehr oft nicht in ein Magazin eingelagert wird, werden in der Praxis die Informationen, zu denen wir Zugang haben, durch die Interpretationen der Forschenden gefiltert. Im Fall des Großen Brandes haben wir das Glück, dass die Hauptmasse der archäologischen Belege für dieses Ereignis durch ein hochprofessionelles Team unter der Leitung von Clementina Panella von der Universität La Sapienza in Rom zutage gefördert und unter Einhaltung hoher Wissenschaftsstandards publiziert worden ist. Aber andere Ausgräber halten sich nicht unbedingt an solche Standards, und anderswo müssen wir vor Schlussfolgerungen auf der Hut sein, die hochspekulativ und mitunter von beinahe dichterischer Phantasie beflügelt sind. Gelegentlich können die persönlichen Vorlieben und Abneigungen des Archäologen das vermeintlich objektive Beweismaterial prägen.
Abgesehen von diesen generellen Vorbehalten wirft der Große Brand von 64 n. Chr. zwei sehr spezielle archäologische Probleme auf. Oft kann ein verheerendes Feuer deutliche Spuren seines Wütens hinterlassen. Ein anschauliches Beispiel dafür ist die Stadt Verulamium (St. Albans) im römischen Britannien, die im Boudicca-Aufstand nur wenige Jahre vor dem Großen Brand zerstört wurde. Zu den frühen Schuttschichten in Verulamium zählt eine markante Brandschicht, die sich vertrauensvoll den Folgen des Aufstands zuschreiben lässt.13 Leider sucht man für den Großen Brand des Jahres 64 n. Chr. vergebens nach derart erdrückenden und klaren archäologischen Belegen. Rom blickt auf eine lange und verwickelte Geschichte zurück, in welcher die Stadt eine Reihe verheerender Brände erlebte, einer davon nur 16 Jahre nach dem Großen Brand. Brandschichten irgendeinem konkreten Ereignis zuzuordnen, kann in manchen Fällen riskant sein. Zusätzlich steht der heutige Forscher vor einem zweiten Problem, das durch ein besonders fortschrittliches Projekt Neros entstanden ist. Zu den Maßnahmen, die er nach dem Brand veranlasste, zählten das Abräumen des zerstörten Materials und die anschließende Rückgabe der vom Schutt befreiten Grundstücke an ihre Besitzer. Schiffe transportierten Getreide den Tiber aufwärts, um die Mittellosen zu versorgen. Nach dem Entladen war es Pflicht, dieselben Schiffe mit Brandschutt zu beladen, der flussabwärts gebracht und dort dem nützlichen Zweck zugeführt werden konnte, die Sümpfe nahe Ostia aufzuschütten.14 Natürlich wird nicht der gesamte Schutt entfernt worden sein, besonders dort nicht, wo er als Aufschüttung für Neros Goldenes Haus dienen konnte, das auf dem vom Feuer verwüsteten Gelände entstand. Aber ein Großteil der archäologischen Befunde wurde mit diesem Vorgehen buchstäblich eimerweise weggeschafft. In gewisser Hinsicht könnte man Neros löbliches Recyclingprogramm negativ sehen – als frühen Fall von archäologischem Vandalismus.