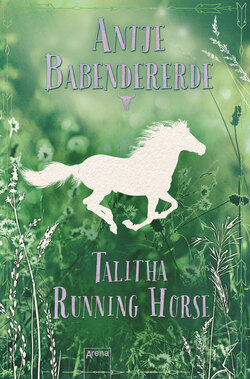Читать книгу Talitha Running Horse - Antje Babendererde - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4. Kapitel
Als ich am darauf folgenden Montagmorgen wie gewohnt an die Haustür der Thunderhawks klopfte, stand plötzlich Neil vor mir, Toms Sohn. Mir rutschte das Herz in die Hose und vor Schreck bekam ich kein Wort heraus. Ich spürte, wie ich ganz langsam rot wurde und nichts dagegen tun konnte.
Neil war ein ganzes Stück größer als ich, und ich musste den Kopf zurücklehnen, um ihm ins Gesicht sehen zu können. Er war sehr schlank, hatte aber kräftige Schultern und Arme. Sein Haar trug er straff nach hinten gekämmt, auf traditionelle Art zu zwei dicken glänzenden Zöpfen geflochten. Er war ein Lakota mit sehr dunkler Haut und ich ahnte, dass sie nicht von der Sonne so dunkel war, sondern deshalb, weil es unter seinen Vorfahren keinen Weißen gegeben hatte. Neils Augen leuchteten genauso schwarz wie die seines Vaters, und er musterte mich von oben bis unten mit einem durchdringenden Blick.
Ich begann zu stottern. »Ich wollte … ist denn … wo …«
»Wenn du zu meinem Vater willst«, unterbrach er mein Gestammel, »der ist nicht da.« Neils Stimme war fast so dunkel wie die von Tom Thunderhawk. Auf seinen Lippen zeigte sich ein spöttisches Lächeln.
Ich sackte in mich zusammen. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Was sollte ich denn jetzt tun? Dad hatte mich unten an der Straße rausgelassen und war gleich nach Manderson weitergefahren. Wie in der vergangenen Woche wollte er in der Mittagszeit kommen, um mich nach Hause zu bringen.
Zu Tante Charlene konnte und wollte ich nicht gehen, denn ich hatte gesehen, dass Marlin zu Hause war. Mir blieb nichts anderes übrig, als die Zeit irgendwie herumzubringen. Leider hatte ich nicht einmal meine Zeichentasche mitgenommen, was ich jetzt sehr bereute.
»Wann kommt Tom denn wieder?«, fragte ich, nachdem ich das Gefühl hatte, wieder einigermaßen normal sprechen zu können.
»Übermorgen«, sagte Neil. »Er ist mit meiner Mutter und den Mädchen zu meinem Großvater gefahren.« Die Mädchen, das waren Bey und April, seine beiden kleinen Schwestern.
»Dann komme ich übermorgen wieder«, sagte ich kurz entschlossen und wandte mich zum Gehen. Nichts wie weg hier, dachte ich.
Aber Neil machte einen großen Schritt auf mich zu und hielt mich am Arm fest. »Nun warte doch mal«, sagte er.
Ich musste ihn so erschrocken angesehen haben, dass er seine Hand zurückzog – als hätte er sich verbrannt. »Dad hat gesagt, ich soll mit dir reiten üben, wenn du kommst.«
Ich schüttelte den Kopf. Das war ein Reflex.
»Du willst nicht?«, fragte er und seine dunklen Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. »Warum denn nicht, wo du schon einmal hier bist?«
Ich brachte kein Wort heraus. Mir fiel nichts ein, was ich hätte erwidern können, kein Argument, das dagegen sprach. Ich wusste, dass Neil ein hervorragender Reiter war und genauso gut mit Pferden umgehen konnte wie sein Vater. Ich hatte gesehen, wie er mit Taté sprach, dem gefleckten Hengst. Und konnte beschwören, dass das Pferd zugehört hatte.
Wie hätte ich ihm sagen sollen, dass ich in seiner Gegenwart plötzlich weiche Knie bekam und nicht einmal laufen konnte, geschweige denn reiten. Mein Herz schlug so wild gegen meine Brust, dass ich fürchtete, er könne es hören oder gar sehen. Ich schämte mich und wünschte, auf der Stelle in ein Mauseloch verschwinden zu können. Aber das war wohl einer dieser Wünsche, die leider nie in Erfüllung gingen.
»Ich bin gleich wieder da«, sagte Neil, der sich von meinem merkwürdigen Benehmen nicht beeindrucken ließ. Er drehte sich um und verschwand im Haus. Dabei sah ich, dass ihm seine Zöpfe bis zu den Hüften reichten.
Ich holte tief Luft und versuchte Kopf, Herz und Beine wieder unter Kontrolle zu bringen. Was war nur los mit mir?
Neil kam zurück, mit Mokassins an den Füßen. Er schloss ab und nickte mir aufmunternd zu. Ich trottete ihm hinterher, als er in die Scheune ging, um Zaumzeug und Zügel zu holen. Mein Blick war fest auf die beiden Zöpfe geheftet, von denen jeder so dick war wie der eine Zopf, der über meine Schultern hing.
Auf dem Weg zu den Pferden versuchte ich mit ihm Schritt zu halten, wortlos, während mein Inneres in vollkommener Aufruhr war. Ich fürchtete nichts mehr, als mich vor Neil Thunderhawk zu blamieren. Bisher war ich mit Psitó gut zurechtgekommen, aber das musste nichts heißen.
Als Neil die Pferde schließlich entdeckte, rief er sie mit lautem »He he« – und sie kamen sofort, als hätte er jedem von ihnen eine saftige Karotte versprochen.
Das Zaumzeug hinter dem Rücken versteckt, begrüßte er Taté, den großen Hengst, der allen Stolz über Bord geworfen zu haben schien und vergnügt an einem von Neils Zöpfen herumknabberte.
»Lass das, Taté«, sagte Neil und strich dem Pferd liebevoll über die schwarz gefleckten Nüstern. Dann redete er beruhigend auf Psitó ein, schob ihr vorsichtig die Trense ins Maul und zog das Zaumzeug über ihren Kopf. Taté stupste ihn eifersüchtig in den Rücken, als er die Zügel an den beiden großen Metallringen befestigte.
»Du bist heute nicht dran.« Neil klopfte den Hals des Hengstes, der ein paar Schritte rückwärts machte. »Morgen wieder, okay?«
Er stellte sich breitbeinig vor den Bauch der Stute, verschränkte seine Hände und sagte zu mir: »Na los, steig auf!«
Ich war gerade dabei, meine Nase in Stormys Fell zu vergraben, und viel zu überrascht, um ernsthaft erschrocken zu sein. »Ohne Sattel?«, fragte ich verblüfft.
»Du willst doch richtig reiten können, oder?«
Obwohl mir klar war, dass Tom Thunderhawk seinem Sohn bestimmt nicht aufgetragen hatte, mich ohne Sattel reiten zu lassen, wollte ich nicht als Feigling dastehen. Ein unangenehmes Kribbeln in meinem Nacken machte sich bemerkbar, wie immer wenn ich Angst hatte. Aber ich war auch neugierig.
»Nun mach schon«, sagte Neil ungeduldig. »Dir passiert nichts. Ich habe gesehen, dass du es kannst.«
Die Muskeln an Neils Oberarmen spannten sich, als ich in seine Hände stieg und er mein Gewicht tragen musste. Ich fasste nach Psitós Widerrist, griff in die Mähne und schwang mich auf ihren Rücken. Neil trat einen Schritt zurück, rieb sich den Staub von den Händen und guckte, ob ich auch richtig saß.
»Sitzt du bequem?«, fragte er.
Ich nickte. Es war ein vollkommen neues, ungewohntes Gefühl, die Muskelbewegungen des Pferdes so direkt zu spüren, obwohl Psitó scheinbar völlig ruhig stand. Es war ein gutes Gefühl.
Neil kam wieder heran und sagte: »Hinter dem Schulterblatt der Stute spürst du eine Vertiefung, in die deine Beine passen. Genau hier.« Er legte mein linkes Bein dorthin, und noch ehe ich darüber nachdenken konnte, wie es nun weitergehen sollte, hatte Neil in Psitós Mähne gegriffen, sich mit den Füßen vom Boden abgestoßen und saß mit einem Schwung hinter mir. Ich stieß einen überraschten Laut aus, denn das kam völlig unerwartet. Er fasste um mich herum nach den Zügeln und schnalzte mit der Zunge. Ich spürte, wie er die Schenkel zusammendrückte. Die Stute setzte sich in Bewegung.
Ich war unglaublich erleichtert, dass Neil mein Gesicht nicht sehen konnte, denn ich wusste, dass sich dort all meine Empfindungen widerspiegelten: Der Schreck darüber, dass Neil Thunderhawks Körper so dicht an meinem war, dass ich seine Bewegungen genau so spürte wie die der Stute. Die Tatsache, dass ich ohne Sattel auf dem Pferde saß und mich nur an seiner schwarzen Mähne festhalten konnte. Die Gewissheit, dass Neils Arme mich sicher umfingen und dass er genau wusste, was er tat.
Aber am erschreckendsten war, dass ich mich ungeheuer wohl und sicher fühlte und den drängenden Wunsch verspürte, meiner Freundin Adena davon zu erzählen.
Sanfte Hügel, bewachsen von dunklen Pinienkiefern, erstreckten sich hinter dem kleinen Acker, den Tom angelegt hatte, um im nächsten Jahr Hafer anzubauen. Weiter hinten ragten steile weiße Kalkfelsen aus dem um diese Jahreszeit noch üppigen Grün der Berge. Neil ließ Psitó ein Stück den breiten Fahrweg entlanggehen und folgte später einem schmalen Pfad voller Hufspuren, der in die Hügel hineinführte.
»Lehn dich gegen mich, und bleib ganz locker«, sagte er, als Psitó bergan schneller wurde und ich mich versteifte. Ich lehnte mich gegen ihn und spürte den Schlag seines Herzens in meinem Rücken. Nach einer Weile merkte ich, wie meine Hüfte sich lockerte und ich mich den Bewegungen der Stute überließ.
Eine Weile ritten wir schweigend, scheuchten ein winziges Kaninchen auf und einen Vogel, der sein Nest am Boden hatte. Während ich krampfhaft überlegte, was ich sagen könnte, fragte Neil auf einmal im Plauderton: »Weißt du eigentlich, wo die Appaloosapferde herkommen?«
»Die Nez Perce haben sie gezüchtet«, antwortete ich wie aus der Pistole geschossen, denn schließlich war ich nicht von gestern, auch wenn er das vielleicht dachte.
»Stimmt«, sagte er. »Sie züchteten sie wegen ihrer auffallenden Fellzeichnung. Vor jeder Jagd, jedem Kriegszug bemalten die Männer der Nez Perce sich und ihre Pferde mit Symbolen, die Glück bringen sollten oder sie vor Unheil bewahren. Aber wenn es regnete oder sie einen Fluss durchqueren mussten, wusch das Wasser die Farbe wieder ab. So suchten sie sich Pferde aus, die besonders ausdauernd, schnell und klug waren und außerdem die schönste Fellzeichnung hatten, und kreuzten sie. Sie waren davon überzeugt, dass der Große Geist die Tiere bemalt zu ihnen geschickt hatte, und deshalb waren sie ihnen besonders heilig.«
Ich dachte an Stormy und dass auch sie vom Großen Geist gezeichnet war. Wakan, heilig. Kein Regen und kein Flusswasser würden ihr je die Punkte von der Hinterhand spülen. Unter hundert Pferden würde ich sie wieder erkennen.
Neil führte Psitó in ein kleines Tal hinunter, und ich musste mich weit zurücklehnen, um an ihm dranzubleiben und die Bewegungen der Stute auszugleichen. Jetzt spürte ich die Vertiefung hinter Psitós Schulterblatt, von der er vorhin gesprochen hatte, ganz deutlich.
»Die Pferdeherde der Nez Perce wuchs schnell auf mehr als tausend Tiere an, und sie war der ganze Stolz des Stammes«, fuhr Neil fort. »Aber dann wurden auch die Nez Perce von den Weißen gezwungen, ihre angestammte Heimat zu verlassen und in ein Reservat umzusiedeln. Ihr Häuptling erbat sich Zeit bis zum Herbst, weil viele Fohlen in der Herde noch zu klein waren, um die schwierige Reise anzutreten. Aber die Nez Perce bekamen keinen Aufschub. Auf ihrem Weg ins Reservat waren sie gezwungen, einen eiskalten und reißenden Fluss zu überqueren, der vierhundert Meter breit war. Die meisten ihrer Pferde ertranken darin. Darunter beinahe alle trächtigen Stuten und viele Fohlen.«
Ich hatte Neil stumm gelauscht, und nun war meine Kehle wie zugeschnürt. Vor meine Augen sah ich hunderte Pferde, die verzweifelt versuchten gegen eine reißende Strömung anzukämpfen. Hübsche Fohlen wie Stormy, die in den kalten Fluten keine Chance hatten. Und warum das alles?
»Wenn sie alle ertrunken sind«, fragte ich nach einer Weile, »wie kommt es dann, dass es noch Appaloosas gibt?«
»Die Nez Perce rächten sich bitter für den Verlust ihrer Pferde und ihres Stolzes. Daraufhin wurden sie gnadenlos verfolgt. Als die letzten kapitulierten, sperrte man sie ein und beschlagnahmte ihre Pferde. Es waren Weiße, die mit den verbliebenen Appaloosa-Pferden eine neue Zucht aufbauten.«
Neil stieß grimmig Luft durch die Zähne. »Erst blind vernichten und dann retten, was übrig geblieben ist. Das ist typisch für die Weißen.« Keine Ahnung, ob er wusste, dass meine Mutter eine Weiße war, auf jeden Fall schien er die Wasicún, wie wir Lakota die Weißen nennen, nicht besonders zu mögen. Mein letztes bisschen Hoffnung, dass Neil sich vielleicht doch für mich interessieren könnte, schwand auf einmal. Nach seinem Vortrag über Appaloosapferde sagte er nichts mehr und er fragte auch nichts. Wer ich war und was ich dachte, schien ihn überhaupt nicht zu interessieren.
Wieder vor der Scheune angelangt, glitt Neil vom Pferd und half mir herunter. Wenn ich direkt vor ihm stand, reichte ich ihm nur bis zum Kinn, und so brauchte ich ihm wenigstens nicht in die Augen zu schauen.
»Danke«, sagte ich, »das war toll. Aber jetzt muss ich vor zur Straße. Mein Vater kommt sicher gleich.« Ich wandte mich um und sprintete los.
»Hey«, rief Neil mir hinterher. »Kommst du morgen wieder?«
Verwundert blieb ich stehen und drehte mich noch einmal zu ihm um. »Soll ich denn?«
Er zuckte die Achseln. »Das liegt ganz an dir. Ich bin jedenfalls da.« Er grinste. »Und die Pferde auch.«
»Okay«, stieß ich hervor. »Dann tschüss bis morgen.«
»Tóksâ«, rief er mir hinterher.
Meinem Vater erzählte ich nichts davon, dass ich ohne Sattel auf Psitó geritten war, mit Neil Thunderhawks Armen um meine Hüften und seinem Herzschlag im Rücken. Das bereitete mir einige Bauchschmerzen, denn bisher hatte ich meinem Vater immer alles erzählt. Einen Grund, ihm etwas zu verheimlichen, hatte es nie gegeben.
Aber diesmal hatte ich das ungute Gefühl, dass er Bedenken haben könnte, wenn er wüsste, bei wem und vor allem: wie ich heute meine Reitstunde genommen hatte. Auf dem Nachhauseweg fragte er aber nur, ob ich Fortschritte machte, Details wollte er keine wissen. Darüber war ich froh.
Dad war mit dem Bau des Waschsalons beschäftigt und hatte den Kopf voll mit Dingen, die er beachten musste. Zum Glück. Sonst hätte er längst gemerkt, was mit mir los war.
Die Aufregung dehnte sich in mir, schob die verwirrenden Gefühle hin und her, sodass ich zu platzen drohte, wenn ich mein Erlebnis nicht so bald wie möglich jemandem erzählen konnte.
Kaum war Dad wieder nach Manderson gefahren, rannte ich hinauf zu Adena, die hinter dem Haus Wäsche auf eine Leine knüpfte. Ich half ihr dabei, damit sie schneller fertig wurde und wir uns aus dem Lauschbereich von Jason, der Nervensäge, begeben konnten. Wir rannten um die Wette den Berg hinauf, bis wir ganz oben angelangt waren.
»Was ist denn bloß los mit dir?«, fragte Adena, als sie sich keuchend ins Gras fallen ließ – natürlich nicht, ohne sich vorher zu vergewissern, dass dort kein Giftefeu wuchs und keine Klapperschlange in der Sonne lag. »Du bist ja ganz hippelig.«
Ich setzte mich neben sie, hörte das Geräusch meines Atems in meinem Bauch. »Ich bin heute ohne Sattel geritten«, platzte ich heraus. Adena verdrehte die Augen. »Na, das ist ja wohl keine Kunst«, bemerkte sie völlig unbeeindruckt.
»Für dich vielleicht nicht«, schmollte ich. »Aber ich fand es ziemlich aufregend. Vor allem, weil Neil mit auf dem Pferd saß.«
Adena setzte sich auf und zog eine Augenbraue hoch. »Neil?«, fragte sie. Auf einmal hatte ich ihre volle Aufmerksamkeit.
»Neil Thunderhawk, Toms Sohn.«
»Von einem Neil hast du mir noch gar nichts erzählt«, sagte Adena spitz, nachdem sie den träumerischen Ausdruck auf meinem Gesicht gründlich studiert hatte. »Saß er vor dir oder hinter dir?«
»Hinter mir«, sagte ich, ein wenig verwundert über ihre Frage.
»Wie alt ist er denn?«
Schwang da etwa Eifersucht in Adenas Stimme mit?
»Fünfzehn«, sagte ich. Das wusste ich von Tom.
»Und?«
»Er kann total gut mit Pferden umgehen, reitet den großen Hengst und weiß alles über Appaloosas«, schwärmte ich.
Adena ließ sich stöhnend wieder ins Gras fallen. »Was ich meine, ist: Sieht er gut aus?«
»Ich glaub schon.«
»Ich glaub schon«, äffte sie mich nach. »Du musst doch wissen, ob ein Junge gut aussieht oder nicht!«
Ehrlich gesagt, hatte ich mir bisher über solche Dinge wenig Gedanken gemacht. Adena war es, die ständig den Jungs hinterherschaute und sich darüber aufregte, dass sie sich nicht schminken und keine Spagettiträger tragen durfte, weil ihre traditionellen Eltern das nicht erlaubten. Adena war einen halben Kopf größer als ich und ihre weiblichen Rundungen weitaus deutlicher entwickelt als meine. Die begehrlichen Blicke der Jungs an unserer Schule, mit denen sie Adena verfolgten, waren mir nicht entgangen.
Für mich interessierte sich niemand. Vielleicht lag es an meiner knabenhaften Figur, vielleicht auch daran, dass ich ein Halbblut war. Es gab ein paar Leute im Reservat, die bemitleideten mich und sahen verächtlich auf meinen Vater herab, weil er eine Weiße geheiratet hatte. Deshalb hatte ich es mir zur Angewohnheit gemacht, mich im Hintergrund zu halten, um möglichst nicht aufzufallen. Da ich klein war und unscheinbar, funktionierte das wunderbar. Häufig wurde ich überhaupt nicht bemerkt.
Bei Adena und ihren Eltern brauchte ich mich nicht zu verstecken. Obwohl die White Elks eine sehr traditionelle Lakota-Familie waren, beurteilten sie einen Menschen nicht danach, ob er weißes Blut in den Adern hatte oder nicht. Darüber war ich mächtig froh. Und froh war ich auch, dass ich so eine Freundin wie Adena hatte. Eine Freundin, die zwar gerne unkte, manchmal ziemlich erwachsen tat und mich hin und wieder auch mal auslachte, aber nicht deshalb, weil ich eine Iyeska,ein Halbblut, war.
»Er sieht umwerfend aus«, sagte ich und hoffte, dass Adena sich damit zufrieden geben würde. Sie war ständig verliebt. Im Augenblick interessierte sie sich für einen Jungen aus der Parallelklasse, der sie bisher allerdings überhaupt nicht wahrgenommen hatte. Da gerade Ferien waren, sah sie ihren Billy so gut wie nie und schrieb dauernd irgendwelche Liebesbriefe, die sie mir zeigte, dann aber doch nicht abschickte.
Adena zupfte Grashalme aus, machte ein ernstes Gesicht und bewertete sämtliche Jungs an unserer Schule, über die es sich zu reden lohnte, auf einer Punkteskala von 1 bis 10. Am schlechtesten kamen die weg, die sich über Mädchen lustig machten und herumposaunten, mit welcher sie angeblich schon geschlafen hatten.
Im Flüsterton unterhielten wir uns über Sex, ein dunkles, unerforschtes Land, an dessen Grenze wir standen. Wir sehnten uns danach, sie zu überschreiten, und fürchteten uns gleichzeitig davor. Wir lagen im Gras, kicherten und seufzten und bedauerten, dass wir erst dreizehn waren.
»Und, wirst du morgen wieder Reitunterricht bei ihm nehmen?«, fragte Adena, wobei sie das Wort Reitunterricht mit einem gewissen Unterton aussprach, der mir nicht entging.
»Ja, er hat es mir angeboten.«
»Dann pass nur gut auf!« Sie lächelte wissend.
»Worauf denn?«, neckte ich sie.
»Vielleicht will er dir ja noch was anderes beibringen als Reiten.«
Wir lachten, bis wir keine Luft mehr bekamen. Die Sonne brannte auf uns herab und der Duft des wilden Salbeis umhüllte uns wie eine betörende Wolke voller Versprechungen.