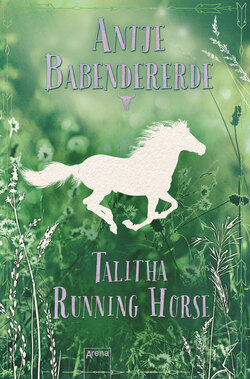Читать книгу Talitha Running Horse - Antje Babendererde - Страница 11
ОглавлениеDank Adenas Warnung fand ich in dieser Nacht keinen Schlaf. Mit Sicherheit gab es nichts, aber auch gar nichts, was Neil Thunderhawk mir außer Reiten noch beibringen wollte. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er etwas an mir fand.
Als ich dann am nächsten Tag vor ihm stand, bleich und unausgeschlafen, machte er sich ernsthaft Sorgen um mich.
»Ist dir nicht gut?«, fragte er. »Du bist ganz blass. Wie ein richtiges Bleichgesicht.«
Mit jedem Wort, das er sagte, wurde ich befangener. Mir war klar, dass ich mich wie eine komplette Idiotin aufführte, aber Neils freundlich besorgte Stimme bewirkte, dass ich mich noch elender fühlte.
»Es ist nichts«, sagte ich. »Wirklich.«
»Na dann lass uns Taté und Psitó holen.«
Ich lief ihm hinterher. Wenn er mit seinen langen Beinen einen Schritt machte, musste ich zwei machen. »Was hast du denn vor?«, fragte ich.
»Ausreiten.« Er blieb stehen und drehte sich um. Seine schwarzen Augen funkelten schelmisch. »Diesmal jeder auf seinem Pferd.«
»Aber … «
»Keine Angst, du kannst Psitó natürlich satteln, wenn dir das lieber ist.«
Wir holten die braun gefleckte Stute und den Hengst aus den Hügeln und banden sie an die Zaunbalken vor der Scheune. Nachdem wir sie gründlich gestriegelt hatten, half Neil mir Psitó zu satteln. Er selbst zog es vor, den Leopardenschecken ohne Sattel zu reiten, und ich hatte auch gar nichts anderes erwartet.
»Hast du Angst?«, fragte er, als er aufsaß und das große Tier mit Leichtigkeit wendete, um vorauszureiten.
»Nein«, sagte ich, was nur die halbe Wahrheit war. Ganz deutlich spürte ich das Prickeln im Nacken.
»Dann ist es ja gut«, sagte Neil. »Wenn Psitó nämlich spürt, dass du Angst hast, dann regt sich in ihr das Gefühl der Überlegenheit und sie wird dir Schwierigkeiten machen.«
Neil ritt mit mir zum ersten Hügel hinter dem Haus und brachte mir bei, bergan und bergab zu reiten. »Fersen nach hinten, Ellenbogen an den Körper«, sagte er. »Lehn dich nach vorn. Nicht an den Zügeln zerren, das Pferd muss durch deine Bewegungen, die Verlagerung deines Gewichtes merken, was es tun soll.«
Psitó wurde schneller, als sie den Hügel erklomm, genau wie gestern, als Neil hinter mir auf dem Pferd gesessen hatte.
»Keine Angst«, sagte er, »wenn sie oben angelangt ist, bleibt sie erst einmal stehen. Das hat Pa ihr so beigebracht.«
Ich hatte keine Angst. Ich tat einfach das, was Neil mir am gestrigen Tag vorgemacht hatte, und es funktionierte. Das große Tier, auf dessen Rücken ich saß, gehorchte meinen Befehlen.
Irgendwann waren wir oben angelangt, auf dem höchsten Berg. Ich hatte nicht viel mehr tun müssen, als Psitó einfach dem Hengst hinterherlaufen zu lassen. Die Stute wusste instinktiv, wie und wo sie die Hänge am besten nehmen konnte. Und ich war oben geblieben.
Neil sprang ab und auf seinen Wink hin ließ ich mich von Psitós Rücken gleiten.
»Psitó läuft merkwürdig«, sagte er und hob nacheinander die Beine der Stute an, um ihre Hufe zu kontrollieren. Im linken Vorderhuf hatte sich ein spitzer kleiner Stein verklemmt, und Neil entfernte ihn mit seinem Messer.
Dann führte er mich über einen schmalen Grat zu den Kalkfelsen. Metertiefe Schluchten öffneten sich auf beiden Seiten des Pfades und mir wurde mulmig, zumal ich nach dem Ritt sowieso ein wenig wacklig auf den Beinen war. Neil merkte es und griff nach meiner Hand. Seine Finger waren warm und staubig.
Schließlich standen wir ganz vorn, auf einer flachen Erhebung und blickten ins Tal hinunter. Neil ließ mich los. Ich sah das rote Haus der Thunderhawks und – ganz in der Nähe der Straße – das Haus von Tante Charlene. Scooter und Rip, die beiden Hunde, lagen vor ihrer Holzhütte in der Sonne.
Weiter links sah ich die Pferde in einer Senke weiden und rechts im Tal entdeckte ich das kreisrunde Schutzdach eines Powwow-Platzes. Auf einmal erinnerte ich mich daran, dass ich vor langer Zeit schon einmal mit meinem Vater und meiner Mutter hier gestanden hatte. Es war Dads Land, auf dem wir uns befanden. Unser Land.
»Warst du schon mal hier?«, fragte Neil, als könne er Gedanken lesen.
»Ja«, sagte ich. »Aber es ist ziemlich lange her.«
»Das Land gehört deinem Vater«, bemerkte er. »Warum wohnt ihr eigentlich nicht hier? Hier ist es doch viel schöner als drüben in Porcupine.«
Ich hob die Schultern. »Unser Trailer ist so alt, dass er nicht mehr transportiert werden kann. Und einen neuen Trailer oder ein richtiges Haus können wir uns nicht leisten. Dad kriegt einfach keinen festen Job. Dabei hat er ein Zertifikat als Automechaniker, und er kann auch sonst ziemlich viel.«
Neil nickte. Er wusste gut, wovon ich sprach. Es gab kaum Jobs im Reservat, weil die Wirtschaft nicht in Gang kam. Wer eine Idee hatte, bekam keinen Kredit von der Bank, weil ein Indianer nun mal nicht kreditwürdig war. Hatte jemand genug eigenes Geld, um ein Geschäft zu eröffnen, standen auf einmal sämtliche Verwandte vor der Tür und hielten die Hände auf. Derjenige konnte sich dann überlegen, ob er ein guter Lakota war und sich großzügig verhielt oder ob er ein guter Geschäftsmann sein wollte. Die meisten waren gute Lakota – und so blieb alles beim Alten. Ein Großteil der Reservatsbewohner lebte von Sozialhilfe, die nie bis zum Ende des Monats reichte.
Über die Hälfte des Reservatslandes war seit vielen Jahren zu Spottpreisen an weiße Farmer verpachtet und es würde noch einmal viele Jahre dauern, bis die Pachtverträge ausliefen und wir Lakota unser Land wieder selbst nutzen konnten. Eine Menge Dinge lagen im Argen im Reservat, und es bedurfte großer Kraft und vor allem Einigkeit, um daran etwas zu ändern.
Plötzlich spürte ich eine Bewegung über meinem Kopf und hob den Blick in den Himmel. Über uns kreisten riesige schwarze Vögel in den warmen, aufsteigenden Luftmassen aus dem Tal. Es sah aus wie ein Tanz. Ihre dunklen Schatten wanderten über die Felsen.
»Truthahngeier«, sagte Neil. »Irgendwo wird vermutlich ein totes Tier liegen.«
Truthahngeier waren Aasfresser und hatten einen sehr ausgeprägten Geruchssinn, das wusste ich. Ich versuchte, sie zu zählen. Es waren sieben, acht, nein – zehn, zwölf. Immer mehr kamen über die Hügel geflogen, senkten sich dicht über unsere Köpfe hinweg, sodass ich das Gefühl hatte, vom Luftzug ihrer Schwingen berührt zu werden.
Eine Zeit lang beobachteten wir die großen Vögel bei ihren Flugmanövern, dann liefen wir über den schmalen Grat zurück zu Psitó und Taté, die friedlich nebeneinander grasten. Die Gebissteile ihrer Trensen klirrten leise, wenn sie am Gras zupften.
Wir stiegen auf und ritten noch ein Stück. Weiter hinten, wo die Hügel flacher wurden, stand eine alte Hütte, und nicht weit davon gab es einen kleinen See, auf dem ein Entenpärchen schwamm.
Ich wartete sehnsüchtig darauf, dass Neil seinen Hengst im Galopp laufen ließ, weil ich ihm dann mit Psitó folgen konnte. In diesem Augenblick war ich meinen Träumen so nah wie noch nie zuvor. Es war herrlich, den warmen Wind im Gesicht zu spüren, das ruhige Trommeln der Hufe im Ohr. Nur dass die alte Psitó nicht annähernd Ähnlichkeit mit meinem Traumpferd hatte und der leichte Trab, den Neil mir zugestand, nicht mit dem Fliegen über die Prärie in meiner Vorstellung zu vergleichen war.
Wir machten schließlich kehrt und ritten zum See, um die Pferde trinken zu lassen. Dann ritt Neil voran und ließ den Leopardenschecken einen guten Weg zurück ins Tal suchen. Als wir wieder bei der Scheune angelangt waren und Neil den Sattel von Psitós Rücken hob, sagte er: »Besser du erzählst meinem Vater nichts von unseren Ausritten. Wenn er morgen fragt, dann sag ihm, wir hätten hier auf dem Platz geübt.«
»Okay«, sagte ich und versuchte beiläufig zu klingen. »Schon klar.« Ich war gezwungen zu lügen, was mir nicht gefiel. Wer keine Erfahrung im Lügen hatte, wurde leicht ertappt. Andererseits war es ungeheuer aufregend, mit Neil Thunderhawk ein Geheimnis zu haben. Denn der Ausritt hatte ihm – da war ich mir sicher – mindestens ebenso viel Spaß gemacht wie mir.
In den nächsten drei Wochen war ich jeden Tag bei den Pferden und Tom Thunderhawk brachte mir alles bei, was ich wissen musste. Er verlor niemals die Geduld und hatte immer einen Scherz auf den Lippen, wofür ich ihm sehr dankbar war.
Irgendwann gestattete er mir, Psitó alleine zu reiten, wann immer ich wollte. Toms Vertrauen machte mich glücklich und schenkte mir eine Stärke, die ich bisher nicht gekannt hatte.
Wenn ich Neil Thunderhawk begegnete, klopfte mein Herz zum Zerspringen. Allerdings hatte er nicht vor, mir zu viel seiner kostbaren freien Zeit zu opfern. Er half seinem Vater beim Bau eines Zaunes, der verhindern sollte, dass die Pferde auf Tante Charlenes Land grasten oder auf die Straße liefen. Er ritt die Tiere regelmäßig und begann mit der Ausbildung der beiden Jährlinge, die langsam daran gewöhnt werden mussten, Zaumzeug und Sattel zu tragen. Ein gut eingerittenes Pferd brachte beim Verkauf einige hundert Dollar mehr als ein Tier, dass noch nicht an Sattel und Reiter gewöhnt war. Manchmal sah ich, dass Neil mich beobachtete, wenn ich Psitó striegelte oder mit Stormy spielte. Bemerkte er meinen Blick, wandte er sich ab. Zu gerne hätte ich gewusst, was er über mich dachte.
Die Wärme seiner Hand und sein Herzschlag in meinem Rücken gingen mir nicht mehr aus dem Sinn.
Della, Toms Frau, war von Anfang an sehr nett zu mir. In der letzten Woche brauchte Dad mich in der Mittagszeit nicht mehr nach Hause fahren, weil sie mich eingeladen hatte mit ihrer Familie zu essen. Ich kam am Morgen, ritt Psitó, leistete Stormy Gesellschaft, half manchmal im Stall oder passte auf Bey und April auf, Neils kleine Schwestern.
April war sieben und Bey drei Jahre alt. April Thunderhawk war groß für ihr Alter und hatte dieselben schwarzen Augen wie ihr Bruder. Unter langen Stirnfransen blickten sie mich neugierig an. Bey, die ihren Babyspeck noch nicht verloren hatte, wusste schon sehr genau, was sie wollte.
Beide zusammen konnten ganz schön laut und anstrengend sein, kein Wunder, dass Neil so tat, als ob er für Mädchen nichts übrig hatte. Aber ich wusste, dass es anders war, denn ich begegnete ihm auf dem Abschluss-Powwow vom Lakota College in Kyle, wo seine Mutter Lehrerin war.
Powwows, unsere Tanzfeste, finden den ganzen Sommer über statt. Im Winter werden sie gelegentlich in Turnhallen oder Gemeindezentren abgehalten. Jeder Indianer, der etwas auf sich hält, besitzt ein Tanzkostüm und nimmt irgendwann einmal an einem Powwow teil. Es gibt Leute, die machen den ganzen Sommer über nichts anderes.
Es war der Samstag, nachdem die Arbeiten an Bernies Waschsalon in Manderson abgeschlossen waren. Dad und ich hatten unsere Tanzkleidung hervorgeholt und waren gegen Mittag zum Collegegebäude gefahren, das auf einem Hügel stand, ein paar Meilen vor dem Ort Kyle.
Kaum auf dem Powwow-Platz angekommen, hatte ich Neil auch schon entdeckt. Er hatte seine kleine Schwester April an der Hand und Bey auf dem Arm und sah überhaupt nicht unglücklich oder genervt aus. Im Gegenteil, seine Geduld war erstaunlich. Er lief sogar mit, als Bey ihn auf die Tanzfläche zerrte, obwohl sich der Tanz Tiny Tot nannte und extra für die ganz kleinen Knirpse war.
Neil ragte zwischen den pummeligen gefiederten Gestalten hervor wie ein strahlender Held. Er war gekleidet wie ein richtiger Krieger und er konnte tanzen, als wäre er einer. Kleine Federn schmückten seine langen Zöpfe, und wenn er tanzte, flogen sie. Er war ganz in Hirschleder gekleidet. Hose und Hemd hatten lange Fransen an den Seiten und waren bestickt mit bunten Glasperlen. Neil bewegte sich im vollkommenen Gleichklang mit der Trommel. Seine Füße, die in Mokassins steckten, schwebten erstaunlich leicht über das niedergetretene Gras.
Ich ließ mich am Rand des Tanzplatzes nieder und zeichnete. Meine liebsten Werkzeuge waren farbige Buntstifte oder Bleistift. Mrs Hunter, meine Kunstlehrerin, hatte mein Talent erkannt und mir ans Herz gelegt, den Sommer über viel zu zeichnen. »Du hast eine lockere Hand, Tally«, hatte sie zu mir gesagt. »Zeichne alles, was dir vor die Nase kommt. Vielleicht schaffst du es, auf die Kunstschule zu gehen. Du hast das Zeug dazu.«
Der Gedanke, auf eine Kunstschule zu gehen, gefiel mir, denn ich zeichnete leidenschaftlich gern und konnte mir nichts Besseres vorstellen, als es irgendwann einmal zu meiner Hauptbeschäftigung zu machen. Was für ein herrliches Gefühl, ein glattes weißes Blatt Papier vor sich zu haben und es durch wenige Striche mit Leben zu füllen! Papier und Stifte waren meine ständigen Begleiter. Ich trug sie in einer Umhängetasche aus Wildleder mit mir herum, die mein Vater für mich genäht und mit einem Perlenmuster bestickt hatte.
Eine ältere Frau mit riesiger Brille auf der Nase, die neben mir saß, nickte anerkennend, als sie den tanzenden Neil Thunderhawk auf meinem Blatt erkannte. Ein bunter Wirbel aus Federn und Fransen. Der letzte Schlag der Trommel verklang, der Falsettgesang der Trommler endete schlagartig und Neil stoppte seinen Tanz abrupt. Auf einmal blickte er zu mir herüber und nickte mir zu. Ich hoffte, dass er später nicht sehen wollte, was ich gezeichnet hatte.
Mein Herz flatterte wieder wie ein erschrockener Vogel, als Neil wenig später an der Tacobude vor mir stand. Ich spürte, wie ich rot wurde, aber das fiel ihm vielleicht gar nicht auf, weil die Präriesonne meine Haut inzwischen so dunkel gebrannt hatte, als wäre ich ein Vollblut.
»Hi Tally«, sagte er und sah auf mich herunter. Neil trug einen Kopfputz aus Stachelschweinborsten, der ihn noch größer wirken ließ. An seinem zottigen Beinschmuck hingen Glöckchen, die bei jedem seiner Schritte klingelten.
»Hallo Neil«, erwiderte ich so locker wie möglich. »Wie geht’s?«
»Gut. Und dir?« Er zahlte und nahm seinen Taco entgegen. Biss herzhaft hinein in das Fladenbrot, das dick mit roten Bohnen, Tomaten, Zwiebeln und Käse bedeckt war.
Mir lief das Wasser im Mund zusammen. »Auch gut.«
»Bist du mit deinem Dad hier?«, fragte er kauend.
»Ja«, sagte ich. »Er gehört zu den traditionellen Tänzern.«
»Mein Pa auch.« Neil nickte mir zu. »Okay. Dann noch viel Spaß.«
»Ja, dir auch.«
So liefen fast alle Gespräche ab, die ich mit Neil Thunderhawk hatte. Wenn man das überhaupt Gespräche nennen konnte. Seine Erinnerung an die beiden Ausritte, die mir unaufhörlich im Kopf herumgeisterten, schien völlig ausgelöscht zu sein. Er war dabei, erwachsen zu werden, und in seinen Augen war ich noch ein Kind. Nicht mehr als ein junges Fohlen wie Stormy, hübsch anzusehen, aber zu nichts zu gebrauchen, jedenfalls noch nicht.
Ich wollte einfach nicht glauben, dass ich immer noch dreizehn Jahre alt war.
Neil bemerkte natürlich nicht, dass ich mir Mühe gab, älter auszusehen, indem ich mein Haar nicht mehr zu zwei Zöpfen flocht, sondern nur noch zu einem. Ihm fiel auch nicht auf, dass ich mich jedes Mal besonders hübsch anzog, wenn die Möglichkeit bestand, ihm zu begegnen. Es interessierte ihn nicht, wie gut ich auf dem Powwow tanzte, denn er tanzte besser. Ihm war gleichgültig, dass ich Psitó inzwischen auch allein ohne Sattel reiten konnte, denn er ritt schnell wie der Wind, so als wäre er eins mit Taté, dem gefleckten Hengst. Neil konnte auch nicht ahnen, dass ich jedes Mal eine Gänsehaut bekam vom Klang seiner Stimme.
Es hatte mich nicht getroffen wie ein Blitz, sondern war langsam zur Gewissheit geworden: Zum ersten Mal in meinem Leben war ich richtig verliebt. Was für ein wunderbares und zugleich peinigendes Gefühl das sein konnte: Dieses wohlige Flattern im Bauch, wenn Neil Thunderhawk mich anlachte und mit mir sprach. Und die pure Verzweiflung, wenn er mich keines Blickes würdigte.
Vor dem Powwow hatte ich meine und Dads Tanzkleidung auf dem großen Tisch in der Wohnküche unseres Trailers ausgebreitet und genau überprüft, ob auch nichts fehlte. Mein Vater besaß einen Anzug aus weich gegerbtem Hirschleder, der ihn wie einen Krieger aus vergangenen Zeiten aussehen ließ. Die Tanzkleidung war bestickt mit verschiedenfarbigen Stachelschweinborsten und winzigen bunten Glasperlen. Seine Mokassins, die ebenfalls kunstvoll mit Perlen bestickt waren, trug mein Vater nur, wenn er tanzte.
Dad legte großen Wert darauf, dass die Farben und Muster auf seiner Kleidung auch stimmten. Ein wirklich gut gearbeitetes Outfit war teuer, vor allem wenn Adlerfedern dafür verwendet wurden. Und Dad besaß ein Bustle, einen kreisrunden Federschmuck für den Rücken, der komplett mit Adlerfedern besetzt war.
Die Tanzkleidung meines Vaters war um die 2 000 Dollar wert, und schon mehr als einmal hatte er sich mit dem Gedanken getragen, sie zu verkaufen. Immer dann, wenn uns das Nötigste zum Leben fehlte und wir nicht wussten, wo die nächste Mahlzeit herkommen sollte. Aber jedes Mal war uns der Zufall zu Hilfe gekommen, und Dad hatte doch wieder irgendwo einen Job gefunden.
Mein Vater war ein guter Tänzer und ich unheimlich stolz auf ihn. Auch diesmal schaffte er es, als Sieger aus dem Wettkampf im traditionellen Tanz hervorzugehen. Das Preisgeld von 300 Dollar und das, was er beim Bau des Waschsalons verdient hatte, würde uns eine Weile die Sorgen nehmen.
Dad kannte fast jeden auf dem Powwow, und er unterhielt sich mit vielen Leuten. Ich wollte ihm nicht dauernd hinterherlaufen wie ein Hündchen, deshalb suchte ich mir ein stilles Plätzchen und zeichnete. Die anderen Mädchen in meinem Alter zogen meist in Grüppchen über das Powwow-Gelände. Sie tuschelten und lachten und liefen den Jungs hinterher.
Ich vermisste Adena. Vor einer Woche war sie mit ihren Eltern und Jason zu ihrem Bruder Henry gefahren, der mit seiner Familie im Cheyenne-River-Reservat lebte, dort, wo meine Urgroßmutter Helen Yellow Bird hergekommen war.
Ich traf zwar noch ein paar Jungs und Mädchen aus meiner Klasse, aber ihr Interesse an meiner Gesellschaft hielt sich in Grenzen. Das war nicht fair, aber ich war es gewohnt. Und es tat nicht mehr so weh wie damals, als ich in die erste Klasse kam und begreifen musste, dass ich in den Augen einiger meiner Klassenkameraden weniger wert war, nur weil »weißes Blut« in meinen Adern floss. Dass ich viel über unsere Traditionen wusste und sie mehr achtete als so mancher reinblütige Lakota, schien überhaupt keine Bedeutung zu haben. Sie sahen nur meine grünen Augen und mein rötlich schimmerndes Haar, das sich wellte, wenn es feucht wurde.
Zuerst wollte ich mich bei meinem Vater darüber beklagen, aber bald wurde mir klar, dass es ihn nur traurig und wütend machen würde und dass er mir sowieso nicht helfen konnte. Ich musste es allein durchstehen, und das tat ich auch. Bis die White Elks ihren nagelneuen Trailer über unserem aufstellten und Adena in meine Klasse kam. Es gab einige freie Plätze im Klassenraum und auch an meinem Tisch war noch ein Stuhl frei. Adena war geradewegs auf mich zugesteuert und hatte mich gefragt, ob sie sich zu mir setzen durfte.
Ich war froh gewesen, endlich eine Banknachbarin zu haben, hatte aber gefürchtet, dass auch Adena sich von mir abwenden würde, wenn sie erfuhr, dass meine Mutter eine Weiße war. Also machte ich mich noch am selben Tag auf den Weg zum Trailer von Adenas Familie und erzählte ihnen von meiner Mutter.
Wahrscheinlich beschämte es die White Elks, dass ich solche Befürchtungen hatte, und deshalb waren sie immer besonders nett zu mir und meinem Vater. Adena wurde sehr schnell meine Freundin. Endlich hatte ich jemanden, mit dem ich meine geheimen Ängste und Wünsche teilen konnte. Jemanden, der mich verstand, der mit mir lachte und der immer greifbar war. Seitdem störte es mich nicht mehr, dass einige Jungs und Mädchen mich mieden. Ich war nicht mehr allein.