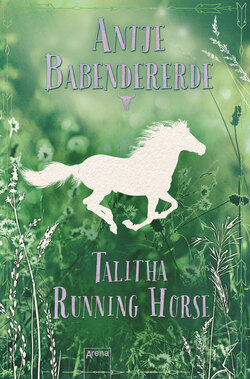Читать книгу Talitha Running Horse - Antje Babendererde - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2. Kapitel
Als wir wieder zu Hause waren, lief ich doch noch hinauf zu Adena. Ich wollte ihr unbedingt von den Appaloosa-Pferden erzählen. Adena White Elk war dreizehn, so alt wie ich, und wir gingen in die achte Klasse der Junior Highschool von Porcupine. Meine Freundin war Vollblutindianerin, eine Oglala-Lakota. Sie stammte aus einer sehr traditionellen Großfamilie, einer Tiospaye,wie wir Lakota sagen. Es gab Tiospayes in unserem Reservat, die mehr als achtzig Mitglieder zählten.
Die White Elks besaßen aus Prinzip keinen Fernseher, um die Einflüsse der weißen Kultur von ihren Kindern fern zu halten. Hinter ihrem Trailer stand eine Schwitzhütte, ein halbrunder Bau aus gebogenen Weidenästen, der mit grauer Plane abgedeckt war. Darin wurden regelmäßig Inipis, Schwitzbäder abgehalten, um Körper und Geist zu reinigen. Adenas Großvater Bernhard White Elk, der mit dem Rest der Tiospaye in Kyle lebte, war ein geachteter Medizinmann im Reservat, der jedes Jahr den Sonnentanz in den Black Hills leitete. Meine Freundin Adena hatte drei Brüder, von denen aber nur noch der zehnjährige Jason zu Hause lebte. Leider war er eine ziemliche Großklappe.
Der Trailer, den Familie White Elk bewohnte, war genauso groß wie unserer, aber viel moderner und besser eingerichtet. Sie hatten sogar ein Badezimmer mit fließendem Wasser und Spülklosett. Dad und ich durften ab und zu bei den White Elks duschen, was ich ziemlich nett von ihnen fand. Denn eine Wasserleitung zu legen kostete eine Menge Geld, und immer wenn wir das Geld dafür zusammenhatten, ging irgendetwas an unserem Truck oder am Trailer kaputt oder jemand kam und brauchte das Geld dringender. Um einem Verwandten eine dringend notwendige Operation zu ermöglichen, zum Beispiel. Manchmal bekamen wir unser Geld zurück, manchmal auch nicht. Wer etwas hatte, der gab. Großzügigkeit ist eine der wichtigsten Tugenden der Lakota. Die anderen sind Aufrichtigkeit, Weisheit, Mut und Demut.
Adena freute sich, als ich vor der Tür stand. Sie zog mich herein und führte mich gleich zu Picu, die in der Küche auf ihrer Decke in einer Kiste lag und drei Welpen säugte. Als Adena den Kopf der Hündin streichelte, blinzelte sie uns müde an.
»Picu ist ganz schön erschöpft«, sagte Adena, »die drei haben ständig Hunger.«
»Sie sind süß.« Ich streichelte einem der Hundebabys mit dem Zeigefinger über das Bäuchlein.
»Willst du einen?«
»Sofort«, sagte ich und seufzte hingerissen. »Aber Dad wird es nicht erlauben. Wir haben ja schon Miss Lilly.« Miss Lilly war meine grauschwarz getigerte Katze. Ihr fehlte ein halbes Ohr, das sie vermutlich beim Kampf mit einem Kojoten eingebüßt hatte. Miss Lilly war eine sehr eigenwillige Dame, die über Konkurrenz aus der Hundewelt sicher nicht erfreut gewesen wäre.
»Na ja, du kannst es dir ja noch überlegen.«
Ich nickte und erzählte Adena von Tom Thunderhawks Pferden und dem kleinen Stutfohlen, das ich Stormy genannt hatte.
Adena schüttelte ungläubig den Kopf. »Du gibst einem Fohlen, das dir überhaupt nicht gehört, einen Namen?«
Betrübt zuckte ich die Achseln. Meine überschwängliche Freude machte der nüchternen Erkenntnis Platz, dass ich mich Hals über Kopf in ein Fohlen verliebt hatte, das wildfremden Menschen gehörte. Mit ziemlicher Sicherheit hatte es bereits einen Namen, da hatte Adena vollkommen Recht.
»Es sieht wunderschön aus«, sagte ich. »Ich hab es in meinen Träumen gesehen.« Das entsprach nicht ganz der Wahrheit. In meinen Träumen hatte ich ein Pferd gesehen, das schön und stark war. Aber es war kein bestimmtes Pferd und schon gar kein Fohlen. Doch jetzt war Stormy das Pferd meiner Träume.
»Träume hin, Träume her, du darfst dein Herz nicht so dranhängen«, sagte Adena und klang furchtbar erwachsen. »Wenn das Fohlen groß genug ist, verkauft der Besitzer es vielleicht, und du siehst es niemals wieder.«
Manchmal konnte sie ganz schön grausam sein in ihrer nüchternen Art.
»Dad sagt, es ist ein besonderes Pferd. Es ist wakan* weil Wakan Tanka es gezeichnet hat. Vielleicht behält Tom Thunderhawk das Fohlen ja auch«, erwiderte ich trotzig. »Dann kann ich es besuchen, wenn wir bei Tante Charlene sind.«
Nachdem ich von Adena zurückgekommen war, aßen Dad und ich Reis mit roten Bohnen und tranken Tee aus cheyaka, wilder Pfefferminze, die ich im vergangenen Sommer gesammelt und getrocknet hatte. Im Öfchen prasselte ein gemütliches Feuer und aus dem Radio erklang Musik von Walela, einer indianischen Frauenband, die Dad mit Vorliebe hörte. Rita Coolidges rauchige Stimme füllte den Raum. Miss Lilly lag auf unserer zerschlissenen alten Couch und räkelte sich genüsslich in der Wärme.
Ich war noch immer ganz erfüllt von der Begegnung mit den Pferden und hatte jetzt schon Sehnsucht nach dem gepunkteten Fohlen. Ich beklagte mich bei meinem Vater, dass Tom Thunderhawks Appaloosas mich zwar in ihrer Nähe geduldet hatten, sich aber von mir nicht anfassen ließen.
»Das braucht seine Zeit«, sagte er. »Du musst geduldig sein.«
»Aber wenn ich sie nur so selten sehe, werden sie sich nie an mich gewöhnen«, murrte ich. Geduld ist nicht unbedingt meine Stärke.
»Wenn du etwas hättest, das sie gerne fressen, irgendeine Leckerei, dann wäre es vielleicht einfacher«, bemerkte Dad.
Etwas ratlos sah ich ihn an. Die Pferde der Lakota waren keine Leckerbissen gewöhnt. Karotten kamen in die Suppe, wenn man welche hatte, denn frisches Gemüse war teuer in den wenigen Läden, die es im Reservat gab. Die meisten Pferde mussten sehen, dass sie das Jahr über selbst genug zu fressen fanden, jedenfalls solange kein Schnee lag. Im Winter wurden die Tiere dann gefüttert, solange das Geld für Futter reichte. Wenn nichts mehr da war, mussten sie mit ihren Hufen den Schnee beiseite scharren und zusehen, wie sie allein zurechtkamen.
Auch der letzte Winter war hart gewesen. Dad hatte mir erzählt, dass einige Pferdebesitzer im Reservat Tiere verloren hatten. Im Januar lag der Schnee so hoch, dass sie nichts mehr zu fressen fanden. Ihre Besitzer hatten kein Geld gehabt, um ihre Häuser oder Trailer zu heizen, geschweige denn, um Futter zu kaufen.
Auch unser Geld reichte natürlich nicht, um Leckereien für Pferde zu kaufen, die uns nicht mal gehörten. Aber ein paar Tage später kam mein Vater mit einem Karton krümeliger dunkelgrüner Würste von einem Arbeitseinsatz zurück. Er überreichte mir die Pappkiste mit einem strahlenden Lächeln.
Ich machte große Augen: »Was ist das, Dad?«
»Ich war heute bei einem Mann in Wanblee, der sich gut auskennt mit sämtlichen Pflanzen, die bei uns wachsen«, erklärte mein Vater.
»Er hat in seinem Keller eine elektrische Ölpresse und presst damit Öl aus Sonnenblumenkernen und Sesamsaat, manchmal mit Salbei, Hagebutten oder Kräutern vermischt. Ich habe seine Dachrinne repariert und er fragte mich, ob ich Pferdebesitzer sei, denn er hätte da etwas, das Pferde gerne fressen würden.«
Helle Freude wuchs in mir, obwohl ich immer noch keine Ahnung hatte, was das für merkwürdiges Zeug in diesem Karton war. Ich nahm eine fingerdicke Wurst heraus und schnupperte daran. Es fühlte sich fest an und roch nussig.
»Was du in den Händen hältst, ist das, was beim Pressen der Ölsaat übrig bleibt«, sagte mein Vater. »Man nennt es Presskuchen. Vielleicht hast du mit diesen Pellets Glück bei den Pferden.«
Er zwinkerte mir zu und ich setzte die Kiste ab, um ihn zu umarmen. Mein Vater dachte immer an mich. Oft brachte er mir eine Kleinigkeit mit, irgendetwas, von dem er wusste, dass ich mich darüber freuen würde. Eine besonders schöne Feder oder einen kirschgroßen weißen Stein, in dessen hohlem Inneren winzige Körner rasselten, ein zerlesenes Exemplar des National Geographic Magazine, neue Stifte oder Papier zum Zeichnen.
Und diesmal einen Karton mit Leckerbissen für Pferde.
Ich drückte ihm einen dankbaren Kuss auf die Wange. Mein Vater hob mich hoch, wie er es oft getan hatte, als ich noch kleiner war, und schleuderte mich einmal herum, dass meine langen Zöpfe flogen.
»Du bist der beste Dad, den ich habe«, sagte ich.
Er lachte. »Ich liebe dich auch, Braveheart.«
Braveheart. Das war Dads Kosename für mich. Er hatte ihn mir gegeben, als ich vor fünf Jahren beim Spielen in Gift-Efeu gefallen war und keine Träne vergossen hatte, obwohl sich grässliche große Blasen an meinen Beinen bildeten, die nässten und fürchterlich brannten.
Es war gar nicht so schwer gewesen, den Schmerz nicht über die Lippen kommen zu lassen. Ich hatte ihn zu einer kleinen Kugel zusammengepresst, um die sich mein Wille schloss wie eine Faust. Das hatte Dad mir beigebracht.
Auf einmal hörten wir Flügelschlag über unseren Köpfen und blickten beide in den Himmel. Es war ein Vogel mit langen Beinen, langem Hals und einem spitzen Schnabel. Ein Kranich, der in Richtung Norden flog. Mit einem frohen Lächeln setzte mein Vater mich ab. Ich wusste, dass auch er in diesem Augenblick an Großvater Emmet dachte. Beide hörten wir die Worte des alten Mannes: Wenn du einen Kranich nordwärts fliegen siehst, dann weißt du, dass der Winter vorbei ist.
Im Schulbus erzählte ich Adena von den Pellets. Sie machte ihr typisches skeptisches Gesicht. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pferde Abfälle von irgendetwas mögen«, sagte sie.
»Du wirst schon sehen«, erwiderte ich.
Während des Unterrichts schweiften meine Gedanken andauernd zu Tom Thunderhawks Pferden. Durch die großen Fenster im Klassenzimmer sah ich die Wolken am Himmel fliegen, wie sie zerrissen und sich wieder vereinten. In meiner Phantasie wurden sie zu weißen Pferden mit fliegenden Mähnen. Die Stimme meiner Klassenlehrerin plätscherte dahin wie ein Bach. Ich träumte mit offenen Augen, bis Mrs Turnbull mich weckte.
»Hältst du noch Winterschlaf, Tally?«, fragte sie spöttisch. Die Klasse lachte.
Dass ich im Unterricht träumte, war nicht neu. Trotzdem hatte ich in den meisten Fächern gute Noten. Adena war natürlich besser. Sie war in fast allem besser als ich, auch wenn sie das nie herauskehrte.
Adena wollte Lehrerin werden. Sie konnte ein Gedicht in kürzester Zeit auswendig lernen und ausdrucksvoll vortragen. Im Kopfrechnen war sie die Schnellste der ganzen Klasse. Auch im Sportunterricht war sie immer ein bisschen schneller als ich, sprang ein paar Zentimeter weiter oder höher. Sie hatte eine wunderschöne klare Stimme und auf dem Powwow war sie die bessere Tänzerin. Ihre Handarbeiten sahen immer korrekter aus als meine, und was sie anhatte, saß stets perfekt, während ich meistens so aussah, als ob ich verschlafen hätte und wie der Blitz in die Klamotten gesprungen wäre, die gerade herumlagen.
Nur in einem konnte Adena mir nicht das Wasser reichen: Ich war eindeutig die bessere Zeichnerin. Wenn Adena versuchte ein Pferd zu zeichnen, konnte man es leicht mit einer Kuh verwechseln. Wenn ich Tiere zeichnete, wirkten sie so lebendig, als könnten sie jederzeit aus dem Papier springen, sagte Dad immer.
Nach der Schule kam Adena gleich mit zu mir, um sich meine kostbaren Pferdeleckerbissen anzusehen. Mit spitzen Fingern nahm sie ein grünes Würmchen aus dem Karton. Sie roch daran und rümpfte die Nase. »Und das soll den Pferden schmecken? Na ich weiß nicht…«
Sie unkte mal wieder. Adena unkte gern. Manchmal trieb sie mich damit fast zur Verzweiflung.
Aber diesmal ließ ich mich durch ihren skeptischen Blick nicht beirren. »Wenn dieser Kräutermann sagt, dass Pferde dieses Zeug gern fressen, dann wird es auch so sein«, erwiderte ich zuversichtlich.
Die Frühjahrsstürme begannen und es regnete viel, was gut war für den trockenen Boden im Reservat. Der Wind trieb den Regen gegen die Scheiben unseres Trailers und unter das Dach, das im Winter undicht geworden war. Dad flickte und reparierte es, während ich die Pfützen auf dem Boden aufwischte.
Die Kakteen auf dem Hügel hinter unserem Trailer füllten sich mit Wasser, und das grüne Gras kam hervor. Nun würden Tom Thunderhawks Pferde wieder genügend zu fressen finden. Doch ich würde es noch schwerer haben, an sie heranzukommen. Die Kiste mit den Pellets stand immer noch unberührt in meinem Zimmer, und ich konnte es kaum erwarten, wieder zu Tante Charlene zu fahren, um mein Glück bei den Pferden zu versuchen.
Drei Tage später bot sich die Gelegenheit. Diesmal war es ein Reifen von Tante Charlenes Ford-Combi, der gewechselt werden musste. Dad hatte gewartet, bis ich aus der Schule kam, weil er wusste, dass ich sonst traurig gewesen wäre, wenn er sich ohne mich auf den Weg gemacht hätte. Ich füllte einen Teil der Pellets in einen Stoffbeutel, und wir fuhren los.
Den ganzen Vormittag hatte es geregnet, aber nun lugte die Sonne zwischen den Wolken hervor. »Zum Glück«, sagte Dad, »ich dachte schon, ich müsste den Reifen bei strömendem Regen wechseln.«
Marlin stand auf den Holzstufen vor dem Haus und spielte mit den Hunden. Sie bellten und sprangen um ihn herum, weil er einen Knochen in der Hand hielt, den sie gerne haben wollten. Als ich aus dem Pick-up stieg, hörte er auf, freundlich zu ihnen zu sein, und jagte sie weg. Er bedachte Dad und mich mit einem gleichgültigen Blick.
Marlin war schon immer groß und kräftig gewesen. Nach dem Tod seines Vaters aber war er fett geworden, genau wie seine Mutter. Wenn er so weiterfuttert, wird er bald nicht mehr aus den Augen schauen können, dachte ich jedes Mal, wenn ich ihn sah.
Er ging ins Haus. In Gegenwart meines Vaters traute er sich nicht, mich zu hänseln. Ich fragte mich, warum nicht Marlin das Rad am Wagen seiner Mutter wechselte. Alt genug war er schließlich dazu. Doch hätte ich diese Frage laut ausgesprochen, hätte er mir das später heimgezahlt. Irgendwann, wenn mein Vater nicht dabei war.
Mit meinem Stoffbeutel voller grüner Würste machte ich mich gleich auf den Weg zu den Pferden. Tagsüber suchten sie die saftigsten Wiesen in den Hügeln. Neben der Bretterscheune, hinter der sich eine große Koppel befand, hatte Tom Thunderhawk ihnen einen Unterstand gebaut, wo sie vor Sturm und Regen Schutz suchen konnten.
Ich musste nicht weit laufen – nur bis zu einer Baumgruppe, wo die Pferde grasten und sich an der schorfigen Rinde scheuerten, um ihr Winterfell loszuwerden. Neugierig kamen einige der Tiere auf mich zu und schnoberten an meiner Tasche. Ich musste lächeln und holte eine Hand voll Pellets heraus. Stormys Mutter beschnupperte die duftenden Würstchen, die ich ihr auf der Hand darbot und begann zu fressen. Ich hielt ganz still, aber innerlich jauchzte ich vor Freude.
Stormy beobachtete uns aus sicherer Entfernung. Ganz langsam ließ die Scheu der Pferde nach, doch sie wandten auch weiterhin die Köpfe ab, wenn ich versuchte sie zu berühren.
Als ich mich nach der einen Stunde, die mein Vater mir zugebilligt hatte, auf den Weg zurückmachte, liefen die Pferde mir nach. Das war ein unglaubliches Gefühl, als ob sie zu mir gehören würden – oder ich zu ihnen. Aber vermutlich verbrachten sie die Nacht immer auf der Koppel hinter der Scheune, und Tom hatte ihnen durch abendliche Futtergaben beigebracht, sich in der Dämmerung auf den Weg zu machen, damit er sie nicht holen musste.
Tatsächlich liefen die Pferde zum Unterstand, und als ich mich noch einmal zu ihnen umwandte, sah ich jemanden aus der Scheune kommen. Die Gestalt war groß, aber nicht so kräftig wie ein Mann. Es war ein Junge mit langen Zöpfen. Er musste gespürt haben, dass er beobachtet wurde, denn er drehte sich um und sah zu mir herüber.
Ich tat so, als hätte ich ihn nicht bemerkt, und lief einfach weiter zum Haus meiner Tante. Mein Herz flatterte wild wie ein Vogel in meiner Brust, weil ich den Blick des Jungen in meinem Rücken spürte. Wer er wohl war? Hatte Tom Thunderhawk einen Sohn? Dad hatte mir gar nichts davon erzählt, dass Tante Charlenes neuer Nachbar eine Familie hatte.
Von nun an begleitete ich meinen Vater jedes Mal bereitwillig, wenn er zu Tante Charlene fuhr. Um die Pferde zu sehen, nahm ich sogar Marlins Schikanen in Kauf. Er kniff mich, wenn niemand hinsah, und zog mich an den Zöpfen. Er war vierzehn und ich konnte nicht begreifen, dass ihm derart kindisches Benehmen Vergnügen bereitete. Aber auch wenn seine Kniffe blaue Flecken auf meinen Armen hinterließen, die noch lange zu sehen waren: Vielmehr schmerzte es mich, wenn er über mich lästerte.
Daran, dass er mich Halbblut und Powwow-Unfall schimpfte, hatte ich mich inzwischen gewöhnt, aber er zog auch gerne über mein Äußeres her. Spitznase, Brett mit Warzen, Knochenbein, Heuschrecke.
Um Marlins Demütigungen zu entgehen, ließ ich mich oft gar nicht erst im Haus blicken, sondern machte mich gleich auf den Weg zu den Pferden. An manchen Tagen war es schon sommerlich warm, und wenn ich am roten Haus der Thunderhawks vorbeiging, sah ich manchmal zwei kleine Mädchen auf der Wiese spielen oder eine junge Frau, die Wäsche auf eine Leine hängte und mir freundlich zuwinkte. Auch den Jungen, von dem ich inzwischen wusste, dass er Toms Sohn war, sah ich hin und wieder, machte aber jedes Mal einen großen Bogen um ihn.
Bisher hatten Jungs mich kaum interessiert, wobei Adena meinte, das läge nur daran, weil die Jungs sich nicht für mich interessierten. Vielleicht hatte sie damit sogar Recht. Was nützte es mir, ihnen mit schmachtenden Blicken hinterherzusehen, wenn sie mich überhaupt nicht wahrnahmen.
Einen plausiblen Grund, warum ich Toms Sohn aus dem Weg ging, hätte ich nicht zu nennen gewusst. Zugegeben, in Wahrheit brannte ich darauf, ihn kennen zu lernen. Ich hatte nämlich gesehen, wie er mit den Pferden sprach, wie liebevoll er mit ihnen umging. Sie dankten es ihm mit Vertrauen und Zuneigung. Und jemand, dem Tiere auf diese Weise vertrauten, musste ein besonderer Mensch sein.
Vielleicht hätte er mir das Geheimnis verraten, wenn ich den Mut aufgebracht hätte, ihn anzusprechen. Stattdessen übte ich mich in Geduld, lockte und fütterte die Pferde mit Pellets und gewann auf diese Weise die Zuneigung von Stormys Mutter und den anderen Tieren. Einzig der gefleckte Hengst und das Fohlen weigerten sich immer noch, mir aus der Hand zu fressen. Der Hengst war zu stolz und Stormy zu vorsichtig.
Aber ich gab nicht auf, und nach einiger Zeit gewöhnte sich das Fohlen an meine Stimme und meinen Geruch. Es begann sich für meine Spezialitäten zu interessieren und verlor seine Scheu. Stormy schnupperte an den duftenden Pellets, fraß ein wenig und ließ zu, dass ich sie am Kopf berührte. Es war ein unglaublich schönes Gefühl, als ich zum ersten Mal ihre gesprenkelten Nüstern streichelte, die sich so samtig anfühlten wie weich gegerbtes Wildleder.
Seit ich Stormy das erste Mal gesehen hatte, war sie bereits ein Stück gewachsen und längst nicht mehr so zittrig und ungelenk wie am Anfang. Wenn das Stutfohlen hinter seiner Mutter herjagte und ausgelassene Sprünge vollführte, dann sah es aus wie ein Schneewirbel auf der grünen Frühlingswiese.
Einmal begleitete mich Adena zu den Pferden, und ich bewies ihr, wie wild die Tiere auf meine ungewöhnlichen Leckerbissen waren. Die Stuten und die beiden Jährlinge ließen sich von ihr füttern, nur der Hengst und Stormy nicht. Da wusste ich, dass zwischen mir und dem Fohlen etwas Besonderes entstanden war, etwas, das nicht nur mit den schmackhaften Pellets zu tun hatte, die ich ihm brachte.
Stormy erkannte mich und vertraute mir.
»Es mag mich nicht«, sagte Adena gekränkt. »Wieso kannst du es streicheln und ich nicht?«
»Du bist ihm fremd, das ist alles«, tröstete ich sie. Und während ich das sagte, durchströmte mich ein warmes, wunderbares Gefühl von Einzigartigkeit. Ich streichelte Stormy, mein Fohlen, das mir nicht gehörte. Es stupste mich an und schien mir sagen zu wollen, dass es mich ebenfalls mochte.
* wakan: heilig