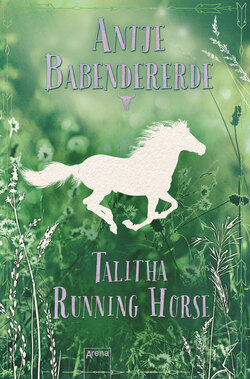Читать книгу Talitha Running Horse - Antje Babendererde - Страница 9
ОглавлениеEines Tages Ende Mai, als ich wieder bei den Pferden war, passierte, was ich immer befürchtet hatte. Tom Thunderhawk kam dazu, wie ich Stormy mit Pellets aus der Ölpresse fütterte. Ich erschrak, als er plötzlich hinter mir stand, denn ich hatte ihn nicht kommen gehört. Er war groß, noch größer als mein Vater, hatte dunkle Haut, zwei dicke glänzende Zöpfe, schwarze Augen und narbige Wangen. Auf dem Kopf trug er eine rote Baseballkappe mit dem Aufdruck KILI Radio.
»Du verwöhnst meine Pferde«, sagte er mit strenger Stimme, deren Resonanz ich in meinem Magen spürte.
Ich versteckte den Beutel hinter meinem Rücken und blickte verlegen zu Boden, als könne ich irgendwie im Gras verschwinden.
»Was gibst du den Pferden denn da?«, fragte Tom. »Sie scheinen ja richtig wild darauf zu sein. Zucker ist nicht gut für sie, schon gar nicht für ein Fohlen, das noch säugt. Sie kriegen schlechte Zähne, und dann habe ich ein großes Problem.«
»Es ist nichts Süßes«, stotterte ich. »Das würde ich ihnen nie geben.« »Was ist es dann?« Er streckte fordernd die Hand aus und ich reichte ihm widerstrebend meinen Beutel. Er fasste hinein, nahm ein paar Pellets und roch daran.
»Das sind Reste aus einer Ölpresse«, sagte ich, einen Anflug von Trotz in der Stimme. »Sonnenblumensaat mit Kräutern. Sie fressen es furchtbar gern.«
»Soso«, bemerkte Tom brummig, aber dann erschien plötzlich ein breites Lächeln auf seinem narbigen Gesicht. »Wasté«, sagte er, was auf Lakota so viel wie »gut« oder »schön« bedeutete. »Ist genehmigt, junge Frau.«
»Wirklich?« Ich konnte mein Glück kaum fassen und wurde rot. Ich war dreizehn Jahre alt, klein und dünn. Junge Frau hatte noch nie jemand zu mir gesagt.
»Ja, du kannst sie damit füttern, das ist in Ordnung.« Er gab mir den
Beutel zurück und lachte, als Stormy neugierig an meiner Hand zu knabbern begann. »Das Fohlen mag dich«, sagte er freundlich.
»Ja«, sagte ich, »ich mag Stormy auch.«
Tom betrachtete mich mit einem seltsam fragenden Blick und ich schlug mir die Hand vor den Mund, als mir bewusst wurde, was ich verraten hatte.
»So so, du gibst meinen Pferden also Namen«, sagte er, mit offensichtlicher Verwunderung.
Ich senkte den Kopf. Mit Sicherheit hatte Tom dem gepunkteten Fohlen längst einen Namen gegeben und es konnte natürlich nicht zwei Namen haben.
»Nur dem Fohlen«, erwiderte ich kleinlaut.
»Stormy ist ein schöner Name«, meinte er schließlich. »Schöner als Corry, aber er klingt ähnlich. Meinetwegen kann das Fohlen deinen Namen behalten.«
»Wirklich?« Ich blickte auf und strahlte Tom an.
»Ja, warum nicht.« Er nannte mir die Namen der anderen Tiere und so erfuhr ich, dass Stormys Mutter Hanpa hieß und der gefleckte Hengst Taté. Das war Lakota und bedeutete Wind.
»Hast du ihn schon mal laufen sehen?«, fragte Tom.
Ich schüttelte den Kopf. Meine Zeit bei den Pferden war immer nur kurz, nie länger als eine Stunde.
»Er ist schnell wie der Wind, daher hat er auch seinen Namen. Nur ich und mein Sohn Neil dürfen ihn reiten.«
So erfuhr ich die Namen der Pferde und dass der Junge, den ich manchmal dabei erwischte, wie er mich beobachtete, Neil hieß.
Tom musterte mich nachdenklich. »Du magst Pferde, nicht wahr?«
»Ja«, sagte ich und sah zu ihm auf. »Sehr.«
»Kannst du denn reiten?«
Verlegen schüttelte ich den Kopf. »Nicht richtig. Wir haben keine Pferde.«
Ich war zwar hier und da mal geritten, aber richtig gelernt hatte ich es nie. Und das bei meinem Namen: Running Horse.Etwas Beschämenderes konnte ich mir als Lakota-Indianerin nicht vorstellen. Die meisten Kinder im Reservat wuchsen mit Pferden auf und waren gute Reiter. Mit den Pferden verband sich unser ganzes Lebensgefühl. In meinem Fall verband sich mit ihnen nur mein Name und eine große Sehnsucht.
»Möchtest du es lernen?«
Ich blickte ihn hoffnungsvoll an, aber dann sank mein Kopf wieder nach unten. »Wir haben kein Geld für so was«, sagte ich bekümmert. Tom Thunderhawk begann zu lachen, ein tiefes, donnerndes Lakota-Lachen, das in meinem Magen kollerte und auf merkwürdige Weise liebevoll klang.
»Hab ich vielleicht was von Geld gesagt? Du magst die Tiere und sie mögen dich. Außerdem hast du ein gutes Gefühl für Pferde, und das gefällt mir. Ich beobachte dich schon lange.«
»Aber wir wohnen ziemlich weit weg«, sagte ich.
»In Porcupine, wenn ich mich nicht irre?«
»Ja, das stimmt.«
Er lachte wieder. »Das ist doch nur ein Katzensprung. Komm, wann immer du kannst, und wenn ich Zeit habe, werde ich dir das Reiten beibringen.« Er strich mir mit seiner großen dunklen Hand übers Haar. »Wie heißt du eigentlich, Mädchen?«
»Tally«, sagte ich mit wild klopfendem Herzen. »Talitha Running Horse.«
Für einen kurzen Augenblick huschte ein Schatten über Toms Gesicht und er fragte: »Ist Charlene deine Tante?«
Ich nickte. »Mein Dad hilft ihr manchmal, wenn es was zu reparieren gibt. Deshalb bin ich ab und zu hier.«
»Charlene ist nicht besonders gut auf meine Familie zu sprechen«, sagte er, und ich hatte plötzlich furchtbare Angst, dass er sein Angebot zurücknehmen könnte, nur weil ich mit Tante Charlene verwandt war.
»Sie ist auf niemanden gut zu sprechen«, erwiderte ich schnell.
»Mein Onkel ist vor einem Jahr im Irak gefallen und seitdem geht es ihr nicht so gut.«
Thunderhawk nickte. »Ja, ich weiß. Wenn sie etwas freundlicher zu anderen wäre, würde es ihr vielleicht besser gehen.«
Mein Vater kam und holte mich. Er wechselte ein paar Worte mit Tom Thunderhawk und dabei stellte sich heraus, dass Tom ein Stück Land pachten wollte, das meinem Vater gehörte und das an sein eigenes Land grenzte.
»Dann hätten die Pferde einen größeren Auslauf«, sagte er.
Aber Dad wollte nicht verpachten, was mich wunderte, wo wir doch jeden Dollar gut gebrauchen konnten.
»Das Land gehört mir, aber es ist nicht mein Besitz«, sagte mein Vater, »und ich achte es zu sehr, als dass ich daraus Gewinn schlagen könnte.«
Thunderhawk nickte. »Das verstehe ich und ich hätte da einen Vorschlag.«
Schließlich einigten sie sich darauf, dass Toms Pferde auf unserem Land grasen durften und ich dafür bei ihm Reiten lernen würde. Ich konnte kommen, sooft ich wollte. Mit diesem Angebot war ich mehr als zufrieden, und Tom war es auch. Freudestrahlend umarmte ich meinen Vater.
Wieder zu Hause, lief ich gleich zu Adena und erzählte ihr, dass ich reiten lernen würde. Ich tat mein Bestes, um die Euphorie zu verbergen, die sich meiner bemächtigt hatte. Aber Adena merkte natürlich, wie es um mich bestellt war.
»Du hast bloß Pferde im Kopf«, sagte sie und verdrehte die Augen.
»Und du Jungs«, gab ich zurück.
»Weil ich kein Kind mehr bin«, bemerkte sie schnippisch.
Ich wollte auch kein Kind mehr sein, aber ich sah immer noch aus wie eins. Da war nichts zu machen.
Der Sommer zog ins Land. Er roch nach Salbei, der an manchen Stellen so dicht wuchs, dass die Prärie wie ein silbern schimmerndes Meer aussah. Die Ferien begannen Anfang Juni und ich fieberte meiner ersten Reitstunde entgegen. Alles war abgesprochen. Dad würde mich zu Tom bringen, hatte verschiedene Dinge in Manderson zu erledigen und wollte mich dann wieder abholen.
Er setzte mich gleich an der Straße ab, an der Einfahrt zu den Häusern von Tante Charlene und Tom Thunderhawk. Als ich zur Scheune kam, wartete Tom schon auf mich. Er hatte Psitó, eine brave alte Stute für mich ausgesucht, eine von den braun gefleckten, die kein Fohlen hatte. Psitó bedeutet Perle und die Stute machte ihrem Namen alle Ehre. Dass sie mich kannte, mit meiner Stimme und meinem Geruch vertraut war, erwies sich als großer Vorteil.
»Sitz gerade und bleib locker«, sagte Tom, als ich auf Psitós Rücken im Sattel saß. Er stellte die Steigbügel nach der Länge meiner Beine ein, und als ich ihm zunickte, schnalzte er mit der Zunge und sagte: »Hoka hey,auf geht’s!«
Nun saß ich zwar nicht zum ersten Mal auf einem Pferderücken, aber das letzte Mal war lange her. Ich musste mich erst wieder an das Gefühl gewöhnen, von einem Tier getragen zu werden, das so viel größer war als ich.
Ich lehnte mich leicht nach vorn. Der riesige Pferdekörper schaukelte unter mir, als Psitó sich in Bewegung setzte. Ich war ein Fliegengewicht und die Stute ganz andere Lasten gewohnt. Das verunsicherte sie für einen Augenblick, aber dann merkte sie, dass sie sich nach meinem Willen zu richten hatte.
»Versuche mit ihren Bewegungen mitzugehen, aber zeige ihr deutlich, wer das Sagen hat.« Tom führte die Stute im Kreis, beobachtete mich und gab mir Hinweise. Die meisten Dinge musste er mir nur einmal sagen, denn meine Bewegungen glichen sich ganz von selbst denen der braunen Stute an. Es war ein herrliches Gefühl.
Ich lernte, die Stute loslaufen zu lassen, sie zum Stehen zu bringen und die Richtung ändern zu lassen. Zuletzt zeigte mir Tom, wie ich sie durch leichten Schenkeldruck im Trab laufen lassen konnte. Psitó war gut ausgebildet, und weil ich ihr nichts durchgehen ließ, gehorchte sie meinen Befehlen.
Irgendwann kam mein Dad mit dem Pick-up vor Charlenes Haus gefahren. Ich sah, wie er am Ford-Combi meiner Tante bastelte, und winkte ihm zu. Später kam er herüber, lehnte sich mit den Ellenbogen auf die Koppelstange und sah mir noch eine Weile zu. »Wie macht sie sich denn?«, fragte er Tom.
»Sieht so aus, als wäre deine Tochter ein Naturtalent«, sagte Thunderhawk. »Aus ihr wird ganz sicher mal einmal eine gute Reiterin.« Mir schwoll die Brust vor Stolz und ich schämte mich dafür, denn Stolz ist keine Tugend bei uns Lakota. »Übe dich in Demut«, hatte Großvater Emmet immer gesagt, »denn Demut besiegt den Stolz.«
Dad nickte und lächelte. »Ihre Mutter war eine Pferdenärrin. Deshalb ist sie damals auch ins Reservat gekommen. Sie dachte, wir Lakota würden zum Supermarkt reiten. Sie konnte es nicht fassen, dass die meisten hier mit kaputten alten Autos herumfahren.«
Thunderhawk lachte sein donnerndes Lakota-Lachen, und Psitó schnaubte.
Am nächsten Tag schmerzte mein ganzer Körper. Mein Hintern tat weh, die Innenseiten meiner Oberschenkel, mein Rücken und meine Schultern.
Dad lachte. »Beim Reiten werden Muskeln beansprucht, die sonst kaum etwas zu tun haben«, sagte er. »Aber wenn du dranbleibst, gibt sich das nach einer Weile.«
Ich wusste, dass mein Vater mit Pferden aufgewachsen war und gut reiten konnte. Seine Vorfahren hatten immer Pferde besessen, auch Großvater Emmet. Aber dann war meine Großmutter krank geworden und sie hatten ein Tier nach dem anderen verkaufen müssen, damit mein Großvater das Benzin bezahlen konnte, das er brauchte, um seine Frau im Krankenhaus besuchen zu können. Wenig später war sie gestorben und es hatte nie wieder Pferde in unserer Familie gegeben.
Ich biss die Zähne zusammen und dachte nicht im Traum daran, mich zu beklagen. Natürlich wollte ich dranbleiben! Alles hing doch nur davon ab, ob Dad Zeit hatte, mich zu Tom hinüberzufahren. Ich wünschte mir so sehr, bald wieder auf Psitós Rücken sitzen zu können, wie ich mir nichts mehr gewünscht hatte, seit meine Mutter fortgegangen war.
Und Wakan Tanka,der Große Geist, meinte es gut mit mir.
Durch Zufall bekam Dad schon kurz darauf einen Job in Manderson. Bernie Little Moon, der Besitzer des kleinen Lebensmittelladens, der sich »Bernie’s Store« nannte, wollte einen Waschsalon aufmachen und musste anbauen. Mein Vater würde sich als Zimmermann, Dachdecker, Klempner und Elektriker betätigen können und sein Lohn würde reichen, um gut über die Sommermonate zu kommen.
Ich konnte mein Glück kaum fassen. Dad würde mindestens drei Wochen und länger in Manderson zu tun haben und mich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit bei Tom absetzen können. Ich rief Tom an, und er war einverstanden. Er wollte sowieso mit den Pferden arbeiten, und so passten ihm die Reitstunden gut in den Kram.
In der ersten Woche lief dann auch alles ganz prima. Ich durfte Psitó allein aus den Hügeln holen, bürstete und sattelte sie. Dann führte Tom sie an der Longe im Kreis. Er brachte mir bei, wie man im Sattel blieb und wann es vernünftiger war, »auszusteigen«.
»Du wirst irgendwann von selbst spüren, wenn es keinen Zweck mehr hat, sich oben halten zu wollen«, sagte er. »Wenn sich abzeichnet, dass ein Sturz unvermeidlich ist, dann spring lieber ab.«
Wahrscheinlich blickte ich ziemlich verdutzt drein, denn Tom lachte über mein Gesicht. Ich war so versessen darauf, oben bleiben zu wollen, dass es mir nicht in den Sinn gekommen wäre, das Abspringen zu üben.
Wir übten es, während Psitó stillstand, und Tom fing mich ab. »Du bist leicht«, sagte er, »das ist ein großer Vorteil.«
Am Samstagnachmittag stieg ich hinauf zum Trailer der White Elks, um Adena von meinen Fortschritten zu erzählen. Jason, ihr kleiner Bruder, hüpfte auf einem Trampolin vor dem Haus und lachte schallend, als er mich heranhumpeln sah.
»Hat das Pferd dich abgeworfen?«, krähte er schadenfroh.
»Halt die Klappe, Spatzenhirn«, ächzte ich.
Adena, die im Gras saß und mit Picus Welpen spielte, lachte auch. Aber sie, die bei ihrem Großvater reiten gelernt hatte, tröstete mich und schwor, dass die Schmerzen vergehen würden, wenn ich den Dreh erst mal raushatte.
»Aber ich kann es«, sagte ich beleidigt, als ich mich neben ihr ins Gras plumpsen ließ. »Ich kann es wirklich.«
Adena lachte noch lauter. »Es sieht aber gar nicht danach aus.«
»Wonach sieht es denn aus?«
»Als wärst du hundert Jahre alt«, sagte sie.
Ich legte mich zurück und einer der Welpen, die alle ein kurzes rotes Fell hatten, leckte über mein Gesicht.
»Na siehst du«, meinte Adena, »sogar Sip hat Mitleid mit dir.«
»Sip?« Ich verzog das Gesicht. »Wie kannst du sie unterscheiden?«
Alle drei sahen aus wie kleine Kojoten und ich konnte sie beim besten Willen nicht auseinander halten.
»Sie heißen Sip, Flip und Chip«, sagte Adena achselzuckend. »Wenn ich einen rufe, kommen alle drei.«
Nellie White Elk erschien in der Tür und Jason, der immer noch auf dem Trampolin hüpfte, schrie: »Tally hat mich Spatzenhirn genannt, Mom.«
Nellie White Elk wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab und ich sah, wie sich ihre Lippen zu einem Lächeln verzogen. »Wie sieht es aus, ihr jungen Damen?«, wandte sie sich an Adena und mich. »Ich könnte Hilfe brauchen.«
Wir folgten Adenas Mutter ins Haus und halfen ihr Gemüse für eine Suppe zu schnippeln. Sellerie, Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Mais und Timpsila,eine Wildrübe in der Größe eines Rettichs, die an vielen Stellen im Reservat wuchs.
Adenas Mutter rollte kleine Fleischklößchen aus Elchhack, die sie in der Pfanne anbriet, bevor sie in die Suppe kamen. Als alles geschnippelt war, schickte sie Adena und mich los, damit wir am Rand des Weges, der zum Trailer führte, ein paar Stängel Lamb’s Quarter pflückten, eine Krautpflanze, deren dicke grüne Blätter mehr Vitamin C in sich haben als Spinat.
Als wir jeder mit einer Hand voll Lamb’s Quarter zurückkamen, duftete es schon köstlich in Nellie White Elks Küche und mir lief das Wasser im Mund zusammen. Nellie rief meinen Vater an und lud ihn zum Duschen und zum Abendessen ein. Doch als Adena ihr erzählte, was für einen Muskelkater ich vom Reiten hatte, wurde aus der Dusche ein Vollbad, in das nach mir noch mein Dad stieg. Ich fühlte mich wie neugeboren!
Es wurde noch ein richtig lustiger Abend. Wir ließen uns Nellies »Unkrautsuppe« – wie Jason sie nannte – schmecken und danach gab es Wojapi, dunkle Beerengrütze aus getrockneten Traubenkirschen und Maisstärke. Mein Vater und Charlie White Elk sangen Lieder auf Lakota. Dad hatte eine schöne Stimme, und ich hätte ihm stundenlang zuhören können. Aber er war ziemlich geschafft von der Arbeit und wurde immer müder. Gegen zehn Uhr bedankten wir uns für die Einladung und verabschiedeten uns.
Später, als ich in meinem Bett lag, dachte ich, dass es schön war, eine richtige Familie zu haben. Vater und Mutter und vielleicht noch ein paar Geschwister, die zu einem hielten. Aber mein Vater hatte nicht vor wieder zu heiraten, obwohl er erst fünfunddreißig war. Er brachte auch nie eine Frau mit nach Hause. Dabei hätte ich ihm das überhaupt nicht übel genommen. Dad sprach niemals schlecht von meiner Mutter, aber ich wusste, dass er es noch immer nicht verwunden hatte, dass sie ihn und mich verlassen hatte.