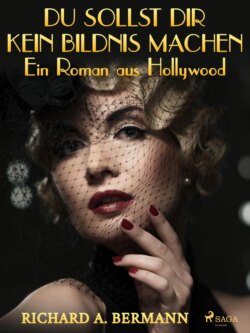Читать книгу Du sollst dir kein Bildnis machen - Ein Roman aus Hollywood - Arnold Höllriegel - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV.
ОглавлениеAm nächsten Tag, um die Mittagsstunde. Der Golden State Express, der vor dem billigen Zug von Chicago ausgefahren ist, ist schon fast einen Tag und eine Nacht in Los Angeles, oder rast längst wieder zurück nach Chicago, da fahren Paul und Claire Pauer erst in die grosse Stadt ein, die auf den ersten Blick sonderbar aussieht, und hässlich. Der Zug ist in den letzten Stunden immer durch grüne und goldene Orangengärten gefahren und durch weisse Villenvororte; jetzt fährt er ohne besondere Umstände wie irgendeine Tramway durch schäbige Strassen, in deren niederen Häusern lauter Chinesen und Japaner zu wohnen scheinen und kaffeefarbene Mexikaner. Die grosse Glocke auf der Lokomotive läutet fortwährend, mit einem tiefen und festlichen Ton, wie eine Kirchenglocke; aber das ist auch die ganze Festlichkeit dieser Ankunft. Auf einem Bahnhof, der wildwestlich und improvisiert aussieht, hilft Paul seiner Frau aus dem Zug, sie ist furchtbar müde von der endlosen Reise in dem unbequemen Zug und eingeschüchtert von dem ersten Anblick der unfassbar fremdartigen Stadt und hat eine heimliche Angst vor dem Gedanken an das billige Logis, in dem sie sicherlich absteigen werden. Wo ist überhaupt dieses Hollywood? Hier ist man doch erst in Los Angeles!
Aber Paul Pauer versteckt ein Lächeln, er bereitet eine kleine Überraschung vor. Er hat vorhin im Zug Kasse gemacht und gefunden, dass sie bisher weniger Geld ausgegeben haben, als sie vorher berechnet hatten. Auch hat sich Matelian, der Gute, doch platterdings geweigert, irgendeine Provision von den zweitausendfünfhundert Dollars anzunehmen; die Finanzen stehen im Augenblick nicht so ungünstig. Paul Pauer plant, der kleinen Frau einen behaglichen Abend und eine gesicherte, gute Nachtruhe zu geben, ehe sie, das muss freilich sein, morgen irgendein bescheidenes Quartier suchen. Claire macht grosse und frohe Augen, da er ein Taxi herbeiwinkt und dem Chauffeur mit affektierter Lässigkeit sagt: „Hotel Ambassador, please!“ Das „Ambassador“ ist doch das berühmte Luxushotel, in dem die Filmmillionäre absteigen! Claire remonstriert, ohne Überzeugung, aber Paul sagt, eine Nacht im „Ambassador“ werde noch zu erschwingen sein.
Jetzt fahren sie, erst durch menschenwimmelnde Geschäftsstrassen; selbst in New-York haben sie nicht so viele Autos beieinander gesehen. Dann werden die Strassen stiller und schöner, es sind lauter kleine Villen da, mit smaragdgrünen Rasenstreifen vor der phantastisch gegliederten Fassade; weisse Villen und tabakbraune mit gestreiften Leinwandmarkisen, Häuser, die spanisch aussehen, und welche, die italienisch sein wollen, an endlosen Strassen, lauter Asphalt und Palmenalleen und Märchenblumen in Vorgärten und kein einziger Fussgänger weit und breit, lauter Autos, in deren lackierten Dächern sich die Sonne spiegelt. Hören die Strassen nie auf? Es ist eine ganze Reise in das Hotel, weit, weit, auf hohe Hügel hinauf, und wieder Strassen und Villen und Autos; mit einem angenehmen Gruseln in ihrem Gewissen schaut Claire immer auf den Taxameter; die blosse Autofahrt kostet so ein Vermögen! Endlich fährt der Wagen durch ein feierliches Gittertor in einen gewaltigen Park, in dem eine mächtige Hausfront sich erhebt, inmitten vieler, kleiner Häuschen, die dazu gehören; das ist ja kein Hotel, sondern eine ganze Stadt! Claire, obwohl in ihren Träumen mondän gesonnen, möchte am liebsten ausreissen, anderswohin, aber Paul hat, nun verrät es ein lächelnder Portier, sogar telegraphisch ein Zimmer bestellt, vom Zuge aus. Es ist ein sehr kleines Zimmer im vierten Stock; aber vom Fenster aus sieht man den unwahrscheinlichsten Garten, mit einem märchenblauen Schwimmbassin in seiner Mitte; plantsch! werfen sich fortwährend sonnengebräunte Schwimmer vom Sprungbrett ins Wasser. Das gefällt der Claire, und auch die faulen, bunten Liegestühle und die an Seilen hängenden Doppelsitze für Pärchen, jeder mit einem grell gestreiften, leinenen Schattendach, und zum Schaukeln; und die wunderbar breiten, exotischen Blätter der Bananenstauden gefallen ihr, und die Palmen, Mimosen, die beblühten Sträucher, deren Namen man nicht wissen kann. Mit beiden Handflächen stützt sich Claire aufs Fensterbrett und denkt nicht mehr an Müdigkeit. Das alles ist so, so — — Sie weiss nicht wie: anders! Auf einmal tut sie einen kleinen Schrei des Entzückens und packt Paul, der sich zu waschen beginnt, am Hemdärmel und zieht ihn rasch auch zum Fenster; und auch er erkennt, vom vierten Stock aus, in der hell gekleideten Dame, die dort unten mit zwei Herren auf und ab geht, die lebendige und leibhaftige Pola Negri!
Dann ist Claire wieder sehr müde, aber auf eine andere Art, ohne Ärger, glücklich müde, und legt sich ein bisschen auf den Diwan, neben dem offenen Fenster, und die Schwimmer von ihrem Sprungbrett plumpsen: plantsch! in ihren beginnenden Schlaf.
Da sie aufwacht, ist der Abend da, ein sommerlich warmer Abend, aber früh hereingebrochen, nach dem Oktoberfahrplan. Das elektrische Licht in dem Zimmer brennt und ihr Mann, mit einer langen, dünnen Zigarre, sitzt ihrem Diwan gegenüber in dem Schaukelstuhl. Er hat, sagt er, unterdessen das Hotel besichtigt, das wirklich eine Stadt für sich ist, mit Kaufläden jeglicher Art und einem eigenen Kino und ganzen Villenvierteln von kleinen Bungalows, im Park verstreut und unschwer im ganzen zu mieten, wenn man viel Geld hat. Es gibt Restaurants ohne Zahl, berichtet er; man könnte in der Cafeteria essen, ohne sich umzuziehen. Wenn Claire so müde ist — — Da erkennt er die Bitte in ihrem Blick. Natürlich, umziehen! Um nichts in der Welt würde Claire sich das jetzt entgehen lassen: ihr Abendkleid anziehen (sie hat ein Abendkleid, eins, aber gar nicht so schlecht), und so tun, als gehörte sie, als gehörten sie beide wirklich zu diesem Hotel!
Müde? Claire ist nicht müde. Sie war noch nie so frisch. Es muss die kalifornische Luft sein, oder was — —
Ein wenig später sieht sie sich durch die „Lobby“ gehen, durch die ungeheure Halle des schönen Hotels, an der Seite eines präsentablen Gatten im Smoking, und weiss mit dem sechsten Sinn einer Frau, dass man ihr nachblickt. Dieses Abendkleid, keine grosse Affaire und billig genug, ein seidiges, graues Ding, weil grau zu ihren rotbraunen Haaren passt, das Abendkleid, hartnäckig errungen in ehelichen Finanzdebatten, von einer Frau, die doch einst Clara Dara war und ein Abendkleid haben muss. Es steht ihr; die meisten Dinge kleiden Claire Pauer. Sie geht durch die Lobby, nein, schreitet, sie weiss, dass sie immer „schreitet“, sie kann sich nicht helfen. Obwohl sie nicht hinblickt, weiss sie auch, dass ein Herr herübersieht, ein interessantes Gesicht, nicht jung und eher bärtig, aber — — Auf einmal steht der Mensch vor Paul Pauer und sagt lustig: „Hallo! Wer tommerlt denn da! Ja, da schau’ ich und schau’ ich — —“
Dann ist es ein Maler, ein Wiener, Poldi Bergmann, den Dr. Pauer gut kennt, aus dem Romanischen Café, vom gemeinsamen Stammtisch her. Wieso in Los Angeles? fragt Paul. Poldi Bergmann lacht: „Bin ich in Los Angeles, bitt’ Sie? Ich bin in Hollywood! Lubitsch hat mich herübergeholt, damit ich an den Dekorationen zu „Altheidelberg“ mitarbeite, die Amerikaner haben doch keine Idee, wie so etwas ausschaut!“ Paul stellt den Bekannten seiner Frau vor, die ihn noch nicht kennt; Paul hat sie in Berlin nie ins Romanische Café mitnehmen wollen und fast nie zu Schwannecke; sie sagt: weil er eifersüchtig ist; sie weiss: weil er sie immer von Schauspielern fernhalten will, von Theatermenschen.
Poldi Bergmann, der Maler, tut nicht einen einzigen Augenblick fein oder reserviert oder sonst was; dass ihm dieser rotbraune Frauenkopf imponiert, ach was, dass er ihn erfreut und beglückt, das verbirgt er hinter keinerlei Redensarten. Er ist ein Herr von fünfzig und hat Onkelprivilegien, gleich nützt er die schamlos aus. Nach zwei Minuten, während derer sie in der Lobby gestanden haben, sagt er schon „Kinderl“ zu Claire. Aber natürlich, das Kinderl muss gleich mit in die Cocoa-Nut Grove, heute ist der Donnerstag, an dem die meisten Filmleute da zu sein pflegen, unsere Bande hat einen grossen Tisch reserviert, alle werden sich freuen!
Einen Augenblick wundert sich Claire: der Maler trägt kurze Golfhosen und einen weichen Kragen. Aber wie sie dann in das grosse Festlokal des Hotel Ambassador kommt, findet sie, dass dort die meisten Gentlemen nicht minder summarisch gekleidet sind. Aber die Frauen, oh — —
Die Cocoa-Nut Grove, der berühmte Palmenhain des Ambassador, ist ein enormer gedeckter Wintergarten, dessen Säulen und Pfeiler tote und konservierte Kokospalmen sind, mit den Nüssen daran. Von Palme zu Palme schlingen sich Girlanden und farbige Lampen sind überall; auf den Tischen stehen Lampen mit farbigen Schirmen, ein grosser Tanzboden ist in der Mitte, und eine Jazzband spielt ununterbrochen. Das Ganze sieht bunt aus und nicht wenig kitschig; Paul Pauer, in der Tür stehen bleibend, macht erst ein unglückliches Gesicht, dann fasziniert das Bild ihn doch. Claire, zwischen ihm und dem massiven Bergmann, sieht glücklich aus, wie ein Kind, das ins Weihnachtszimmer darf, zu dem funkelnden Christbaum. Gleich sieht sie die Toiletten der Damen, vergleicht sie mit der ihrigen. Oh, und sie ist auf ihr unschätzbares Abendkleid ein bisschen stolz gewesen! Hier sind die Kleider aus Paris, und die Juwelen von Tiffany. Claire Pauer, ganz hingerissen, sieht diese Frauen an, die so schön sind, und sie tut, halb unbewusst, etwas ganz Revolutionäres. Wie sie da so stehen, nahe dem Eingang, zieht sie, vor ihrem Mann, einen kleinen Behälter aus ihrem Handtäschchen, das Geheimnis, den Apparat, von dem Paul nichts wissen will und nichts wissen darf, Puderquaste, Spiegelchen und Lippenstift, und fährt sich, nie hat sie es noch vor Leuten gewagt, mit dem roten Stift über ihre Lippen. Paul sieht es und sagt kein Wort und lächelt weiter.
Dennoch, es ist ein förmliches Pronunciamiento gewesen, ein Akt der ehelichen Rebellion, gerade hier, an der Schwelle eines neuen Lebens, und Paul hat es gesehen und hat es verstanden.
Poldi Bergmann hat jetzt am anderen Ende der lichterfüllten Halle den Tisch seiner Freunde gefunden und hat dort einigen Leuten etwas gesagt, jetzt kommt er zurück, mit einem breiten Onkellachen, und steuert das Ehepaar hinüber, sie sind sehr willkommen, gewiss doch!
Der lebhafte Poldi geht voran, die beiden anderen folgen, durch den Gang zwischen den Tischen, nicht ohne ein klein bisschen Feierlichkeit. Die Musik spielt „Valencia“, und Paul Pauer ertappt sich dabei, lächerlicherweise, wie er im Tanzrhythmus dieser Melodie einhergeht, Claire auch, natürlich, es versteht sich bei ihr irgendwie von selbst. Sie gehen, sich selbst fortwährend sehend und beobachtend, Paul mit einem Gefühl wie eine Motte, die ins Licht fliegt und es weiss und es doch tut; durch eine lange Allee von Blicken gehen sie, an unbestimmten Gesichtern vorbei, von denen doch einige seltsam wohlbekannt scheinen. Natürlich, denkt Paul Pauer, die Filmstars! Und er sieht Claire an, was die nun sagt, es ist so ein komischfeierlicher Moment, etwas wie ein Einzug neuer Götter auf dem Olymp; es macht Paul Pauer auf eine absurde Weise stolz, und dabei hat er wieder eine unklare, ahnende Angst — —
„Valencia!“ macht das Saxophon. „Valencia — ah!“
*
An dem grossen Tisch, wo die Gesellschaft seines Bekannten Poldi Bergmann sitzt, findet Paul Pauer zu seinem Erstaunen, dass man von ihm weiss. Die Tischgesellschaft besteht aus lauter Filmleuten und ihren Frauen; es sind meistens nicht Schauspieler, sondern Regisseure, und lauter Europäer. Unter den Regisseuren der eine oder andere, dessen Namen jedermann kennt. Der Berühmteste von allen, Ernst Lubitsch, wird noch erwartet, er ist mit seiner Frau in der Hollywooder Arena, bei einem Boxmatch, und kommt wahrscheinlich später. Aber Gabriel Garisch ist da, Garisch von der „Ufa“, jetzt auch hierherengagiert, wie alle europäischen Regisseure, die den Amerikanern zu erfolgreich werden. Er ist der einzige von den Herren, der Abendkleidung angezogen hat, wahrscheinlich, weil er, ein Dunkler, Schlanker, im Smoking so gut aussieht; oder um eine Distanz zwischen sich und andere zu legen. Er ist, als eine Zelebrität, einer der ersten, mit denen die Pauers bekanntgemacht werden, er küsst der Dame die Hand und sagt zu Dr. Pauer, dass er sich freue, den Autor der „Sentimentalen Geschichte“ kennenzulernen. Paul blickt rasch auf; was weiss der von seinem Bändchen Lyrik? Aber sie wissen alle davon, oder vielmehr von einem niemals verfassten Roman, der „Sentimentale Geschichte“ heissen soll. Ein ganz junger Mensch mit flinken Kugelaugen löst das Rätsel, indem er, ein bisschen laut über den Tisch herüber, sagt, dass der heutige „Los Angeles Examiner“ die Ankunft Pauers angekündigt hat. „Dr. Power, der Gewinner des grössten europäischen Literaturpreises!“ Paul beginnt über die Informiertheit des Blattes zu staunen, nicht sehr freudig, bedenkt aber dann, dass dieses absurde Interview in dem grossen New-Yorker Abendblatt unschwer vor ihm nach Los Angeles gelangt sein kann, und dass man es in der Redaktion des „Examiner“ ausgeschnitten haben mag. Der ganz junge Mensch mit den flinken Augen ist so lang, dass man Knoten in seine Beine binden möchte, heisst aber doch immer nur „der kleine Cox“, wahrscheinlich, weil er einmal Cohn geheissen hat. Man erfährt, dass er, trotz seiner erheblichen Jugend, etwas sehr Majestätisches ist, nichts weniger als der „Casting Director“ der Mirador Films Corporation; das ist eine Grossmacht in Hollywood und in der Welt; der ungeheure Filmkonzern, in dessen Diensten jetzt auch Gabriel Garisch steht; ein Casting Director aber ist, scheint es, der Mann des Schicksals, der Herr über Tod und Leben, der Mensch, der in den Filmen die Rollen verteilt und der die Statisten aufnimmt. Neben dem kleinen Cox, der dennoch wirkt wie ein zu langer und lebhafter junger Dackel, sitzt eine gleich auf den ersten Blick sympathische Dame mit einem Doppelkinn, folglich keine Filmschauspielerin; ihr Mann ist Schauspieler, dieser Düstere, Hagere, Schwarze, Herr Georg Lupu. Paul, der einmal Filmkritiken geschrieben hat und überhaupt viel in die Kinos geht, erkennt ihn sofort, er kommt ja in so vielen Hollywood-Filmen vor, als ein romantischer Bösewicht. Immer ein Bösewicht. Im letzten Akt, vielleicht, kann ihn zur Not die Unschuld und Schönheit der Heldin rühren; in diesem Falle lässt er sie frei und schreitet melancholisch hinaus in die Nacht; oder er wird von seiner eigenen Bande aus Versehen erschossen und stirbt irrtümlicherweise, aber geläutert. Jetzt sitzt er da, mit einer österreichischen Virginier oder einer ähnlichen schwarzen Giftstange unter der Nase, die bemerkenswert ist, fast eine Cyrano-Nase; seine dickliche Frau hat die Gewohnheit, nach seiner Hand zu fassen und sie zu tätscheln; er spricht fortwährend, in einem geläufigen Deutsch, das doch ein wenig nach dem Balkan schmeckt, und mit einer wundervoll klangreichen Stimme, die viel zu edel aus der Bösewichts-Leiblichkeit kommt. Der beste Freund dieses Lupu ist Heller, Karl Erich Heller, ein Filmregisseur aus Berlin, eigentlich aus Wien, eigentlich aus Prag, eigentlich aus Brünn, vielleicht nicht bedeutend, aber nett, ein zierlicher, kleiner Mensch, manikürt und mit Brillantine geglättet und im Besitz der reizendsten kleinen Berliner Range von Frau, Lotte Heller, Lotto genannt, lauter Lächeln im schwarzen Bubikopf. Der, Karl Erich Heller, ist der beste Freund aller Menschen an dem Tisch und ganz besonders des Bösewichts Lupu, mit dem er fortwährend und hartnäckig streitet, über Nichtigkeiten, die nur mühsam zu einem Streitgrund gemacht werden können. Es ist noch Hjalmar Sverdrup vorhanden, der wohlbekannte norwegische Regisseur, der nun auch vom Sprechtheater zum Film geschwenkt ist; der hat eine merkwürdige blonde Eiswalküre zur Frau, die wie ein sonnenbestrahlter Gletscher wirkt, geheimnisvolle und kalte Ströme rauschen tief verborgen unter dem Gletscher. Und ein ungarisches Ehepaar, dessen Namen die Pauers nicht recht verstehen.
Sie alle sind nett gegen die Ankömmlinge, ohne Steifheit vom Anfang an; man kann sehen, dass Claire den Männern gefällt und den Frauen nicht unsympathisch ist, ausgenommen vielleicht die eisfunkelnde Frau Sverdrup. Paul Pauer wird mit einem gewissen Respekt behandelt, wegen der Notiz im „Examiner“; jedermann nimmt es von vornherein als gegeben, dass er nach Hollywood gekommen ist, um einen „Job“ bei einer Filmfirma zu suchen, oder vielleicht, um Filmideen zu verkaufen; weswegen kommt denn ein deutscher Dichter nach dem anderen nach Hollywood? Der kleine Cox, der schon seit fünf Jahren in Hollywood lebt, und wirklich schon ganz ein Amerikaner ist („ein Hundertfünfprozentiger“, sagt der stets sarkastische Lupu), — der kleine Cox verschleisst sogleich, über den ganzen Tisch herüber, hundertfünfprozentige Ratschläge: nur, um Gottes willen, nicht „highbrow“ sein, den Scenario-Departments kein Szenarium vorlegen, das zu europäisch ist, vergeistigt oder was, dann ist man in Hollywood unten durch! Er sagt: Hallywood. Sogleich wird Lupu wild: schön so, das hat er erwartet! So oft ein europäischer Verfasser herkommt — —
Das Deutsch Georg Lupus, in Klausenburg, Siebenbürgen, erlernt, ist ein bisschen pittoresk.
— — so oft ein europäischer Verfasser herkommt, und man darf noch hoffen, dass er sich nicht ganz verkaufen wird, sofort rät ihm irgendein Renegat, ein europäischer Yes-Man, wie sie sich in den Studios herumtreiben, dass er sich platt vor die Herren Amerikaner hinlegen soll, und nur nicht versuchen, etwas besser zu machen in dieser Idiotenanstalt, und immer yes sagen, zu jeder Narrischkeit, zu jeder ekelhaften Konvention, yes und yes — —
Der kleine Cox wird rot im Gesicht und ganz böse, und fängt an, Englisch zu sprechen, nein, American, und scharf; vielleicht würde es ein wirklicher Streit, wenn nicht Gabriel Garisch eingriffe, mit einer Ruhe, in der Autorität ist. Der kleine Cox verstummt sofort und schmollt dann auf seinem Stuhl; offenbar ist Gabriel Garisch jemand, den er zu schonen hat. Garisch sagt: „Wenn alle Stoffe des Herrn Dr. Pauer so sind wie die „Sentimentale Geschichte“, dann wird er gute Szenarios schreiben! Ich habe das reizend gefunden, die Grundidee der Sonette, den Kampf zwischen dem Theaterkritiker und der Schauspielerin, wie er sie als Schauspielerin bekämpft und als Frau gewinnt — —“
Er hat die Sonette wahrhaftig gelesen! Paul sucht vergeblich, ein bisschen Autorenvergnügen zu verhehlen, aber Claire wird furchtbar rot, sie fühlt sich entkleidet, dieser fremde Mann in Amerika weiss — —
Sein Blick ruht auf ihr, ein Blick, der ganz kalt und überlegen ist, ein bisschen unheimlich.
*
Die drei intimsten Freundinnen Claire Pauers, an die sie in der Folge lange Briefe über diesen ersten Hollywooder Abend schreibt (bevor noch die Korrespondenz einschläft, und die Freundschaft), können, auf der andern Seite des Ozeans, kaum den Eindruck gewinnen, dass nach der langen Eisenbahnfahrt an diesem Abend Claire besonders müde und erholungsbedürftig gewesen sein muss; es sieht eher so aus, als hätte ihr Mann sie gar nicht bewegen können, zu Bett zu gehen. Claire hat in der Cocoa-Nut Grove nur gegessen (sie erwähnt zweimal, wie nebenbei, einen Austern-Cocktail, als Hors d’Oeuvre) und ein bisschen getanzt; es waren, an den anderen Tischen, lauter berühmte Leute da, die Pola mit ihrem kaukasischen Fürsten, und Douglas Fairbanks, mit Mary Pickford. (Sie trägt Smaragden, nicht zu glauben!) Aber dann haben die Lubitschs telephoniert, dass sie nicht ins Ambassador kommen wollen, sondern höchstens ins Montmartre, das der Boxarena fast gegenüber liegt; also ist man dorthin gefahren, in vielen Autos, furchtbar weit wieder, und dort — — Claire berichtet, im Triumph, dass sie mit dem leibhaftigen Rod la Rocque einen Charleston getanzt hat, und Vilma Banky war mit an dem Tisch, wunderbar schön! Dann kommen in den Briefen an alle die drei intimsten Freundinnen Andeutungen auf etwas, was man in einem Brief nicht schreiben kann; sie waren noch irgendwo, in einer geheimnisvollen Privatwohnung — —
(Offenbar befürchtet die kleine Amerikafahrerin, dass in den Vereinigten Staaten, den trockenen, der böse Staatsanwalt darauf aus ist, Damenbriefe in einem schwarzen Kabinett zu entsiegeln, ob darin vielleicht gar was von Hjalmar Sverdrups „Alkohotek“ geschrieben steht, der altnordisch dekorierten Trinkstube in seinem Haus, in das er manchmal nächtliche Gäste mitbringt, um ihnen seine berühmte Schnäpsesammlung sachgemäss zu erklären, und dass die gletscherhafte Frau Sverdrup dort die unerhörtesten schwedischen Pünsche direkt an ihrer Seele gefrieren lässt.)
Nur an eine der drei Freundinnen, an die diskreteste, schreibt Claire Pauer (die Clara Dara gewesen ist, aber jetzt Paul Pauers Frau ist) noch etwas Geheimeres und Gefährlicheres als diese vorsichtige Andeutung auf den wirklichen Alkohol, den man gegen Ende dieser Hollywooder Nacht im Hause Sverdrup noch rasch geschluckt hat, polizeiwidrigerweise.
„Weisst du,“ schreibt Claire Pauer, „was ein ganz berühmter Filmregisseur, einer der allerersten, gleich am ersten Abend in Hollywood zu mir gesagt hat? Wenn Paul eine Ahnung hätte! Dass er noch nie eine Frau mit einem besseren Photographiergesicht gesehen hat, und dass er darauf brennt, mir eine grosse Rolle in seinem nächsten Film zu geben! Um Gottes willen, sage es niemandem, es ist doch alles nur so Unsinn, aber wenn Paul davon nur die leiseste Ahnung hätte — —“
Die diskreteste von Claires drei besten Freundinnen erzählt darauf den beiden anderen und, in der Tat, der halben Bevölkerung von Berlin, dass Ernst Lubitsch der Claire ein Engagement angeboten hat, mit einer unermesslichen Dollargage. Ernst Lubitsch ist in Claires Brief dreimal vorgekommen, aber Gabriel Garisch nicht ein einziges Mal. Dennoch hat er zu Claire von ihrem Photographiergesicht gesprochen, in einer Ecke des Sverdrupschen Hauses, mit seinem kalten und herablassenden Lächeln. Und er hat gesagt: „Ich weiss, dass Sie eine gute Schauspielerin sein müssen.“ — „Woher wissen Sie das?“ hat Claire gesagt, so froh, und am ganzen Leibe zitternd. „Aus der ,Sentimentalen Geschichte‘!“ hat er geantwortet.