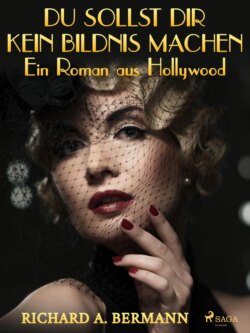Читать книгу Du sollst dir kein Bildnis machen - Ein Roman aus Hollywood - Arnold Höllriegel - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI.
ОглавлениеAm Sonntag vormittag tut Paul so, als ob er beim Auspacken des grossen Koffers helfen wollte, aber Claire kann den Unordentlichen nicht gebrauchen und schickt ihn fort. Er geht also spazieren, die Western Avenue hinauf, bis zur Kreuzung mit dem Hollywood Boulevard, und dann den Boulevard entlang, ein gewaltiges Stück; auf den Hügeln nördlich von dem Boulevard muss nach dem Stadtplan ein grosser Park sein; eine Parkbank in der wundervollen kalifornischen Sonne ist jetzt das richtige. Paul kommt langsam vorwärts; die grosse Geschäftsstrasse ist so voll von Autos. An jedem Strassenübergang muss man eine Minute warten, bis ein Klingelsignal ertönt, das bedeutet: „Stop!“ Zwanzig Sekunden später wieder ein Signal. Der metallene Arm eines Wegweisers, automatisch bewegt, weist in die Richtung, in der man jetzt weitergehen kann, und eine Schrift auf dem Wegweiser befiehlt: „Go!“ „Geh!“ Paul Pauer bummelt gemächlich und bleibt vor schönen Geschäften stehen, die heute am Sonntag geschlossen sind, deren Schaufenster aber offen bleiben: vor einem chinesischen Kuriositätengeschäft mit bunten Seiden und amüsanten Elfenbeinschnitzereien, und vor einem Geschäft, das Indianer-Kunstgewerbe vertreibt, rote und graue Wolldecken der Navajos, mit prachtvollen Mäandern durchwirkt, und hübsch dekorierte Töpfe und Körbe, in die das Bild des Donnervogels eingeflochten ist und der Schlange; dann wieder steht er ein wenig vor einem Fenster, in dem ein Quadrat aus mattem Glas aufgestellt ist; dahinter arbeitet ein kleiner Projektionsapparat, und auf der Glasscheibe erscheinen einzelne Szenen aus den sensationellsten Films, die jetzt eben in den Hollywooder Kinos laufen, der Reklame halber: zwei Minuten lang sieht man Douglas Fairbanks mit einem Degen zahllose böse Gegner niederfechten, in altspanischer Tracht, und dann sieht man wieder zwei Minuten lang das Lächeln der Gloria Swanson. An vielen Kinos kommt Pauer vorbei, am Hollywood Boulevard liegen so viele Kinos, wie anderswo an einer Hauptstrasse Tabakläden liegen mögen. Syd Graumans „Ägyptisches Theater“ sieht fast genau so aus wie der grosse Tempel von Karnak, als er protzig-funkelnagelneu war: mit einer grossen Sphinx in dem säulenumgebenen Vorhof, in dem an einem Springbrunnen Papyrusstauden wachsen; neben der Sphinx steht eine altertümliche, eiserne Kanone, die deutet auf den grossen Film hin, dessen Première bevorsteht: „Old Ironside.“
Dem Ägyptischen Kino gegenüber ist das „Hotel Hollywood“, in einem schönen Garten; hier muss, nach dem Stadtplan, der Boulevard überschritten werden, wenn man den Park erreichen will, und dann ― ― Paul Pauer, vor dem Hotel stehend, entfaltet den Plan, den er sich da gestern gekauft hat: eine sehenswerte Landkarte, mit Bildern mitten darin; hier ist Douglas Fairbanks gemalt, wie er mit seiner grossen mexikanischen Peitsche um sich schlägt, das bedeutet die Stelle, wo sich sein Studio befindet; und dort stehen Charlie Chaplins riesige Füsse auf dem Punkt der Karte, wo sein Atelier ist; und Erich von Stroheim stolziert steif einher, als preussischer Leutnant, und in einem See von Tränen residiert die sentimentale Lilian Gish. Jetzt hat Paul Pauer den Boulevard verlassen und steigt langsamer empor, durch stille Strassen, mit Palmen rechts und Palmen links, die vor lauter kleinen Villen stehen; von den Kronen der Palmen hängen alte, welke Zweige herab und bilden merkwürdige Vliese und Röckchen; eine Palme sieht aus wie ein Kamel mit einem zottigen Hals und eine wie ein Kannibalenprinz. Hier, denkt sich Paul, ist gut spazierengehen: es sollten Bänke da stehen, vor dem breiten Rasenstreifen, den hübschen, kleinen Gärten, in denen die roten Sternblumen der Poinsettia leuchten und die vielen, vielen Orangen; aber es ist keine Bank da, weil kein Spaziergänger da ist, kein einziger (ausser dem Deutschen, der da ganz ohne Auto durch diese Strasse wandert). Und später, da er auf asphaltierten Serpentinen das letzte Stück zu dem Park hinaufsteigt, bemerkt er staunend, dass auf Fussgänger überhaupt nicht gerechnet wird, die etwa zum Park gehen könnten; es ist kein Gehweg da neben der engen Autostrasse, durch die fortwährend Wagen rasen, aufwärts und abwärts.
Am Tor von Bernheimers Japanischem Garten muss Pauer einen Vierteldollar Entree bezahlen, die Frau an der Kasse sagt, dass er dafür sein Auto gratis am Eingang „parken“ darf, und macht grosse Augen, als er ihr gesteht, er habe kein Auto. — Im Garten wenigstens geht man zu Fuss, auf schmalen Wegen, die sich durch die Anlagen schlängeln; zwischen Miniaturbäumchen und winzigen Fushijamas und lackierten Tempelchen und Seen, so gross wie ein Taschentuch, an denen winzige Fischer aus Bronze angeln. Und weiter oben ist ein japanischer Pavillon, grellrot gestrichen; hier findet Paul seine Bank; es sitzt aber schon ein anderer da, ein junger Mensch ohne Hut, der die Aussicht zeichnet, nein, malt, mit Wasserfarben. Es ist wirklich die beste Bank, wenn man über die Parkbäume hinweg die Ebene sehen will, mit der unbegrenzten Stadt, die zahllosen niederen Häuser im Grünen, die Strassenlinien, und jenseits, o Freude, den stahlblauen Meeresspiegel, und auf der anderen Seite die rötlichen, kahlen Gebirge.
Paul Pauer, fassungslos, in einem Sonnenrausch, steht hinter der Bank und sieht diese Landschaft an, die jetzt sein werden soll. Sie erscheint ihm so schön, dass er nicht an sie glauben kann. Er sieht eine ungeheure Ebene, ganz grün und blühend, in einem silbernen Frühlingslicht und doch mit ein wenig herbstlichem Dunst darüber. Auf den hohen Sierras, im Hintergrund, ist hier und da schon ein wenig Schnee, ganz zart und fern gegen den Himmel gezeichnet.
Dem Meere entgegen gibt es noch einmal einige niedere Höhen, ganz kahl und trostlos; von ihnen ragen sonderbar hässliche hölzerne Türme auf. Ein jeder Hügel ein Golgatha. Paul Pauer errät, dass dort die Petroleumquellen sind; auch in der Ebene sieht er die Öltürme überall zwischen den Häusern der Riesenstadt.
O, was für eine Stadt! Paul Pauer hat, wie ein Europäer, hinter Amerikas rasch galoppierender Geographie weit zurück, dieses Hollywood für ein idyllisches Gartendörfchen gehalten, Los Angeles für eine mittlere Landstadt. Er findet, dass eine erhebliche Grossstadt weiss und leuchtend zu seinen Füssen liegt, Strasse an Strasse, Schachfeld an Schachfeld in den prachtvollen Gärten — und dass das nur eine mässige Vorstadt ist, gemessen an der unabsehbaren Stadt, die die Ebene füllt, zu den Bergen hinanklimmt, den Seestrand erreicht, am Horizonte verdämmert — — Eine locker gewobene Stadt, meist aus niederen, weissen Häusern mit flachen Dächern, bis auf einen Kern von hohen Bauten im Osten. Überall liegt Grünes dazwischen, oft weite Flächen; dann laufen doch dünne Strassenzüge durchs Unbebaute, von Häusern umsäumt und städtisch, die Vormarschstrassen der Riesenstadt. Hier, dort, überall bilden sich neue städtische Häusermassen; aber nirgends sind Bäume fern, Fruchthaine, stattliche Palmen. Zwischen den rosig schimmernden Felsengebirgen und der köstlich stahlblauen Fläche des Ozeans ist ein paradiesischer Garten, grenzenlos gross, zur heitersten Stadt geworden, unter einem Himmel, der gleichsam jubelt und Lieder singt, o leuchtendes Halleluja über der frohlockenden Erde!
*
Paul Pauer, in einem fast trunkenen Glücksgefühl (hier darf er nun leben, mit Claire!), setzt sich auf die Bank vor dem japanischen Pavillon, neben den Malermenschen; und unwillkürlich sieht er ihm in sein Blatt und wundert sich doch ein wenig: der Mann da pinselt nur immer Farbenflecke nebeneinander, kein Umriss ist da, kein Versuch wird gemacht, zu gestalten, ein Bild zu erzeugen; er pinselt nur immer farbige Flecke, die ineinander verlaufen, und meidet Linien, Winkel, als wären sie die leibhaftige Pest. Jetzt blickt er auf und lächelt freundlich; und fängt was zu reden an, in welcher Sprache? Paul versteht erst kein Wort, dann dämmert’s ihm auf, dass da ein Franzose mit ihm spricht, doch auf englisch. Paul, der das Englische liest und leidlich versteht, spricht Französisch viel leichter und redet den jungen Maler in dieser Sprache an; doch der beharrt in seinem merkwürdigen Englisch, mit dem Akzent stets auf der letzten Silbe; was kann man da machen? Erst als sich Paul jedes Wort rasch geschrieben denkt, versteht er; und es scheint ihm sogar ein gewähltes und reiches Englisch zu sein, das diese angenehme Stimme so elend ausspricht. Paul, im Romanischen Café geschult, erkennt leicht einen Bohemien; die dunklen Haare sind lang; am Kinn entwickelt sich ein weicher Christusbart; abwärts von dem sauberen Kragen und der netten Flatterkrawatte wird die Kleidung sehr schäbig. Jetzt hat Paul Pauer halbwegs gelernt, das Kauderwelsch zu begreifen, und ein Gespräch kommt in Gang; die beiden sind einander sofort nicht mehr fremd, erkennen einander als Brüder vom gleichen geheimen Orden. Die Namen werden wechselseitig genannt: der Fremde ist Christian Kreshna, oder jedenfalls wünscht er so geheissen zu werden, sprich, auf englische Art: Krischna. Ein Franzose, jawohl, gewesen. (Er muss damals doch wohl anders geheissen haben.) Aber jetzt ein Amerikaner. Durchaus und grundsätzlich. Gewisse Theorien, die er hat, können nur im Amerikanismus verwirklicht werden, hier in Amerika — —
Er spricht es: Emörrikà, mit dem Akzent auf der letzten Silbe.
Paul Pauer interessiert sich für das Blatt, das Herr Kreshna da malt; eine expressionistische Farbenstudie? — Das Wort „expressionistisch“ passt dem sanften Herrn Kreshna nicht, treibt ihn so nahe an Ärger, wie etwas diesen Verklärten treiben könnte. Er ein Expressionist? Er ist das Gegenteil von einem Expressionisten, ein MetaNaturalist, wenn Sie verstehen! — Paul Pauer, geduldig und mit der Welt in Frieden, versteht nicht, aber lässt sich’s erklären: die malerische Metaphysik des Christian Kreshna, nicht seine philosophische, wohlgemerkt, besteht darin, dass er statt der Gegenstände den Äther malt, den ihre Farben zum Schwingen bringen. Ein Baum, verstehen Sie, ist vielleicht ein Baum, quien sabe, aber gewiss eine Schwingung im Äther, die dem Gehirn, die den Sinnen die Vorstellung weiterleitet: ein Baum.
Nicht den Gegenstand zu malen, wie ein Naturalist, und nicht sein Gefühl davon, wie ein Expressionist, ist Kreshnas Absicht; er malt das Reale, das einzig wirklich Reale, das die heutige Wissenschaft kennt, die Ätherschwingung; er sieht sie freilich nicht, wie er den Baum sieht; allein, er kann sie rekonstruieren, aus dem Trugbild des Baums. Dies hier, das Blatt ist eine erste und flüchtige Farbenskizze zu einem grossen Gemälde: Der Äther über Hollywood, California. Das Stadtbild von Hollywood, könnte man sagen, als Farbenschwingung; ein kleiner Schritt näher zum „Ding an sich“, verstehen Sie, zur Befreiung vom sinnlichen Schein, doch konservativ und ohne die Welt der Natur zu negieren; der Äther ist auch Natur, ist die Wirklichkeit, und die Farben sind wirklich in ihm, sie müssen im Äther sein, bevor sie ins Auge gelangen, eben durch die Schwingung des Äthers. Das alles bedeutet, sagt Kreshna, gemalte Theosophie, den ersten Versuch einer neuen Kunst, die der Weltepoche des Krishnamurti entspricht, des wiederverfleischlichten Christus. Verstehen Sie?
Nicht ganz, Paul Pauer versteht diese neue Kunst noch nicht ganz, noch ihre theosophische Basis; aber es gibt keine neue Kunsttheorie, die ihn in Erstaunen versetzen könnte. Dafür hat man ihn schon im Romanischen Café geschätzt, er ist keiner, der seinem Bruder so leicht sagt: Du Narr! oder Racha! — Der Äthermaler spricht immer wärmer, persönlicher. Bald weiss Paul Pauer, was dieser Mann hier in Hollywood macht: er ist ganz einfach ein Extra, Statist beim Film. Vom Äthermalen allein kann man leider nicht leben; die Kunst ist noch unverkäuflich. Statt Kitschbilder für den Rahmenhändler zu malen, als Broterwerb, zieht Christian Kreshna es seufzend vor, in den Filmateliers seine Künstlermähne und seinen Kinnbart photographieren zu lassen, wenn ein Film, das passiert, auf dem Montmartre spielt und der Regisseur einen Künstlertypus an Kaffeehaustische setzen möchte; auch an biblischen Filmen hat Kreshna schon mitgewirkt. Das war die Glanzzeit, man hat ihm einmal, zwei Wochen hindurch, für seinen Christusbart fünfundzwanzig tägliche Dollars gezahlt; er nimmt auch fünf und ist froh, wenn er sie bekommt; doch manchmal gibt’s gar nichts, hungrige Monate lang.
„Verstehen Sie,“ sagt Kreshna, „ich will nichts vom Film als das bisschen Brot, ich filme, um nicht Steine zu klopfen. Ich hasse den Film, wie er ist, obgleich — — Was ist der Film? Zwischen die Wirklichkeit, die Ätherschwingung, und das lebende Menschenauge schiebt man den Apparat ein, die Maschine, die stupide, glotzende Linse, die das Auge fast teuflisch nachäfft — —“
„Verstehen Sie,“ sagt Christian Kreshna, und soweit sein anglo-französisches Klangkauderwelsch zu erfassen ist, versteht ihn Paul Pauer jetzt wirklich, „das war noch nie da, diese Spiegelverehrung, der Kulttanz vor der gläsernen Linse; sie ist das Auge des Molochs! Die bescheidenste Kunst, vorher, und der letzte, der dümmste Kitsch noch hat es versucht, den Spiegelschein der Dinge ein wenig zu deuten: so siehst du mit deinem Auge den Baum, — natürlich, das ist nur Betrug und Konvention deiner Sinne und mangelnde Schulung des noch halb tierischen Menschenauges. Sieh her, dieses Bild zeigt etwas mehr als den Baum, es zeigt den Baum und einen Gedanken an einen Baum! — —“
„Verstehen Sie?“ sagt Kreshna, „da kommt der Photograph und sagt zu dem nach Erlösung ringenden Menschenvolk: In deiner Pupille spiegelt sich ein Baum? Lass mich, mit meiner Maschine, mit der Pupille in meiner Maschine, den Baum für dich sehen, sie sieht ihn genau so wie du! — Aber es ist nicht wahr, die Pupille im Menschenauge lebt, und man kann sie belehren, sie kann doch einmal vom Trug und Schein erlöst werden, wie alles Lebende; die Linse der Kamera ist tot, sie ist das Auge des Todes selbst, denn der Tod, das ist ja der grosse Moloch — — Die Lüge, der Tod, das Spiegelbild, in der kalten Maschine so lange gewirbelt, bis es wie Leben erscheint — und daraus wird dann der Film. Er predigt die Welt, wie sie scheint; jede Kunst, eine jede, hat bisher die Welt gepredigt, wie sie ist, für die Ahnung der menschlichen Seele ist. Dabei fälscht er das Falsche, der Film; er lügt in die grosse Lüge noch etwas hinein, das Spiegelabbild des plumpen Scheins. Und einer lebendigen Menschenwelt, in der doch immer noch eine Ahnung war, ein Hang zur göttlichen Echtheit hinter dem Augenschein; der hält er den teuflischen Spiegel vor, das Abbild, das Gottes zweites Gebot verboten hat. Du sollst dir kein Bildnis machen! Das ist ein grosses Gebot! Ich weiss, was es bedeutet: das Abbild im Spiegel, in der photographischen Linse, das ist der Antichrist!“
„Das Bild im Spiegel“, sagt Christian Kreshna, „und der Film, der es aufbewahrt, diese Grimasse des geistlosen Scheins, ist die Bibel des Antichrists! Das Menschenantlitz, das eine Parabel des Geistes ist, die Maske des Göttlichen, tötet der Film. Er sagt den Männern und mehr noch den Frauen: das bist du! Kniee nieder vor deinem Spiegel und bete, das bist du. — Es ist natürlich nicht wahr, das eben bist du ja nicht, du bist es, minus der Seele und minus des Lebens, der Hoffnung!“
Der Äthermaler rollt sein Blatt zusammen, auf das er in wilden Farbenflecken die wirkliche Welt zu malen versucht hat, das Schwingen über den Dingen — und seufzt: „Sehen Sie, das alles weiss ich, und bin ein Extra in Hollywood, und diene selbst dem Moloch, und werde heute im Studio des Misters Cecil De Mille ängstlich warten, ob der dritte Hilfsregisseur zufällig dorthin blickt, wo ich stehe, unter hundert anderen, die ebenfalls hungrig sind, und ob er findet, dass ich vielleicht aussehe wie ein jüdischer Jüngling; er sucht, ich habe es erfahren, einen jüdischen Jüngling für eine Volksszene in dem grossen Christus-Film, den sie drehen; mindestens fünfzehn Dollars täglich durch eine Woche, es ist eine Art kleiner Rolle und wird besonders bezahlt. — Ja, Moloch hat mich beim Schopf, selbst mich, der ich ihn kenne; ich bin ein grosser Sünder!“
Er sagt es so kindlich zerknirscht und posiert dabei doch ein bisschen die christlich-kreshnasche Demut, dass Pauer sich vornimmt, ein wenig mehr von dem närrisch-gescheiten Menschen zu sehen, vielleicht kann man ihm gelegentlich helfen. Vor allem, denkt Paul, muss die Claire ihn manchmal ein bisschen vernünftig füttern, das braucht er. Er gibt ihm seine Adresse und lädt ihn ein, bald zu kommen.