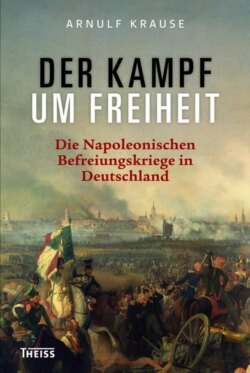Читать книгу Der Kampf um Freiheit - Arnulf Krause - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Der Weltgeist …“ – in Deutschland verehrt und gefürchtet
ОглавлениеDie Deutschen haben Napoleon von Anfang an und bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts letztlich mehr Zustimmung als Ablehnung oder Hass entgegengebracht. Erst nach der Reichsgründung von 1871 verblasste der Napoleonmythos. Deutsche Dichter nehmen sich des Phänomens während seiner Erfolge auf dem Italienfeldzug an. Man sah ihn als Verkörperung der Revolution, Genie und Naturgewalt. Als solche besingt ihn grenzenlos begeistert Hölderlin in einer Ode. „Göttlicher Bonaparte“ und „neuer Prometheus“ waren nur zwei der ihm zugedachten Namen, und bei Vergleichen musste es mindestens Alexander, Hannibal, Caesar oder Karl der Große sein. Dass selbst Vertreter der romantischen Bewegung vor Napoleons Aura nicht gefeit sind, belegen die Brüder Schlegel, Ludwig Tieck, der Theologe Schleiermacher und ebenso Ludwig van Beethoven, der Napoleon immerhin seine 3. Sinfonie „Eroica“ widmete (später soll er dies enttäuscht zurückgezogen haben). Sie alle sahen ihn als die Verkörperung des romantischen Künstlers par excellence, des Genies, das die Welt nach seinen Vorstellungen formt.
Vorübergehend genoss der damalige Erste Konsul in der Rolle als Friedensbringer große Verehrung. Mit den Friedensschlüssen von Lunéville und Amiens (1801/02) war endlich der Krieg in Europa vorbei, selbst der „Erzfeind“ Großbritannien schloss sich dem Frieden an. Dass diese Friedenszeit nur eine kurze Episode blieb, wusste niemand, und nur wenige ahnten es. Dem Friedensbringer widmet Hölderlin prompt einen Hymnus des „seligen Friedens“, gewidmet dem „Versöhnenden“. Ein anonym in Erfurt erschienenes Büchlein nennt „den Unerreichbaren und Unbegreiflichen“ „Stolz seines Zeitalters, des Jahrhunderts und des ganzen Menschengeschlechts“. Und der Göttinger „Revolutionsalmanach 1802“ betont in seiner Vorrede die hellen Aussichten des Lunéviller Friedens, die „großen Zuckungen von Parteiwut“ seien in Europa vorüber. Die „große Seele“ des „edlen Konsuls“ bürge für die Dauer „seines liberalen Benehmens und Handelns. Bonaparte war´s, der die Könige den Republiken näherte, die Anarchie erdrückte, den Frieden gebot, der der Republik, Europen, der Welt wohltätig war und bleibt.“ Der hochbetagte Johann Ludwig Wilhelm Gleim, Dichter der Aufklärungszeit, der bereits Friedrich II. besungen hatte, schreibt in Halberstadt ein Gedicht „An Napoleon, den Erhabenen zu St. Cloud“ und fordert den jungen Mann ehrfurchtsvoll auf: „Kröne dein Werk mit dem ewigen Frieden, erhabener Krieger!“
Napoleons Eingreifen in die deutschen Verhältnisse, seine letztendliche Liquidierung des alten Reiches, die Neuordnung der deutschen Kleinstaaten, Kriege und Repression führten wenige Jahre später zu einem Umschwung in seiner Einschätzung. Aber – falls dies ein Indikator für Verehrung ist – Goethe, Tieck, Jean Paul und die Schlegels waren vorübergehend nachweislich im Besitz einer Napoleonbüste. Und Goethe hielt ihm nach den legendären Zusammenkünften 1808 in Erfurt auf Dauer die Treue. Der Philosoph Hegel erblickte ihn leibhaftig in seiner Universitätsstadt Jena, kurz bevor er im Herbst 1806 die Preußen vernichtend schlug: „Den Kaiser, diese Weltseele, sah ich durch die Stadt zum Rekognoszieren hinausreiten; - es ist in der Tat eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier auf einem Punkt konzentriert, auf einem Pferd sitzend, über die Welt übergreift und sie beherrscht. Den Preußen … war freilich kein besseres Prognostikon zu stellen – aber von Donnerstag bis Montag sind solche Fortschritte nur diesem außerordentlichen Manne möglich, den es nicht möglich ist, nicht zu bewundern.“ Auch Goethe greift die Vorstellung der Anima Mundi in seinem Gedicht „Weltseele“ auf. Demzufolge erhebt sich Napoleon über die Normalsterblichen, verkörpert ein Prinzip; da wundert es dann nicht mehr, dass Hegel in regelrechten Napoleon-Enthusiasmus verfällt: „Keine größeren Siege sind je gesiegt, keine genievolleren Züge je ausgeführt worden.“ Hegels Kollege Friedrich Wilhelm Schelling, der bereits als Student am Tübinger Neckarufer einen Freiheitsbaum aufgestellt hatte, hofft schreibend aus München: „Die Revolution hat erst jetzt in Deutschland angefangen; ich meine nämlich, dass erst jetzt Raum wird für eine neue Welt.“ Der unmittelbare Kontakt mit dem Unvergleichlichen wirkt auf viele geradezu bezaubernd, so auf den preußischen Romantiker Achim von Arnim: „Vom grimmen Hass gegen Napoleon raffte mich sein Anblick fast zu einer Gottesfurcht gegen ihn hin.“
Der Umschwung sollte nicht ausbleiben. Spätestens nach 1806 sollte er Patriotismus im deutschsprachigen Raum entfachen. Hier nur so viel: Männer wie Ernst Moritz Arndt sahen in Napoleon das abgrundtief Böse, beschimpften ihn als dämonischen Geist. „Der neue Mongole und Sarazene aus Korsika“ war ein „erhabenes Ungeheuer“, die Personifikation des Bösen, Höllensohn, Feind Gottes und des Vaterlandes, den es noch zu schlagen galt. Gegen ihn, den vermeintlich Unbesiegbaren, sollten sich nicht zuletzt die Befreiungskriege richten.