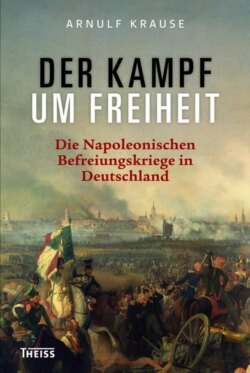Читать книгу Der Kampf um Freiheit - Arnulf Krause - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Dieses Land ist frei“
ОглавлениеGoethe hörte vor Valmy den französischen Kommandanten Kellermann seine Soldaten mit „Vive la nation!“ anfeuern. Diese antworteten mit Revolutionsliedern wie Ça ira, dessen rasantes Tempo den Soldaten der Verbündeten entgegenschallte. Das Lied war im Umfeld des Föderationsfestes in Paris entstanden, auf dem man im Juli 1790 dem Sturm auf die Bastille gedachte. Der Text kursierte in etlichen Varianten, gleich blieb immer der Appell, gleichsam der mutmachende Aufschrei der Nation: Ah, ça ira, ça ira, ça ira… „Ah, wir werden es schaffen …“. Ihm folgte ursprünglich die blutige Aufforderung des Pariser Straßenkampfes Les aristocrates à la lanterne… „Aristokraten an die Laterne …“. Und: Die Tyrannei werde ihren Geist aushauchen, die Freiheit triumphieren. Weder Adlige noch Priester werde es mehr geben, überall Gleichheit herrschen. Wir wissen nicht, welchen Text die Soldaten der Moselarmee im September 1792 sangen, aber dies oder Ähnliches schallte vom Mühlenhügel von Valmy den Preußen entgegen. Den gleichen Ton, den gleichen Geist verkörpert letztlich auch die Marseillaise, von Rouget de Lisle in Straßburg komponiert, als Kriegslied der Rheinarmee: „Auf, Kinder des Vaterlands, der Tag des Ruhms ist da … Zu den Waffen, Bürger! Schließt die Reihen, marschieren wir, marschieren wir! Das unreine Blut tränke unserer Äcker Furchen …“ Solcher Gesang weckte Begeisterung, mitreißende Gefühle, die jedoch auch in Wut und Hass umschlagen konnten. Bis heute symbolisiert er die große Revolution, die 1789 über Frankreich wie ein Dammbruch hereinbrach und ohne die es die deutschen Befreiungskriege nicht gegeben hätte. Dichtung und Symbole wie Freiheitsbäume, Kokarden und Jakobinermützen bündeln die Botschaften, bringen sie gewissermaßen auf den Punkt. Heute weiß man, dass die epochalen Ereignisse ihr zentrales Geschehen im Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 gefunden haben. Dies ist allerdings nur ein moderner Mythos und wie meistens verlief alles viel komplexer und darum komplizierter. In der französischen Monarchie bestand ungeheurer Modernisierungsbedarf, der von der Führungselite und vor allem König Ludwig XVI. schlichtweg verschlafen wurde. Ludwig herrschte von Gottes Gnaden mit absoluter Macht, die ihm in der Krise wenig nützte, weil das Land uneins war: Teilen des Adels missfiel die Vormacht des Hofes von Versailles, die Bauern – überwiegende Mehrheit der Bevölkerung – murrten über Frondienste, aber auch darüber, dass reiche städtische Bürger immer mehr Land aufkauften, das den Bauern verloren ging und sie zu Pächtern machte. Aristokraten mit langem Stammbaum wollten sich nicht mit Parvenüs abfinden, die in den Adelsstand erhoben wurden. Die kleinen Handwerker, Ladenbesitzer und Tagelöhner von Paris beschwerten sich über zu hohe „Lebenshaltungskosten“, reiche Unternehmer haderten mit der Wirtschaftsordnung, Intellektuellen wurden Absolutismus und Ständeordnung unerträglich …
Die Kritiker der herkömmlichen Ordnung hatten eine ausgefeilte Theorie einer besseren Gesellschaft. Zum Teil lehnten sie sich an den englischen Parlamentarismus an. In Frankreich gab es ein reges Schrifttum dazu: Der Baron de Montesquieu (1689–1755) entwickelte ein Modell der staatlichen Gewaltenteilung und verurteilte die absolutistische Monarchie als Despotismus. Der Pariser Notarssohn François-Marie Arouet, genannt Voltaire, (1694–1778) übte in seinen philosophischen Schriften, politischen Statements, Dramen und Romanen voller Esprit beißende Kritik an den bestehenden Verhältnissen, an Absolutismus, Feudalismus und katholischer Kirche. Sein Erfolg („das Jahrhundert Voltaires“) machte ihn gefährlich und brachte ihn vorübergehend in die berüchtigte Bastille – aber auch an den Hof des Preußenkönigs Friedrich II. Der vielreisende Genfer Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) schließlich konstatierte: Der Mensch ist frei. Diese und andere Aufklärer wie der Königsberger Immanuel Kant erstellten letztendlich eine Liste von Forderungen wie Freiheit, Gleichheit, Meinungsfreiheit, religiöse Toleranz und Achtung der Menschenwürde. Gegen das Gottesgnadentum des Monarchen etablierten sie das Naturrecht, das jedem Menschen von Natur aus zusteht.
Auch die leichte Muse nahm sich des Themas an und hinterfragte die gesellschaftlichen Ungleichheiten. Den berühmtesten Fall bot der Pariser Schriftsteller Beaumarchais (1732–1799) mit seiner turbulenten Komödie La Folle Journée ou le Mariage de Figaro „Der tolle Tag oder die Hochzeit des Figaro“, die, 1778 entstanden, nach jahrelanger Zensur erst 1784 öffentlich aufgeführt werden durfte (Mozart hat daraus 1786 seine Oper „Die Hochzeit des Figaro“ gemacht). Unter vielen Liebeswirren und Verwicklungen will der Kammerdiener Figaro die Zofe Susanne heiraten, sein tumber Herr Graf Almaviva fordert jedoch das ihm vermeintlich zustehende Recht der ersten Nacht. Nun, alles findet schließlich ein gutes Ende – allein der Graf steht als der Blamierte da. Für das, was die Zensur als anstößig nahm, mag ein Kommentar Figaros stehen: „Adel, Reichtümer, Ränge und Ämter! Wie Euch das doch so hocherhaben und mächtig macht! Und womit habt Ihr das alles verdient? Damit, dass Ihr gnädig zur Welt zu kommen geruhtet. Und das ist schon alles.“
Standesunterschiede und Privilegien lassen sich auch in Zahlen abbilden: Klerus und Adel dürften im damaligen Frankreich nicht mehr als 2 % der Bevölkerung ausgemacht haben, verfügten aber über 40 % des Bodens. Dazu kamen Steuerfreiheit und Ämterprivilegien wie die Offiziersstellen ausschließlich für Aristokraten. Da brauchte es nur noch wenige ungünstige Umstände, um das Ancien Régime in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen. Diese ergaben sich gegen Ende der 1780er-Jahre, als das Königreich vor dem Bankrott stand. Teure Kriege, immense Staatsausgaben für die Hofhaltung, mangelnde Steuereinnahmen wegen der Unzahl an Privilegien und eine stagnierende Wirtschaft verschärften die Situation. Dazu kamen die Unbilden der Natur: Missernten führten zu hohen Brotpreisen, im eisigen Winter 1788/89 fror sogar die Seine zu. Armut, Hunger und Elend breiteten sich aus, immer mehr verzweifelte Menschen strömten aus der Provinz nach Paris. Im Zentrum Frankreichs brodelte es, Gerüchte gingen um. Der Buchhändler Nicolas Ruault notierte voll Sorge: „Wenn der Hass noch einige Zeit im Volk gegen die privilegierten Stände lodert, wenn die Staatsmacht ihn nicht besänftigt oder löscht, dann steht zu befürchten, dass der besitzlose Teil des Volkes von Schloss zu Schloss rennt, um alles zu plündern und alles zu zerstören.“
Die ganze Monarchie wird in der Tat von Unruhe gepackt. Fortan bricht das alte System an vielen Orten zusammen. König Ludwig braucht Geld, das ihm die Generalstände bewilligen sollen, also die Vertreter des Klerus, des Adels und des 3. Standes, der die Bürger und damit die überwiegende Mehrheit umfasst. Dessen 578 Abgeordnete ergreifen gemeinsam mit klerikalen und aristokratischen Überläufern im Sommer 1789 die Initiative. Advokaten, Kaufleute, Gelehrte und andere Vertreter des Besitz- und Bildungsbürgertums setzen die Ideen der Aufklärung schlichtweg in die Tat um. Der politisch umtriebige Priester Emmanuel Joseph Sieyès gibt in einem weitverbreiteten Pamphlet die Losung vor: „Was ist der dritte Stand?“ – „Alles.“ – Was ist er bislang in der politischen Ordnung gewesen? – Nichts! – Was verlangt er? – Etwas zu sein.“ In der Frage, ob in den Generalständen nach Ständen (2:1 für das Ancien Régime) oder nach Köpfen (eine Mehrheit für Reformen) abzustimmen sei, schaffen die Abgeordneten des Dritten Standes durch einen sensationellen Beschluss klare Verhältnisse: Sie erklären sich am 17. Juni 1789 zur Nationalversammlung und erheben damit den Anspruch, die legitime Vertretung der Nation zu sein. Der zögerliche König erkennt nicht das Gebot der Stunde, er verpasst die Initiative zu Reformen, auch die Armee entgleitet seiner Kontrolle. Jean-Sylvain Bailly konstatiert als Präsident der Nationalversammlung: „Die versammelte Nation kann keine Befehle entgegennehmen.“ Am Ende muss sich Louis fügen. Er erkennt die Assemblée nationale an.
Während die Situation auf den Straßen zunehmend eskaliert und abgeschnittene Aristokratenköpfe auf Piken als schaurige Rachezeichen herumgetragen werden, während vielerorts neue Stadträte und Verwaltungen geschaffen und die bürgerliche Miliz der Nationalgarde für Ordnung sorgen soll, fährt die Nationalversammlung mit ihrer historischen Arbeit fort. Anfang August zerstört sie per Dekret „das Feudalregime vollständig“. Mit dieser wegweisenden Entscheidung schafft sie uralte Vorrechte der ersten beiden Stände ab: so von Bauern Fronarbeit zu fordern, die grundherrliche Gerichtsbarkeit, die Jagd- und Fischrechte, die Steuerfreiheit sowie den Kirchenzehnten. Drei Wochen später erfolgt die Erklärung der Menschenrechte als „natürliche, unveräußerliche und geheiligte Rechte der Menschen“. Artikel 1 verkündet: „Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es.“ Daraus resultieren die Rechte auf Freiheit, auf Eigentum, auf Sicherheit und auf Widerstand gegen Unterdrückung, aber auch auf freie Meinungsäußerung. Die Nationalversammlung hält fest, dass die Souveränität allein von der Nation ausgeht und nicht von einem absolut herrschenden Monarchen. Seiner nicht selten administrativen Willkür steht nun die Bestimmung gegenüber, Staatsbeamte müssten über ihre Amtsführung Rechenschaft ablegen. Nach dem traditionellen Parlamentarismus Großbritanniens und den gerade unabhängig gewordenen Vereinigten Staaten von Amerika mit ihrer Verfassung steht nun Frankreich, das die Vorstellungen des demokratischen Rechtsstaats erstmals fundamental umsetzt.
Mit seinen ständigen Umbrüchen stellt sich das Land in den nächsten Jahren wie ein Laboratorium der Moderne dar. Hier gehen die Forderungen der Menschenrechte mit blutigstem Terror Seite an Seite. Verschiedene Regierungssysteme lösen sich ab, im September 1791 wird die Verfassung einer konstitutionellen Monarchie erlassen, in der die Rolle des Königs schriftlich fixiert und nicht mehr göttlich legitimiert ist. Wiederum ein Jahr später, am 21. September 1792, wird die Republik ausgerufen und eine neue Zeitrechnung eingeführt. Der Bruch mit dem Ancien Régime gestaltet sich immer radikaler: Nach dem Verlust aller Privilegien wird nun der Priesterstand aufgehoben, schließlich soll die Verehrung der Vernunft den christlichen Glauben ersetzen. Die königliche Familie als Symbol der alten Ordnung wird zuerst zum Umzug von Versailles in das Tuillerienschloss mitten in Paris gezwungen. Nach einem Fluchtversuch wird sie im Temple gefangengesetzt. Zu guter Letzt erfolgt die Anklage wegen Hochverrats und die Hinrichtung Ludwigs XVI. und Marie Antoinettes im Lauf des Jahres 1793.
Die Radikalisierung drückt sich aus in der Bildung verschiedener Fraktionen und Parteien in der Nationalversammlung: Anfangs versteht man sich hier als Freunde der Verfassung, aber auch als Monarchisten, Wahrer aristokratischer Interessen und Republikaner. Mit der neuen Verfassung wird dann aus der Nationalversammlung die Legislative mit Unabhängigen, mit Konstitutionellen, mit Feuillants und Jakobinern, die sich wiederum in Radikale und gemäßigte Girondisten unterteilen. In der Republik vom September 1792 bilden die Gemäßigten der Mitte im nun Konvent geheißenen Parlament weiter die Mehrheit, während die Girondisten und die Jakobiner noch als kleine, radikale Randgruppe auftreten. Die Innenpolitik wird immer stärker von der äußeren Bedrohung durch die verbündeten Österreicher und Preußen sowie den Aktivitäten der adligen Emigranten geprägt. Hysterie und Verschwörungstheorien machen sich breit, denen letztlich auch der König zum Opfer fällt. Die Lage an der Front wirkt lange katastrophal, denn die fast ausschließlich aristokratischen Offiziere nehmen ihren Abschied oder gehen ins Exil und die freiwilligen Bürgersoldaten sind schlecht ausgebildet. Mangelnde Disziplin, Meuterei und Fahnenflucht sind an der Tagesordnung. Im Juli 1792 wird der nationale Notstand verkündet: „Bürger! Das Vaterland ist in Gefahr!“ Zehntausende werden zu den Waffen gerufen. Eine Volksarmee aus Bürgern, die mit Valmy und Dumouriez´ Sieg über die Österreicher bei Jemappes erste Erfolge verzeichnet. Mit dem Ende der alten Heerordnungen fallen auch die Unterschiede zwischen Berufssoldaten und Freiwilligen weg. Im August 1793 verpflichtet der Konvent mit der Levée en masse (Massenaushebung) alle unverheirateten Männer zwischen 18 und 25, sich für die Armee bereitzuhalten. Das ist der Beginn einer allgemeinen Wehrpflicht! Am Ende verfügt das revolutionäre Frankreich über eine Armee von 750.000 Mann, die zusehends besser ausgebildet und erfahrener ist. In dieser Armee gewinnt ein völlig anderes Offiziersbild an Bedeutung: Die Führungspositionen nehmen nicht mehr Adlige aufgrund ihrer Vorrechte ein, sondern Bürgerliche ganz unterschiedlicher Herkunft, die sich ihre Meriten durch hervorragende Leistungen verdienen müssen. Diese neue Bürgerarmee sollte schon bald ganz Westdeutschland und andere Gebiete besetzen.
Nur kurz sei auf die weitere Entwicklung der Republik eingegangen, die letztlich eine teils äußerst blutige, teils korrupte Entwicklung nahm – und damit für viele spätere Revolutionen einen Präzedenzfall bot: Der zunehmende Einfluss der Radikalen, insbesondere der Jakobiner, führt mit der vorübergehenden Unterstützung der Pariser Sansculotten, also von kleinbürgerlichen Handwerkern, Tagelöhnern, Arbeitern, zur Schaffung eines Revolutionstribunals und des so genannten Wohlfahrtsausschusses (Comité du salut public) als Exekutivorgan. Sie begründen die berüchtigte Schreckensherrschaft, in der der Terror (la terreur) zum Mittel der Regierungspolitik selbst wird. Die Folgen sind Willkür und Gesetzesbrechung, denen Tausende zum Opfer fallen. Mit der Hinrichtung des führenden Robespierre am 28. Juli 1794 endet diese Schreckenszeit. Der Konvent beschließt eine neue gemäßigte Verfassung mit zwei Parlamentskammern und einem fünfköpfigen Direktorium. Die letzten Jahre des 18. Jahrhunderts werden in Frankreich von äußeren Kriegen, innenpolitischen Unruhen und Staatsstreichen und ganz allgemein von korrupten Politikern geprägt. Dies alles ändert jedoch nichts: Das Ancien Régime gehört der Vergangenheit an. Eine neue, noch nie dagewesene Macht hat sich mitten in Europa etabliert.