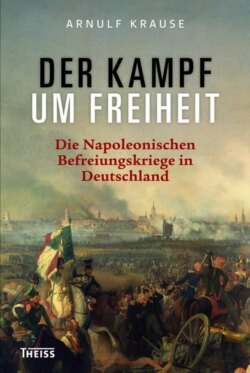Читать книгу Der Kampf um Freiheit - Arnulf Krause - Страница 7
Die Zeitenwende:
Von Valmy bis
Austerlitz Weltgeschichte im Morast
ОглавлениеPassans – cette terre est libre („Vorübergehende – dieses Land ist frei“): Diesen französischen Satz liest man auf einem Aquarell, das eine friedliche Landschaft mit sanften Bergen, lieblichem Flusstal und einem Dorf mit Kirchturm zeigt. Im Vordergrund erhebt sich ein so genannter Freiheitsbaum mit jener Inschrift, bekrönt von einer Jakobinermütze nebst Kokarde und den Farben Blau-Weiß-Rot. Das Idyll mit revolutionären Accessoires stammt aus der Hand Johann Wolfgang von Goethes. Das echte Vorbild hatte er am 25. August 1792 im Moseltal bei Trier gesehen, wohin er einen Ausritt unternommen hatte. Dabei war er erstmals auf das Symbol der neuen Freiheit gestoßen, das die französischen Revolutionäre und ihre Anhänger allenthalben errichteten. Sein Begleiter, der preußische Leutnant von Fritsch, berichtet über das Erlebnis: „Der Geheime Rat freute sich über dieses erste Zeichen und nahm sich vor, dem Prinz August v. Gotha eine Zeichnung davon zu liefern. Wir giengen nach Haus, er lud mich zum Essen und führte seinen Plan, eine Zeichnung zu liefern sogleich recht schön aus.“ Eine weitere Zeichnung schickte Goethe an seinen Dichterkollegen, den Gelehrten und Theologen Johann Gottfried Herder, der im heimatlichen Weimar der Stadtkirche und dem benachbarten Gymnasium vorstand und als Revolutionsfreund bekannt war.
Goethes erster hautnaher Kontakt mit der Revolution beginnt noch mit einem symbolischen Zeichen am Wegesrand – das folgende Vierteljahrhundert jedoch sollte Deutschland und Europa grundlegend verändern, ja die Moderne einläuten. Doch idyllisch ist es ganz und gar nicht, der Fortschritt wird begleitet vom Treiben auf den Schlachtfeldern, wo das Schreien der Sterbenden und Verletzten zu vernehmen ist. Auch der Dichterfürst aus Thüringen sollte dies bald erfahren. Doch werfen wir zuvor einen Blick zurück: Seit drei Jahren ereigneten sich in der ehrwürdigen französischen Monarchie ungeheuerliche Dinge: Der absolut und von Gottes Gnaden herrschende König war entmachtet, einer geschriebenen Verfassung und einer Volksvertretung unterworfen worden. Klerus und Adel hatten sämtliche Privilegien verloren und waren nicht selten massakriert worden. „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ und ähnliche Losungen wurden die Slogans der „Nation“, die gewissermaßen mit dem „Dritten Stand“ identisch war. Die europäischen Nachbarn hatten sich recht langmütig gezeigt gegenüber den Umwälzungen im Reich der Bourbonen. Strategisch war ihnen deren Schwächung gar nicht so unlieb. Aber die unberechenbaren Ereignisse in Paris konnten auf andere Länder übergreifen, und die Gattin Ludwigs XVI., Marie Antoinette, war immerhin eine Tochter der Kaiserin Maria Theresia. Insofern sahen die beiden Großmächte im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation – Österreich und Preußen – ihre Interessen berührt. Und obwohl sie alte Rivalen waren, verbündeten sie sich. Das revolutionäre Frankreich hatte die Königsfamilie mittlerweile gefangengesetzt und machte sich nun daran, Österreich am 20. April 1792 den Krieg zu erklären. Daraufhin marschierten österreichische und preußische Truppen los. Der Oberbefehlshaber der Letzteren, Herzog Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, ließ sich zu einem Manifest hinreißen, in dem er – wohl auch unter dem Einfluss französischer Emigranten – der Bevölkerung und der Hauptstadt Paris mit ernsten Konsequenzen drohte, sollte der königlichen Familie etwas zustoßen. In Frankreich war man empört.
Doch zurück zu Goethe: Dessen Fürst, der Herzog Carl August von Sachsen-Weimar, diente in der preußischen Armee als Generalleutnant und nahm am Feldzug teil. Goethe war als ziviler Begleiter und Beobachter geladen. Und so machte er sich Anfang August auf den Weg und verließ sein erst jüngst vom Herzog als Geschenk erhaltenes Haus am Frauenplan in Weimar. Das Hoftheater lässt er als dessen Leiter Hoftheater sein, man befindet sich ohnehin in der Sommerpause. Das Problem der Farbwirkung, das Studium der Schriften Newtons, die mehr oder minder offiziellen Aufgaben als Geheimrat lässt der vor 10 Jahren Geadelte zurück und folgt seinem Herzog in den Krieg. Mitte August verweilt er noch im elterlichen Haus in Frankfurt, dann geht es über Mainz nach Trier, das bereits etwas von einer Frontstadt an sich hat: „In Trier angelangt, fanden wir die Stadt von Truppen überlegt, von allerlei Fuhrwerk überfahren, nirgends ein Unterkommen; die Wagen hielten auf den Plätzen, die Menschen irrten auf den Straßen, das Quartieramt, von allen Seiten bestürmt, wußte kaum Rat zu schaffen.“ Ein Leutnant des 6. Preußischen Kürassierregiments, dessen Kommandeur Carl August war, verschafft ihm eine komfortable Unterkunft im Haus eines Kanonikus.
Die Preußen werden ihrem Ruf als beste Soldaten Europas gerecht: Sie marschieren in Lothringen ein, wo sie Longwy und Verdun besetzen. Goethe zieht mit ihnen und vermerkt die miserablen Verhältnisse. Vom Dauerregen ist der Boden aufgewühlt, im Lager hat sich alles in den Zelten „verkrochen, um vor dem schrecklichen Wetter kümmerlichen Schutz zu finden.“ Aber man macht sich Mut und hat Hoffnung. Die Feldkarten werden studiert, der Weg nach Paris scheint offen; niemand zweifelt, dass man in Châlon und Epernay schon bald den guten Wein der Champagne genießen wird. Und in der Tat überquert man die Pappelallee von Sainte-Menehould nach Châlon, ein Wegweiser zeigt die Richtung in die französische Hauptstadt. Nun befindet man sich bereits jenseits der Argonnen, jenes bewaldeten Hügellandes, das Lothringen von der Champagne trennt und als „Argonner Wald“ während des 1. Weltkriegs Schauplatz furchtbarer Kämpfe sein wird.
Noch 180 km bis Paris! Man nähert sich dem Dorf Valmy. Dort aber stehen die Franzosen. Am 19. September hatten sich die Revolutionstruppen unter dem Oberkommandierenden Dumouriez und Kellermann, zwei altgedienten Generälen, vereint, die sich der Revolution angeschlossen hatten. Kellermann hat sich mit seiner Artillerie bei der höher gelegenen Mühle von Valmy verschanzt, während die preußischen Infanteristen durch eine völlig durchnässte Talsenke vorrücken und sich bis auf wenige hundert Meter dem Feind nähern. Dann Stillstand – die Kanonen donnern, läuten eine neue Zeit des Krieges ein. Goethe steht an diesem 20. September 1792 fast mittendrin: „Von jeder Seite wurden an diesem Tage zehntausend Schüsse verschwendet, wobei auf unserer Seite nur 200 Mann und auch diese ganz unnütz fielen. Von der ungeheuren Erschütterung klärte sich der Himmel auf: denn man schoß mit Kanonen völlig, als wär‘ es Pelotonfeuer, zwar ungleich, bald abnehmend, bald zunehmend. Nachmittags ein Uhr, nach einiger Pause, war es am gewaltsamsten, die Erde bebte im ganz eigentlichsten Sinne, und doch sah man in den Stellungen nicht die mindeste Veränderung. Niemand wußte, was daraus werden sollte.“ Die Kanonenkugeln umfliegen den Beobachter, ihre erschreckenden Geräusche vergleicht er mit dem Brummen eines Kreisels, dem Gurgeln des Wassers und dem Pfeifen des Vogels. Der Erdboden ist derart feucht, dass die eingeschlagenen Kugeln sofort stecken bleiben. Goethe wird Zeuge eines martialischen Artillerieduells, an dem Soldaten zu Fuß und Kavalleristen unbeteiligt bleiben. Ein Glück für die Franzosen unter Kellermann; denn sie können ihre Stärke ausspielen, und das sind ihre moderneren und darum leistungsfähigeren Kanonen. Sie kaschieren die Schwächen ihrer Truppen, die zwar hochmotiviert, aber schlecht ausgebildet und mangelhaft ausgerüstet sind. Zudem fehlen Offiziere. So aber hält das revolutionäre Frankreich stand.
Goethe: „So war der Tag hingegangen; unbeweglich standen die Franzosen, Kellermann hatte auch einen bequemern Platz genommen; unsere Leute zog man aus dem Feuer zurück, und es war eben, als wenn nichts gewesen wäre. Die größte Bestürzung verbreitete sich über die Armee. Noch am Morgen hatte man nicht anders gedacht, als die sämtlichen Franzosen anzuspießen und aufzuspeisen, ja mich selbst hatte das unbedingte Vertrauen auf ein solches Heer, auf den Herzog von Braunschweig zur Teilnahme an dieser gefährlichen Expedition gelockt; nun aber ging jeder vor sich hin, man sah sich nicht an, oder wenn es geschah, so war es, um zu fluchen oder zu verwünschen … die meisten schwiegen, einige sprachen, und es fehlte doch eigentlich einem jeden Besinnung und Urteil.“ Damit ist der Vormarsch der Koalitionstruppen ins Herz Frankreichs gestoppt. Der Herzog von Braunschweig verzichtet auf weitere Angriffe und befiehlt den Rückzug. Die psychologische Wirkung, wie sie Goethe eindringlich beschreibt, war enorm. „Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus …“ will er seinen Begleitern am Abend jenes in der Tat denkwürdigen Septembertages gesagt haben. Und so war es: Die ganz überwiegend bürgerlichen Truppen hatten den aristokratisch geführten Verbündeten widerstanden. Von nun an blieb Frankreich trotz mancher Rückschläge 20 Jahre lang auf dem Vormarsch.
Das Kanonenduell von Valmy hatte „nur“ 500 Tote gefordert. Erheblich mehr Männer der Verbündeten starben auf dem beschwerlichen Rückzug, geschwächt vom Wetter, der feindseligen Haltung der lothringischen Bevölkerung und von Krankheiten wie der Ruhr, die sich unter den Zehntausenden ausbreitete.
Der aufmerksame Kriegsreisende aus Weimar notierte jedoch nicht nur die militärischen Gegebenheiten, er beobachtete auch die Menschen, ihr Verhalten, ihre Mentalität. Dabei fiel ihm auf, dass unter den Franzosen ein ungewohnter neuer Charakterzug festzustellen war, den er „republikanisch“ nennt (die Republik wurde in Paris am 21. September 1792 ausgerufen). Neben den genannten Symbolen und dem konfiszierten Kirchengut, darunter das alte, schon halb niedergerissene Zisterzienserkloster Chatillon l´Abbaye, ein „erstes Kennzeichen der Revolution“, zählte er die neue Gesinnung zu den auffallendsten Merkmalen des neuen Frankreich. Ein Beispiel: Nach der Übergabe Verduns zog dessen Kommandant Nicolas Joseph Beaurepaire offenbar den Tod vor: „… bedrängt von der bedrängten Bürgerschaft, die bei fortdauerndem Bombardement ihre ganze Stadt verbrannt und zerstört sah, konnte [er] die Übergabe nicht länger verweigern; als er aber auf dem Rathaus in voller Sitzung seine Zustimmung gegeben hatte, zog er ein Pistol hervor und erschoß sich …“ Auch wenn die Todesumstände des Offiziers nicht ganz klar sind, für Goethe war es „ein Beispiel höchster patriotischer Aufopferung“. Sie war weit entfernt von den üblichen Kabinettskriegen des 18. Jahrhunderts, bei denen sich adlige Offiziere mit einem festen Ehrencodex gegenüberstanden. Hier zählte nicht mehr der Stand, sondern die Nation als höchster Wert, der man sich als Patriot hinzugeben hatte.
Im besetzten Verdun hatte Goethe ein weiteres Erlebnis: „Die Preußen zogen ein, und es fiel aus der französischen Volksmasse ein Flintenschuß, der niemand verletzte“ – nach anderen Quellen soll Leutnant Graf Henckel von Donnersmarck getötet worden sein –, „dessen Wagestück aber ein französischer Grenadier nicht verleugnen konnte noch wollte. Auf der Hauptwache, wohin er gebracht wurde, hab ich ihn selbst gesehn: es war ein sehr schöner, wohlgebildeter junger Mann, festen Blicks und ruhigen Betragens. Bis sein Schicksal entschieden wäre, hielt man ihn läßlich. Zunächst an der Wache war eine Brücke, unter der ein Arm der Maas durchzog; er setzte sich aufs Mäuerchen, blieb eine Zeitlang ruhig, dann überschlug er sich rückwärts in die Tiefe und ward nur tot aus dem Wasser herausgebracht.“ Solche Menschen erfüllte eine tief greifende Weltanschauung, der Glaube an eine Sache, für die sie trotz schlechter Ausrüstung und mangelnder Kenntnisse eintraten. Zweifelsohne ein Grad bislang ungewohnter Radikalisierung. Die österreichischen und preußischen Truppen hatten – nicht zuletzt wegen der falschen Einschätzung aristokratischer Emigranten in Deutschland – sich eine andere Gesinnung erhofft und mit dem massenhaften Überlaufen der französischen Truppen gerechnet.
Der Feldzug verlief entgegen der Erwartungen, und Goethe begleitete die Truppen auf ihrem Rückzug. Anfang November 1792 erlebte er eine stürmische Bootsfahrt auf der Mosel nach Koblenz, von wo aus er über Düsseldorf und Kassel nach Weimar zurückkehrte. Dort beschäftigte er sich mit einer antiken Gemmensammlung, las Platon, kritisierte Newton und nahm sein gewohntes Leben wieder auf. Die Notizen und Aufzeichnungen seiner Kriegsfahrt nach Frankreich nahm er Jahrzehnte später wieder hervor und schuf daraus die „Campagne in Frankreich“. Wie sein großes Werk „Dichtung und Wahrheit“ ist es bearbeitete, reflektierte und stilisierte Autobiographie, gleichwohl verbergen sich darin unmittelbar authentische Eindrücke. Allein der berühmte Ausspruch vor Valmy dürfte doch erst später hinzugefügt worden sein. Damals um 1820 stand unumstößlich fest, dass fast 30 Jahre früher etwas Neues seinen Anfang genommen hatte, das Europa und Deutschland für immer verändern sollte.