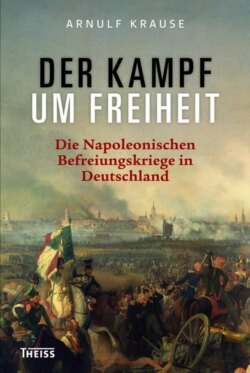Читать книгу Der Kampf um Freiheit - Arnulf Krause - Страница 9
1789: Deutschland vor der Revolution?
ОглавлениеIn den turbulenten Sommertagen des Jahres 1789 befanden sich etliche Deutsche an der Seine, darunter auch der Pädagoge und Journalist Joachim Heinrich Campe (1746–1818). Campe war den Idealen der Aufklärung zugetan und befand sich in Begleitung seines ehemaligen Schülers Wilhelm von Humboldt. Er soupierte nicht nur mit dem berühmten Grafen Mirabeau, einem der führenden Revolutionspolitiker, sondern verfolgte auch die bewegenden Sitzungen der Nationalversammlung. Nach Deutschland schickt er eine eindringliche Beschreibung der erstürmten Bastille, „diesen Ort des Schreckens und des Jammers, den so manche heiße Träne benetzte, und aus dessen tiefen und finsteren Gräben, mit lebendigen Leichen angefüllt, so mancher, von Angst und Verzweiflung erpreßter Seufzer durch ungeheure Felsenwände und eiserne Türen zum Vater der Menschen, zum Richter der Könige und um Rache schrie … Genug von dieser gräulichen Burg, an deren Stelle sich nun bald ein herrliches Denkmal der Erlösung von den Schrecknissen der willkürlichen Alleingewalt erheben wird!“ Auch der damals 23-jährige Wilhelm von Humboldt, später Gelehrter, Diplomat, führender preußischer Bildungsreformer und Mitbegründer der Berliner Universität, begrüßt die Zerstörung der Bastille: Für ein schönes Gebäude des Mittelalters sei diese zwar bedauerlich, aber „… unentbehrlich. Es war das eigentliche Bollwerk des Despotismus, nicht bloß als ein grauenvolles Gefängnis, sondern auch als eine Festung, die ganz Paris beherrscht.“
Campe zeigte sich wie jedermann beeindruckt vom quirligen Leben in der Metropole, das im kleinstädtisch geprägten Heiligen Römischen Reich deutscher Nation seinesgleichen sucht. Die revolutionäre Unruhe erfasst alle Schichten und macht auch vor den Ärmsten nicht halt, die ebenso wie der Bürgerliche über die politischen Verhältnisse diskutieren: „Das Erste, was uns außer der hin und her wallenden Volksmenge auffällt, sind die vielen, dicht ineinandergeschobenen Menschengruppen, welche wir teils vor vielen Haustüren, wo entweder Bürgerwachstuben sind oder Bäcker wohnen, teils vor allen denjenigen Häusern erblicken, deren Mauern mit Affichen beklebt sind. Diese Bekanntmachungszettel sieht man in allen Straßen, besonders an den Seitenwänden aller Eckhäuser und an dem ganzen Gemäuer aller öffentlichen Gebäude auf den Quais und sonstigen freien Plätzen … Vor jedem mit dergleichen Zetteln beklebten Hause sieht man ein unendlich buntes und vermischtes Publikum von Lastträgern und feinen Herrn, von Fischweibern und artigen Damen, von Soldaten und Priestern, in dichten, aber immer friedlichen und fast vertraulichen Haufen versammelt …“ Überall werden Broschüren und fliegende Blätter feilgeboten, und zahlreiche „Colporteure“ rufen Titel und Hauptinhalt aus. „Auffallend und befremdend für den Ausländer ist hier der Anblick ganz gemeiner Menschen aus der allerniedrigsten Volksklasse, zum Beispiel der Wasserträger … auffallend … welchen warmen Anteil sogar auch diese Leute, die größtenteils weder lesen noch schreiben können, jetzt an den öffentlichen Angelegenheiten nehmen …“ (so in einem Brief vom August 1789).
Schilderungen aus dem revolutionären Paris sind Legion, die meisten bewerten die Ereignisse mit mehr oder weniger großer Sympathie. Zunehmende Gewaltorgien und die blutige, auch Deutsche bedrohende Schreckensherrschaft sorgten indessen für wachsende Distanzierung. Zu den nur knapp der Guillotine Entgangenen gehörte auch ein norddeutscher Adliger namens Graf Gustav von Schlabrendorf (175–824), dem ein ansehnliches Vermögen ein unabhängiges Leben ermöglichte. Am Vorabend der Revolution kam der Sohn eines preußischen Ministers nach Paris, wo er sich schließlich angesichts geringer werdender finanzieller Mittel in einer bescheidenen Unterkunft unweit des Louvre einmietete. In dieser dürftigen, mit Büchern vollgestopften Behausung empfing der „Diogenes von Paris“ während der Revolutionsjahre und in der napoleonischen Zeit deutsche Besucher, darunter so illustre Namen wie Wilhelm und Alexander von Humboldt, der spätere Reformer und preußische Staatskanzler Karl August von Hardenberg sowie Freiherr vom Stein oder die Romantiker Achim von Arnim und Friedrich Schlegel. Der exzentrische Sonderling galt als erste Adresse für jeden, der sich im revolutionären Paris umtun wollte. Er verkörpert den unmittelbaren persönlichen Zugang zu den französischen Geschehnissen, stellte gleichsam einen „Pool“ unzähliger Nachrichten dar.
Aber auch ohne ihn war man in den zahlreichen deutschen Staaten mit ihren Haupt-, Residenz- und Universitätsstädten zumeist bestens informiert. Dazu trugen nicht nur Reiseschilderungen, sondern auch Publikationen aller Art und nicht zuletzt die Presse bei – darunter auch französische Blätter. Und in den aufgeklärten Kreisen stießen die Ereignisse im Nachbarland auf große Resonanz, – ohne dass die Massen Schlösser und Residenzen gestürmt und Fürsten oder andere Aristokraten gemeuchelt hätten. Nein, in den deutschen Ländern lief dies anders ab: In Hamburg-Harvestehude beispielsweise versammelten sich am 14. Juli 1790 etwa 80 Personen in einem privaten Garten, um des Sturms auf die Bastille zu gedenken. Alle, auch Gäste aus Amerika, England und Schweden, trugen Trikoloren, es wurde Salut geschossen und bis in den Abend hinein gefeiert. Unter den Gästen weilte der knapp 70-jährige Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803), als Schöpfer des Epos „Messias“ damals Deutschlands berühmtester und ehrwürdigster Dichter. Klopstock feierte das Vorbild Frankreichs in antikisierenden Oden: „Frankreich schuf sich frei. Des Jahrhunderts edelste Tat hub Da sich zu dem Olympus empor … Unsere Brüder, die Franken; und wir? Ach, ich frag umsonst: ihr verstummet, Deutsche!“ so in der Ode „Kennet euch selbst“.
Feier und Zustimmung auch andernorts: In Weimar nennt Christoph Martin Wieland die „ehrlichen und … etwas stupiden Germanier(n)“, noch zu unreif, um die französischen Verhältnisse „unbefangen“ zu beurteilen. Und in Tübingen pflanzen die Theologiestudenten und späteren Geistesgrößen Friedrich Hölderlin, Friedrich Wilhelm Schelling sowie Georg Friedrich Wilhelm Hegel einen Freiheitsbaum auf der Neckarwiese. Umso größer war ihr Erschrecken über die Gewaltexzesse und die blutige Wendung der Revolution. Ein alter Herr wie Klopstock, der in seiner „deutschen Gelehrtenrepublik“ die Utopie eines friedlichen von der Bildungselite geführten Staatswesens entworfen hatte, konnte sich nur mit Schaudern abwenden. Die meisten andern taten es ihm gleich. Der junge Göttinger Student Wilhelm Heinrich Wackenroder, der in seinem kurzen Leben im Kreise der Frühromantik eine Rolle spielte, stellt eine Ausnahme dar: „Die Hinrichtung des Königs von Frankreich hat ganz Berlin von der Sache der Franzosen zurückgeschreckt; aber mich gerade nicht. Über ihre Sache denke ich wie sonst. Ob sie die rechten Mittel dazu anwenden, verstehe ich nicht zu beurteilen, weil ich von dem Historischen sehr wenig weiß“ – so im März 1793 an den befreundeten Ludwig Tieck.
Werfen wir einen Blick auf die beiden Weimarer Klassiker, die den Zeitgenossen noch nicht als vorherrschende Meinungsbildner galten, deren Urteile man aber gleichwohl zur Kenntnis nahm. Friedrich Schiller etwa zeigt sich in Briefen eher verhalten, nimmt die ihm zugetragenen Anekdoten von der Seine eher humorvoll, als dass er in ihnen Ereignisse von weltgeschichtlicher Tragweite sieht. Durchaus erfreut nimmt er den Umstand, dass ihm in Paris durch die Nationalversammlung im August 1792 das Bürgerrecht verliehen wird. Die Versammlung ehrte damit Nichtfranzosen, unter anderem auch Klopstock oder den Schweizer Pädagogen und Sozialreformer Pestalozzi, die „Arm und Wachsamkeit der Sache des Volkes gegen den Despotismus der Könige geweiht hatten“. Der so Geehrte – M. Gille, Publiciste allemand – hatte sich als Verfasser der „Räuber“ und von „Kabale und Liebe“ als Feind des fürstlichen Despotismus gezeigt. Die Hinrichtung des Königs ließ ihn gleichwohl auf skeptische Distanz gehen. Durch den Bezug der Pariser Tageszeitung Moniteur durchaus gut informiert, hatte er dessen Prozess aufmerksam verfolgt und noch im Dezember 1792 gegenüber dem Freund Körner eine ebenso naive wie illusorische Idee: „Kaum kann ich der Versuchung widerstehen, mich in die Streitsache wegen des Königs einzumischen … und ein deutscher Schriftsteller, der sich mit Freiheit und Beredsamkeit über diese Streitfrage erklärt, dürfte wahrscheinlich auf diese richtungslosen Köpfe einigen Eindruck machen.“
Bekanntlich wurde nichts daraus, und Schiller scheint sich, angewidert von den Schrecken der Tagespolitik ins Reich der Ideen zurückgezogen zu haben. Einem Freund rät er: „… lassen Sie vor der Hand die arme, unwürdige und unreife Menschheit für sich selbst sorgen. Bleiben Sie in der heitern und stillen Region der Ideen …“. Der befreundete Arzt Friedrich Wilhelm von Hoven schreibt in seinen Erinnerungen dazu bestätigend: „Von dem französischen Freiheitswesen … war Schiller kein Freund. Die schönen Aussichten in eine glücklichere Zukunft fand er nicht. Er hielt die französische Revolution lediglich für die natürliche Folge der schlechten französischen Regierung, der Üppigkeit des Hofes und der Großen, der Demoralisation des französischen Volks, und für das Werk unzufriedener, ehrgeiziger und leidenschaftlicher Menschen, welche die Lage der Dinge zur Erreichung ihrer egoistischen Zwecke benutzten, nicht für ein Werk der Weisheit.“
Schillers Einschätzung bezeugen seine „Briefe über die ästhetische Erziehung“, die er Herzog Friedrich Christian von Augustenburg (1765–1814) schrieb, der sich später als Reformer im dänischen Staatsrat hervortat und Schiller mit einer Pension unterstützte. Unter dem Datum des 13. Juli 1793 stellt er Frage, ob es „nicht außer der Zeit“ sei, „sich um die Bedürfnisse der ästhetischen Welt zu bekümmern, wo die Angelegenheiten der politischen ein so viel näheres Interesse darbieten?“ Denn „eine geistreiche, mutvolle, lange Zeit als Muster betrachtete Nation hat angefangen, ihren positiven Gesellschaftszustand gewaltsam zu verlassen und sich in den Naturzustand zurückzuversetzen, für den die Vernunft die alleinige und absolute Gesetzgeberin ist.“ Im Abwägen zwischen praktischer Politik und Idealismus kommt er zu dem Schluss: „… wäre der außerordentliche Fall wirklich eingetreten, dass die politische Gesetzgebung der Vernunft übertragen, der Mensch als Selbstzweck respektiert und behandelt, das Gesetz auf den Thron erhoben und wahre Freiheit zur Grundlage des Staatsgebäudes gemacht worden, so wollte ich auf ewig von den Musen Abschied nehmen und dem herrlichsten aller Kunstwerke, der Monarchie der Vernunft, alle meine Tätigkeit widmen. Aber dieses Faktum ist es eben, was ich zu bezweifeln wage. Ja, ich bin so weit entfernt, an den Anfang einer Regeneration im Politischen zu glauben, dass mir die Ereignisse der Zeit vielmehr alle Hoffnungen dazu auf Jahrhunderte benehmen.“ Und dann fällt Schiller ein Urteil von großer Tragweite: „… Der Versuch des französischen Volks, sich in seine heiligen Menschenrechte einzusetzen und eine politische Freiheit zu erringen, hat bloß das Unvermögen und die Unwürdigkeit desselben an den Tag gebracht und nicht nur dieses unglückliche Volk, sondern mit ihm auch einen beträchtlichen Teil Europens, und ein ganzes Jahrhundert, in Barbarei und Knechtschaft zurückgeschleudert. Der Moment war der günstigste, aber er fand eine verderbte Generation, die ihn nicht wert war und weder zu würdigen noch zu benutzen wusste.“ Das Menschengeschlecht sei der „vormundschaftlichen Gewalt“ noch nicht entwachsen, das „liberale Regiment der Vernunft“ sei zu früh. Denn die vermeintlich befreiten „niederen Klassen“ zeigten nur ihre „rohen gesetzlosen Triebe“. Was zu dem Fazit führt: „Es waren also nicht freie Menschen, die der Staat unterdrückt hatte, nein, es waren bloß wilde Tiere, die er an heilsame Ketten legte.“ Und auch die „zivilisierten Klassen“ enttäuschten in der historischen Situation, bewiesen sie doch „Erschlaffung“, „Geistesschwäche“ und „Versunkenheit des Charakters“. Die Konsequenz: „Politische und bürgerliche Freiheit bleibt immer und ewig das heiligste aller Güter, das würdigste Ziel aller Anstrengungen und das große Zentrum aller Kultur – aber man wird diesen herrlichen Bau nur auf dem festen Grund eines veredelten Charakters aufführen, man wird damit anfangen müssen, für die Verfassung Bürger zu erschaffen, ehe man den Bürgern eine Verfassung geben kann.“
Also auf zur „Veredlung der Denkungsart“, am besten ohne jeden staatlichen Einfluss. Weil für die Aufklärung des Verstandes schon so viel getan worden sei, müsse nun „die Veredlung der Gefühle und die sittliche Reinigung des Willens“ vorangetrieben werden. Zur Charakterbildung sei die „ästhetische Kultur“ am besten geeignet, die Kunst müsse Ideale haben, „die ihr unaufhörlich das Bild des höchsten Schönen vorhalten“. Und was sei dafür besser geeignet als die „unsterblichen Muster des griechischen Genius“? Fazit: Erst bessere Menschen sind reif für eine bessere Verfassung. Die politische Praxis war Schiller darum vergällt. Für seine Zeitschrift „Die Horen“ warb er um Beiträge mit der Forderung, man möge auf alles verzichten, „was sich auf Staatsreligion und politische Verfassung bezieht. Man widmet sich der schönen Welt zum Unterricht und zur Bildung, und der gelehrten zu einer freien Forschung der Wahrheit und zu einem fruchtbaren Umtausch der Ideen …“
Goethe hingegen erlebte bekanntlich nicht nur die unmittelbaren Folgen des Geschehens in Frankreich, er setzte sich auch stärker damit auseinander. In den „Gesprächen mit Eckermann“ spricht er am 4. Januar 1824 davon, wie selten man mit ihm in „politischen Dingen“ zufrieden gewesen sei. Als Beispiel greift er auf „Die Aufgeregten“ zurück, ein politisches Drama von 1793. Darin vertritt ein Dorfchirurg die neuen Ideale, was zu Unruhe führt. Verständige Adlige glätten die Wogen und sorgen für Ruhe. Eine gerade aus Paris zurückgekehrte Aristokratin verkörpert Goethes Ideal: „Sie hat sich überzeugt, dass das Volk wohl zu drücken, aber nicht zu unterdrücken ist, und dass die revolutionären Aufstände der unteren Klassen eine Folge der Ungerechtigkeiten der Großen sind. Jede Handlung, die mir unbillig scheint, sagt sie, will ich künftig streng vermeiden, auch werde ich über solche Handlungen anderer, in der Gesellschaft und bei Hofe, meine Meinung laut sagen. Zu keiner Ungerechtigkeit will ich mehr schweigen, und wenn ich auch unter dem Namen einer Demokratin verschrieen werden sollte.“ Diese Gesinnung hält Goethe für respektabel. „Sie war damals die meinige und ist es noch jetzt.“
Fünf Jahre nach der Campagne in Frankreich schrieb Goethe ein Werk, das auch auf die Folgen der Revolution eingeht. Das bürgerliche Epos „Hermann und Dorothea“ singt in antiken Formen und Anspielungen das Hohelied des Bürgers, allerdings des deutschen Bürgers, nicht des französischen citoyen. Die Handlung spielt in der Gegenwart, und damit im Krieg am Oberrhein. Flüchtlinge aus dem Elsass kommen in die Nähe eines friedlichen Städtchens. Hermann, der Sohn eines wohlhabenden Gastwirts, verliebt sich in das Flüchtlingsmädchen Dorothea. Dem Vater allerdings ist an einer besseren Partie gelegen; es kommt zum Streit. Erkundigungen bringen den besten Eindruck Dorotheas, die sogar sich und andere Frauen vor französischer Soldateska mutig schützte. Nachdem der schüchtern-ungeschickte Hermann als Werber für Missverständnisse sorgt und der Pfarrer schließlich alles aufklärt, findet das Paar zueinander. Eine Idylle, die gleichwohl Kommentare zum Zeitgeschehen bietet. Sprechen die Vertriebenen von den enttäuschten Hoffnungen der Revolution, gemahnt der Pfarrer an das Gute im Menschen. Hermann kommt am Schluss des Epos das letzte Wort zu:
„Wir wollen halten und dauern, Fest uns halten und fest der schönen Güter Besitztum. Denn der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend gesinnt ist, Der vermehret das Übel und breitet es weiter und weiter; Aber wer fest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich. Nicht dem Deutschen geziemt es, die fürchterliche Bewegung Fortzuleiten und auch zu wanken hierin und dorthin. Dies ist unser! so laß uns sagen und so es behaupten! Denn es werden noch stets die entschlossenen Völker gepriesen, Die für Gott und Gesetz, für Eltern, Weiber und Kinder Stritten und gegen den Feind zusammenstehend erlagen.“
Was sich vordergründig als rein poetische Szene ausnimmt, ist prägende Selbstbeschreibung des und der Deutschen. So mochte er leben in seiner arkadisch-friedlichen Landschaft zwischen den Ufern des Rheins und den Höhen des Schwarzwalds. Welch Unterschied zu den Ereignissen in Frankreich, von denen aus dem August 1792 die Worte eines Nationalgardisten erhalten sind: „Wir sind starr vor Erschöpfung – weniger deswegen, weil wir zwei Nächte unter Waffen verbracht haben, als wegen der Seelenschmerzen … Himmel! Wieviel Blut und Tränen kostet den Franzosen die Freiheit!“
Nun erhoben sich allerdings in Deutschland auch andere Stimmen, die durchaus zu einer revolutionären Erhebung bereit waren, letztlich aber regional begrenzt blieben. Zu kleineren Unruhen kam es unter anderem in Mainz, Sachsen und Schlesien. Doch hier handelte es um lokale Erhebungen, an denen nur Handwerker und Bauern beteiligt waren. Gerade im Rheinland griff man dabei gern auf Kokarden und die Bezeichnung „Patriot“ zurück, was aber eher als „modisches Politdekor“ zu verstehen ist. Der revolutionären Ideologie fühlten sich hingegen etliche Jakobinerclubs zugetan, die unter anderem in Hamburg sowie in Rheinhessen und der Pfalz gegründet wurden. Andernorts, so in Koblenz, Bonn, Köln und Aachen begründeten sich die Cisrhenanen, die 1797 unter der französischen Besatzung sogar die Gründung einer unabhängigen Cisrhenanischen Republik anstrebten, die sich links des Rheins von Kleve bis Speyer erstrecken sollte. Wie das aussehen sollte beschreibt der Präsident des Koblenzer Distriktbüros der cisrhenanischen Föderation im August 1797 in einem Brief an einen Sympathisanten an der Mosel: „Ich freue mich sehr, einen Compatrioten mehr und Mitarbeiter in der guten Sache an Ihnen zu haben. Suchen Sie alle Patrioten in Trarbach und Ihrer Gegend auf und engagieren die, welche Sie gut und tauglich finden zum mitarbeiten, das ist: die Leute zu Freyheit stimmen, ihnen die Vortheile davon, die Nachtheile der alten Regierung (wenn sie allenfals zurückkäme) erklären. Wir würden einen eigenen Freystaat machen, nicht unter Frantzosen stehen, selbst unsere Obern wählen, die Domainen, die Güter der Stifter, Abteyen etc. würden an die Leute verkauft, um die Schulden zu zahlen, die Zehnden hörten auf, kein Krieg würde mehr seyn, der Handel blühen, bessere Gerechtigkeit seyn, kein Hofstaat zu ernähren, mässige Abgaben, die Religion würde gehandhabt, nur die unnützen Müssiggänger von Canonicis würden abgeschafften werden. Die Leute sollten sich nur frey erklären, in Ruhe ohne Blut Freyheitsbaum aufpflanzen, sich Repraesantanten wählen, daß diese sich verbinden und mit der Republik Frieden schließen, um der coujonade des Kriegs endlich loßzuwerden und gantz frey zu seyn.“
Aus den hehren Plänen einer rheinischen Friedensrepublik, der übrigens auch der später berühmte Publizist Joseph Görres anhing, wurde nichts. Frankreich hatte die besetzen Gebiete okupiert. Der fünf Jahre währende Eroberungsverzicht zugunsten eines Selbstbestimmungsrecht der Völker war nicht mehr gültig. Die französische Republik wollte den Völkern die Freiheit bringen, notfalls auch mit Gewalt. Aus den Cisrhenanen wurden „Neufranken“.
Eine erste deutsche Republik war vorübergehend bereits 1792 in Mainz gegründet worden. Nach Valmy hatte sich nämlich im Herbst des Jahres die Situation dramatisch verändert: Nun marschierten die Revolutionstruppen voran, besetzten unter der Führung des Generals Adam-Philippe de Custine die Pfalz, Rheinhessen und sogar Frankfurt. Die barocke Residenzstadt Mainz streckte trotz ihrer starken Befestigungswerke am 21. Oktober die Waffen. Kurfürst Friedrich Karl Joseph von Erthal war schon drei Wochen vorher geflohen; mit ihm der ganze Hofstaat und tausende Mainzer Bürger. Aber Custines Regiment blieb moderat. Der General erließ einen „Aufruf an die gedrückte Menschheit in Deutschland im Namen der Frankenrepublik von Adam Philipp Custine, fränkischem Bürger und General der Armeen der Republik“, in dem er Verbrüderung und Freiheit anbot. Die Deutschen sollten wählen: entweder Freiheit oder Despotie. Ansonsten ließ er die ehemals kurfürstlichen Behörden weiter ihre Arbeit tun, ließ die Rechts- und Besitzverhältnisse unangetastet. Die Mehrheit der zurückgebliebenen Mainzer Bürger hätte sich wohl für die Rückkehr des nicht unbeliebten Erzbischofs und Kurfürsten entschieden, hatten schließlich Handwerker und Kaufleute von seiner Hofhaltung profitiert. Von der beruflichen Freiheit und der Abschaffung der Zünfte hielten sie wie auch andernorts überhaupt nichts. Sie fürchteten um den Verlust ihres Einflusses.
Der Kurfürst hatte sich seit seiner Wahl vor 18 Jahren als überzeugter Anhänger der Aufklärung erwiesen und dies insbesondere mit seiner Kirchen- und Bildungspolitik gezeigt. Aufgelassenes Klostergut führte er beispielsweise der Universität Mainz zu. Kein Wunder also, dass sich am Rhein eine Schicht herausbildete, die zutiefst den Ideen der Aufklärung verpflichtet war und die Ideale der Revolution in Frankreich begeistert aufgriff. Im Schutz der französischen Truppen entwickelte sich ein Jakobinerclub, der sich schließlich im kurfürstlichen Schloss zur Bildung einer „Gesellschaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit“ zusammenfand. Von den 25.000 Mainzer Einwohnern zählte er immerhin 500 zu seinen Mitgliedern, darunter Professoren, Studenten, aber auch kleinbürgerliche Handwerker und Kaufleute. Vier Mal in der Woche traf man sich und diskutierte in deutscher Sprache, eine Sitzung fand auf französisch statt. Der Umgangston lehnte sich an die Pariser Vorbilder an, dementsprechend sprach man sich mit dem bürgerlichen egalitären „Du“ an. Was folgte, war die Errichtung eines Freiheitsbaums auf dem Marktplatz und die zunehmende Anwendung der revolutionären Attribute, darunter eine Freiheitstafel wie die von Goethe an der Mosel aquarellierte. Die von Mainz drohte jedoch dem Zerstörer der freiheitlichen Ordnung mit dem Tod.
Den Mainzer Jakobinern trat mit dem Gelehrten und Schriftsteller Georg Forster (1754–1794) ein berühmter Zeitgenosse bei, ein Gebildeter und Vielgereister, der mit seinem Vater zwanzig Jahre zuvor den englischen Entdecker James Cook auf dessen zweiter Südseereise begleitet hatte. Der Erzbischof selbst hatte den Professor als Universitätsbibliothekar nach Mainz geholt. Doch der fühlte sich auf Dauer in den eher beengenden Verhältnissen nicht wohl. Auch ein aufgeklärter Fürst herrschte immer noch über ein feudales System. Forster begrüßte darum die Revolution von Anfang an und trat schließlich im November 1792 der Jakobiner-Gesellschaft bei, deren führender Vertreter er wurde. An den Berliner Buchhändler Voß schreibt er in dieser Zeit: „Es ist eine der entscheidenden Weltepochen, in welcher wir leben. Seit der Erscheinung des Christentums hat die Geschichte nichts Ähnliches aufzuweisen. Dem Enthusiasmus, dem Freiheitseifer kann nichts widerstehen.“ Das, was als „Mainzer Republik“ in die Geschichte einging und erste späte Würdigung in Deutschland erfuhr, ist rasch erzählt: Unter Custines wohlwollender Aufmerksamkeit entsteht eine Administration, die unter anderem die französische Verfassung in Auszügen übersetzen lässt und versucht, deren Grundsätze auf Mainzer respektive rheinhessische Verhältnisse anzuwenden. Dazu gehört die Aufhebung der Leibeigenschaft, aber auch der Befehl, alle Wappen als Relikte des Ancien Régime von Mainzer Häusern zu entfernen. Das politische Leben am Rhein spiegelt das große Geschehen an der Seine gewissermaßen en miniature. Heftige Debatten kreisen um die Frage, wohin man will; aus rheinhessischen und Pfälzer Gemeinden wollen sich deren Jakobiner den Mainzern anschließen. Aus dem Rechtsrheinischen machen sich subversive Elemente breit, die von Revolutionsgegnern unterstützt werden. Dieser Widerstand ist im Großen und Ganzen unblutig und trifft zuerst den Freiheitsbaum, der umgelegt wird. Gleichzeitig soll das System seine demokratische Legalisierung erfahren: Im Februar 1793 finden die Wahl des Bürgermeisters und der sechs Abgeordneten des gesetzgebenden „Rheinisch-Deutschen National-Convents“ statt. Die Begeisterung darüber hält sich in Grenzen, denn von 10.000 Wahlberechtigten geben nur 300 ihre Stimme ab. Im folgenden Monat fällt der Convent den Entschluss, sich Frankreich anzuschließen. Georg Forster ist unter den drei Abgeordneten, die den Antrag in Paris vorbringen. Dort gibt man dem zwar statt, aber diese Entscheidung wird von den militärischen Ereignissen überholt: Im Juli desselben Jahres müssen die Franzosen Mainz räumen. Angeführt von den Preußen rücken die Verbündeten in der Stadt ein. Forster kann nicht mehr zurück und stirbt in Paris eines natürlichen Todes.
Die Mainzer Republik hat damit ein rasches Ende gefunden. Eine längere Belagerung mit heftigen Bombardements war dem vorausgegangen. Wiederum war Goethe als Augenzeuge dabei. Er beobachtet den Abzug der französischen Truppen, die immer noch stolz und selbstbewusst die Marseillaise anstimmten – „diesmal aber nahmen sie das Tempo ganz langsam, dem schleichenden Schritt gemäß, den sie ritten.“ Auf die zurückbleibenden Jakobiner wird nun Jagd gemacht – es kommt zu Übergriffen und Lynchszenen. Die einziehenden Offiziere schützen sie zumeist, viele werden jedoch in Festungshaft genommen und wenn nicht zu Todesstrafen, doch zu hohen Zahlungen verurteilt. Am 26. Juli 1793 betritt Goethe das zurückeroberte Mainz: „… dort fanden wir den bejammernwertesten Zustand. In Schutt und Trümmer war zusammengestürzt, was Jahrhunderten aufzubauen gelang, wo in der schönsten Lage der Welt Reichtümer von Provinzen zusammenflossen und Religion das, was ihre Diener besaßen, zu befestigen und zu vermehren trachtete. Die Verwirrung, die den Geist ergriff, war höchst schmerzlich, viel trauriger, als wäre man in eine durch Zufall eingeäscherte Stadt geraten. Bei aufgelöster polizeilicher Ordnung hatte sich zum traurigen Schutt noch aller Unrat auf den Straßen gesammelt; Spuren der Plünderung ließen sich bemerken in Gefolg innerer Feindschaft. Hohe Mauern drohten den Einsturz, Türme standen unsicher …“ Ein Jahr später sollten die französischen Heere zurückkehren und Deutschland links des Rheins zwanzig Jahre in Besitz nehmen. Sie bescherten dem Land damit eine lange Friedenszeit, die blutigsten Schlachten und schlimmsten Zerstörungen fanden in Zukunft im Herzen Deutschlands statt.
Was Deutschland damals vor mehr als 200 Jahren war, soll uns im Folgenden noch beschäftigen. Zunächst gilt einmal, dass hier nach 1789 eine Revolution wie in Frankreich ausblieb. Der Gründe dafür sind viele, manche ganz offensichtlich, andere umstritten und diskutiert. Die staatliche Verfassung bietet eine erste plausible Erklärung: Während Frankreich ein geeintes auf den absolutistisch herrschenden Monarchen hin orientiertes Königreich war, existierten auf dem Gebiet des heutigen Deutschland und weit darüber hinaus hunderte mehr oder weniger souveräne Territorien, an deren Spitze der Kaiser in Wien stand. Nur über die Habsburger Länder herrschte er, ansonsten musste er sich vor allem seit der Mitte des 18. Jahrhunderts mit dem aufstrebenden und ehrgeizigen Preußen auseinandersetzen. Die anderen größeren und kleineren Länder (manchmal als das „dritte Deutschland“ bezeichnet) sahen sich zwischen diesen beiden Großmächten nicht selten in der Gefahr „zerrieben“, sprich annektiert, zu werden. Zur territorialen Zersplitterung dieses seit dem frühen Mittelalter bestehenden Sacrum Romanum Imperium, des „Heiligen Römischen Reiches“, kam die konfessionelle in katholische und protestantisch-reformierte Christen und Regionen hinzu. Auch die Lebensumstände der Adligen, Bürger und Bauern zwischen Ostpreußen (das formal gar nicht zum Reich gehörte) und dem Breisgau, zwischen Flandern und Mähren (damals Territorien des Heiligen Römischen Reiches, obwohl ihre Bewohner keine Deutschen waren) gestalteten sich sehr uneinheitlich. Im Verhältnis zu Großbritannien, aber auch Frankreich galt das riesige Reich im Herzen Europas wirtschaftlich unterentwickelt. Mancherorts kam es wegen lokaler Missstände durchaus zu Unruhen unter Bauern und Handwerkern, diese hatten aber keinen Umsturz des Systems vor Augen. Die Aristokraten waren stark mit den vielen Fürstenhöfen verbunden, was ihre Macht insgesamt schmälerte. Das Bürgertum hingegen, jener „Dritte Stand“ Frankreichs, der dort die Revolution ins Rollen brachte, hatte noch kein überstarkes Selbstbewusstsein, war es doch in den Städten der alten Zunftordnung verbunden. Die Ideen der Aufklärung kursierten in Deutschland vor allem in den Gelehrtenkreisen, denen man hier besondere Anerkennung entgegengebrachte. Auch zahlreiche Fürsten standen den modernen Lehren des 18. Jahrhunderts recht offen gegenüber – an ihrer Spitze der Preußenkönig Friedrich II. und Kaiser Joseph II. von Österreich, aber auch ein kleinstaatlicher Herrscher wie Markgraf Karl Friedrich von Baden-Durlach. An ihren Höfen fand der darum so genannte Aufgeklärte Absolutismus seinen Niederschlag, der Dienstadel und Bildungsbürger in die Pflicht des Staates nahm und den Fürsten als „ersten Diener seines Staates“ sah. Der Reformeifer mancher Fürsten war beachtlich, beispielsweise verkündete Joseph II. bereits 1781 die Gleichheit aller vor dem Gesetz und der badische Markgraf Karl Friedrich hob zwei Jahre später die Leibeigenschaft auf. Ebenso garantierte das auf Friedrich II. zurückgehende Preußische Landrecht von 1791 an bürgerliche Freiheit und Gleichheit. Kaiser Joseph trug sich in Wien sogar mit dem Plan, sämtliche Privilegien abzuschaffen – womit er sich jedoch nicht durchsetzen konnte. Allerdings erschienen derartige Vorrechte vielerorts nicht so ungerecht wie in Frankreich, wurden sie doch zum Teil auch auf bürgerliche Akademiker ausgeweitet. Zudem nahm man den Adel durchaus in die Pflicht, wurde auch er mehr oder weniger strengen Leistungsansprüchen unterworfen. Insofern sahen nicht wenige Bürger den Fürsten als ihren Hüter und Förderer an, weil Universitäten kräftig unterstützt wurden, was wiederum das tonangebende Bildungsbürgertum stärkte. Dieses verdiente sich sein Geld nicht in Handel und Gewerbe, sondern im Staatsdient. Ein zweifellos gewichtiger Grund, weshalb in den deutschen Territorien keine breite bürgerliche Oppositionsbewegung entstand.
Gleichwohl waren absolute Fürsten, auch wenn sie sich weniger auf das Gottesgnadentum denn auf ihre Pflicht beriefen – Herrscher ohne Kontrolle. Trotz der Gewährung bürgerlicher Freiheits- und Gleichheitsrechte war es noch ein weiter Weg zur politischen Teilhabe der Untertanen.