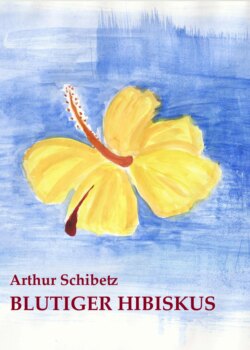Читать книгу Blutiger Hibiskus - Arthur Schibetz - Страница 6
Kapitel 3
ОглавлениеWie befürchtet musste Jeremy am Flughafen erneut die ganze Sicherheitsprozedur über sich ergehen lassen. Er fragte sich, welchen Sinn und Zweck ein eigenes Insel-Terminal hat, wenn man eh die gleichen Sicherheitsbestimmungen brauchte wie bei Flügen zum Festland oder gar ins Ausland. Offenbar hatte sich die Angst vor Krankheit und Terrorismus in der Gesellschaft schon so stark ausgebreitet, dass sich sogar die einzelnen Inseln dieses Staates als vor den anderen zu schützenden Einheiten sahen.
Es gab einen Moment, da lief es Jeremy kalt den Rücken herunter, als ihm einfiel, dass auch Sam nach Maui wollte. Doch diesmal blieb er ihm erspart. Offenbar hatte Sam bereits einen früheren Flug genommen.
Jeremys Flug verlief ereignislos. Er dauerte nur etwas mehr als eine halbe Stunde. Da reichte die Zeit nicht mal, um Snacks und Tomatensaft zu verteilen. Was Jeremy bedauerte, denn er hatte immer noch Hunger. Auf der anderen Seite kam ihm der Flug in der kleinen Turboprop-Maschine auch zu lang vor. Das Flugzeug war ihm zu eng, zu klapprig und zu laut. Und dann war auch noch die Landung auf dem Flughafen in Kahului sehr hart.
Er hasste es so sehr zu fliegen, dass er sich im Vergleich dazu auf das erneute Durchlaufen der Sicherheitsprozedur fast schon freute. Einschließlich der in L.A. war das schon seine vierte an diesem langen Tag, der durch den Wechsel der Zeitzonen 26 Stunden hatte. Es war mittlerweile fünf Uhr am Nachmittag, in L.A. müsste es schon dunkel gewesen sein. Und Jeremy hatte noch immer nichts gegessen.
In der Ankunftshalle angekommen schaute er sich erneut nach einer Essensgelegenheit um. Er war dabei so sehr auf dieses Ziel fixiert, dass ihm beinahe der wohl auffälligste Anblick entgangen wäre: Mitten in der Halle stand ein etwa fünfzigjähriger übergewichtiger Asiate, gekleidet in ein Hawaiihemd und um seinen Hals hingen lose ein Mundschutz und eine Schutzbrille. Über seiner linken Schulter war eine Art Halfter angebracht, an dem sein Funkgerät hing. Jeremy hätte ihn ja gerne ignoriert, hätte dieser nicht ein Pappschild mit der Aufschrift „HAGEN“ vor seinen Körper gehalten. Jeremy seufzte kurz und ging dann auf den Mann zu.
„Sergeant Oshiro?“, fragte er ihn.
„Hagen? Jeffrey Hagen?“
„Jeremy.“
„Jeremy!“, wiederholte Oshiro und schüttelte ihm überschwänglich die Hand. „Ich bin John. Willkommen auf Maui. Hast du Durst?“
„Um ehrlich zu sein, ich habe seit heute Morgen nichts mehr gegessen.“
„Was magst du? Steaks? Burger? Fisch?“
„Das ist mir ziemlich egal. Hauptsache ich habe endlich was im Magen.“
„Ich habe Lust auf Pizza. Magst du Pizza? Ich kenne da einen guten Italiener. Ist das dein ganzes Gepäck?“
„Ja“, antwortete Jeremy, wobei er nicht den Eindruck hatte, dass es John auf die Antwort ankam, denn noch während der Frage drehte sich dieser um, um zu gehen.
„Commissioner Morris erwähnte eine Dienstwohnung für mich…“
„Ja, die ist hier in Kahului. Nicht weit weg von hier. Willst du erst dahin und deine Sachen ablegen? Ich habe den Schlüssel dafür.“
„Nein, erst was essen“, antwortete Jeremy.
Sie verließen das Flughafengebäude. Hier draußen wehte ein starker Wind. John griff in seine Hosentasche, nahm einen Autoschlüssel heraus und öffnete damit einen alten Dodge, der direkt vor der Tür stand, mitten im Halteverbot.
„Darf man hier stehen?“, wollte Jeremy wissen.
„HPD, Spezialeinheit“, antwortete John, zog sein Hemd leicht hoch und zeigte auf seine Marke, die vom Hemd verdeckt an seinem Gürtel hing. „Wir dürfen hier alles.“
John öffnete den Kofferraum, damit Jeremy seinen Koffer hineinlegen konnte.
„Honolulu PD? Gibt es hier auf den Inseln nur ein Departement?“
„Nein, hier ist das MCPD zuständig. Maui County. Aber wir unterstehen direkt Commissioner Morris. Dadurch gehören wir zum HPD.“
Sie stiegen ins Auto und fuhren los.
„Wir sind auch im ganzen Staat mit Sonderbefugnissen ausgestattet. Aber ansonsten arbeiten wir mit dem MCPD zusammen, wir haben uns dort auch immer zu melden und dort kriegst du dann auch deine Marke und deine Dienstwaffe. Und ein kleiner Tipp: Stell dich gut mit Captain Iz. Der hasst unsere Einheit. Er ist ein Arschloch wie alle anderen auch vom MCPD, aber er hat leider das Sagen, und wenn wir ihm blöd kommen dann legt er uns schon mal Steine in den Weg.“
„Iz?“
„Was?“
„Du sagtest ‚Captain Iz‘?“
„Ach so. Captain Stephen Kamaka. Wir nennen ihn Iz, nach Israel Kamakawiwo’ole. Wegen des Namens. Kamaka. Das ist schon fast die Hälfte von Kamakawiwo’ole.“
Jeremy senkte seinen Kopf und hielt sich seine linke Hand an die Stirn. Wieder einer, der das Offensichtliche erklären musste. Das hatte er jetzt nicht verdient, dachte er sich. Wieder erwischte er sich dabei, dass er sich Sam zurückwünschte.
„Da sind wir. Marco’s. Der hat die beste Fleischbällchen-Pizza auf der ganzen Insel. Das ist wie in Italien.“
Jeremy war sich nicht sicher, ob es in Italien solche Pizzen gab. John fuhr auf einen Parkplatz vor dem zweistöckigen Gebäude, in dessen Erdgeschoss sich das Restaurant befand. Die beiden stiegen aus dem Auto aus und gingen hinein.
„Wie geht’s, Marco?“, rief John in den Raum hinein. Jeremy konnte nicht erkennen, dass er eine bestimmte Person dabei ansprach. „Eine Pizza wie immer und ein Bier bitte. Ist mein Tisch frei?“
Ein Bediensteter des Lokals kam auf die beiden zu. Aber John wartete nicht auf ihn, sondern ging zielstrebig auf seinen Stammtisch zu. Jeremy fand dieses Verhalten etwas befremdlich. Er hätte so etwas vermutlich nie selbst gemacht, aber nach kurzem Zögern folgte er John. Sie setzten sich an einen Tisch in der hinteren Ecke des Raums.
„Erzähl mal was über dich“, sagte John.
„Da gibt’s nicht viel zu erzählen.“
„Natürlich nicht. Komm schon. Ich bin Bulle, genau wie du. Und ich merke, wenn mir was verschwiegen wird. Und du, mein Freund, kommst mir vor, als würdest du eine Menge verschweigen. Geschieden?“
Jeremy nickte.
„Sind viele hier. Auch weibliche Kollegen. Natürlich gibt’s auch viele, die Ehe und Arbeit unter einen Hut kriegen. Aber die Scheidungsrate ist dennoch hoch. Ich vermute mal, in L.A. war’s nicht anders.“
„Ja.“
„Du redest nicht viel, was?“
„Entschuldigung. Es war ein langer Tag und ich bin müde und hungrig.“
„Dafür sind wir ja erst mal hier. Iss was und trink was. Und danach bring ich dich in deine Wohnung. Ach ja, hier ist der Schlüssel“, sagte John und legte den Schlüssel auf den Tisch. Jeremy nahm ihn und steckte ihn ein.
„Willst du auch eine Fleischbällchen-Pizza?“, fragte John. „Die kann ich sehr empfehlen.“
„Danke, ich verzichte. Kann ich mal eine Karte haben?“
„Marco! Bring unserem Gast mal eine Karte. Und ein Bier, er ist bestimmt durstig.“
„Nein danke, kein Bier für mich!“, rief Jeremy dem Kellner hinterher, dem John gerade Beine machte. „Ein Wasser reicht.“
John schaute Jeremy verwundert an.
„Wie, kein Bier? Was bist Du denn für ein Bulle? Oder ist das was Kalifornisches, so wie der Vegetarismus. Bist du Vegetarier?“
Jeremy dachte zurück an seine Zeit in L.A. und an seinen Partner Hakeem. Ein junger Afroamerikaner, der sich seinen Weg aus der Gosse erkämpfen musste. Als Teenager noch ein Bandenmitglied, verwickelt in Raubüberfälle und Drogengeschäfte, fand dieser während einer Jugendstrafe zum Islam, änderte seinen Namen und sein Leben und wechselte die Seiten. Er war zehn Jahre jünger als Jeremy und zeigte ihm gegenüber sehr viel Respekt. Generell lebte Hakeem ein Leben in Demut und Respekt, und so benahm er sich auch. Er sprach wenig, trank nichts und wenn sie mal im Restaurant waren, dann wartete er, bis ihm der Kellner einen Platz zuwies. Jeremy vermisste ihn. Ein guter Junge. Dennoch musste er vor drei Jahren aus dem Dienst ausscheiden, nachdem eine Gesetzesänderung beschlossen wurde, nach der Muslime keine öffentlichen Ämter bekleiden durften.
„Nein, ich bin kein Vegetarier“, sagte Jeremy. „Ich habe früher auch das ein oder andere Bier getrunken. Aber mein Vater, er war auch Polizist, trank auch sehr viel und starb an einer Leberzirrhose. Darauf habe ich ehrlich gesagt keinen Bock. Seit seinem Tod habe ich keinen Tropfen mehr getrunken.“
„Ah, die Leber. Das Schicksal eines Bullen. Alkohol- oder Bleivergiftung. Schnaps oder Kugeln. An einem von beiden sterben wir immer. Also wählst du die Kugeln?“
Jeremy antwortete ihm nicht. Nicht, weil ihm die Frage makaber vorkam, sondern weil John in der kurzen Zeit, die sie sich jetzt kannten, sehr viele Fragen stellte, auf die er eigentlich gar keine Antworten haben wollte. Stattdessen schaute Jeremy in die Karte und bestellte beim bemitleidenswerten Kellner, der gerade die Getränke brachte, einen Cheeseburger mit Speck und Barbecue-Soße.
„Was willst du über mich wissen?“, fragte John, nachdem er einen kräftigen Schluck von seinem Bier genommen hatte.
Nichts, aber du wirst es mir sowieso erzählen, dachte Jeremy.
„Was hat das mit dem seltsamen Outfit an sich?“, fragte er schließlich, auf die um Johns Hals hängende Brille und Mundschutz blickend.
„Das hier?“, fragte John, während er besagte Gegenstände anfasste. „Das ist psychologische Kriegsführung. Wenn wir einen Infizierten jagen, dann sind wir verpflichtet, Mund- und Augenschutz zu tragen. Wegen der Infektionsgefahr, falls wir mit seinem Blut in Kontakt kommen. Daran erkennt man uns Jäger der Spezialeinheit.“
„Und das muss man ständig um den Hals tragen?“
„Nein“, antwortete John ein wenig aufgeheitert. „Nein, ich mache das, damit man mich jederzeit als Jäger erkennt. Ich beobachte permanent die Leute um mich herum und achte darauf, ob sie nervös werden, wenn sie mich als Jäger erkennen. Das könnten dann Infizierte sein.“
„Nennen wir uns so? Jäger?“
„Ich nenne uns so. Wir sind Polizisten, haben keine spezielle Bezeichnung. Abgesehen davon, dass wir eine Spezialeinheit sind. Aber es klingt besser. Finde ich. Andere sehen das anders. Die Kollegen Kane und Jones zum Beispiel, beide auf O’ahu, beide Filmfreaks. Kane nennt uns Blade Runner, die Aufträge sind Skin Jobs, und die Infizierten sind Replikanten, die in Ruhestand versetzt werden. Für Jones sind wir Sandmänner, die die Läufer jagen, die nicht ins Karussell wollen. Letzteres ist aus Flucht ins 23. Jahrhundert.“
„Ich weiß, ich kenne den Film“, antwortete Jeremy. „Und daran erkennen wir die? Dass sie nervös werden, wenn sie uns sehen?“
„Nein, das mache ich. Ich mache mir einen Spaß daraus. Aber ich habe auch eine besondere Menschenkenntnis, weißt du? Eigentlich haben wir technische Mittel, um die zu jagen. Die Infizierten sind über Chips, Tätowierungen und auch über ihre biometrischen Daten erfasst. Anfangs dachte man, es reiche, die Leute auf Moloka’i auszusetzen. Man rechnete nicht damit, dass der Freiheitsdrang so groß ist, dass die die vielen Meilen offene See auf sich nehmen könnten, um zu fliehen. Mit den ersten Flüchtlingen rechnete man gar nicht. Erst, als sie da waren, wurde man sich bewusst, dass man etwas machen muss. Man hat es mit RFID-Chips versucht, die sie an unterschiedlichsten Stellen implantiert bekommen haben. Doch manche haben sie gefunden und sie herausgeschnitten. Dann hat man ihnen Zeichen tätowiert. Teilweise auch ins Gesicht, damit sie nicht überdeckt werden konnten. Doch auch da waren sie kreativ und haben Tribals daraus gemacht. Am effektivsten ist aber immer noch die Erkennung über die biometrischen Gesichtsmerkmale.“
John tippte mit dem Finger auf das Funkgerät auf seiner Schulter.
„Hier ist auch eine Bodycam drin, die live ins Revier nach Honolulu sendet. Bitte lächeln, du bist auf Sendung. Die und die Überwachungskameras, die überall auf den Inseln aufgestellt sind, bieten eine sehr gute Abdeckung. Selbst, wenn sie sich die Chips und Tätowierungen entfernen, sie müssen schon jeder Kamera entgehen, um nicht entdeckt zu werden. Das ist unmöglich.“
Das Essen wurde serviert. Ohne ein weiters Wort zu sagen rupfte John sich eine Ecke aus der vorgeschnittenen Pizza und biss direkt hinein. Guten Appetit, dachte sich Jeremy, ohne es allerdings auszusprechen. Vielleicht war es nicht ganz höflich von John, aber Jeremy wog die Unhöflichkeit Johns mit dessen neu gewonnener Schweigsamkeit ab und befand, dass ihm letzteres lieber war.
Jeremy biss in seinen Burger. Unter normalen Umständen hätte er gesagt, dass er sicherlich schon bessere gegessen hätte, aber in diesem Augenblick, nach so vielen Stunden, ohne etwas zu essen, schmeckte dieser Burger so gut wie kein anderer zuvor. Seit Sonnenaufgang in L.A. hatte er nichts mehr gegessen, und jetzt war es zwei Zeitzonen später wieder dunkel. Ein leckeres Abendessen und ein schweigsamer, weil essender John. So könnte es für heute bleiben, dachte sich Jeremy.
„Weißt du“, sagte John plötzlich während er noch kaute, dabei fielen ihm einige Krümel aus dem Mund, „ich war nicht immer Bulle. Ich war früher Lehrer.“
Der Anblick widerte Jeremy an. Immer mit geschlossenem Mund kauen, nicht schmatzen, und erst reden, wenn der Mund leer ist, brachte er sich die mahnenden Worte seiner Mutter in Erinnerung. In aller Ruhe schluckte er runter und trank ein Schluck Wasser.
„Ach ja?“, sagte er schließlich.
„Ja“, antwortete John, allerdings ohne abzuwarten, bis sein Mund leer war. „Ich war früher Lehrer. An der Roosevelt High in Honolulu. Für Englisch und Geschichte.“
„Und wie kamst du zur Polizei?“
„Pacific Airlines 235. Ich saß drin. Mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern.“
Jeremy lief es bei den Worten kalt den Rücken runter. Plötzlich hatte er keinen Appetit mehr. Er legte seinen Burger auf den Teller.
Pacific Airlines Flug 235 war das Anschlagsziel eines islamistischen Terroristen gewesen. Das Flugzeug sollte, von Honolulu aus kommend, im Anflug auf den Flughafen von Los Angeles durch eine Bombenexplosion zum Absturz über der Stadt gebracht werden. Die Bombe war im Schuh des Terroristen versteckt. Sie hätte nicht gereicht, um das Flugzeug zu zerstören, war aber stark genug, um ein Loch in den Rumpf zu reißen, das groß genug war, um die Integrität des Flugzeugs entscheidend zu schwächen.
Dieses Ziel hatte der Terrorist erreicht. Das Flugzeug trat in einen kaum zu kontrollierenden Sinkflug und kam mehrere Meilen vor der Landebahn runter. Womit der Terrorist aber nicht gerechnet hatte war die für L.A. ungewöhnliche Windrichtung. Der Anflug fand nicht wie üblich von Osten über die Stadt, sondern von Westen über das Meer statt. Dem Piloten gelang es tatsächlich, das Flugzeug zu wassern. Aber durch das Loch im Rumpf wurde es während der Wasserung in Stücke gerissen. Von den 238 Menschen an Bord konnten 18 gerettet werden, der Rest starb entweder während des Crashs oder ertrank.
Der Terrorist war da schon tot, er starb während der Explosion.
„Der Scheißkerl saß drei Reihen hinter uns“, erzählte John, immer noch mit vollem Mund. „Er war mir schon beim Check-In aufgefallen. Wie gesagt, ich habe da eine gute Menschenkenntnis. Hätte ich nur was gesagt. Aber er ist ja wie wir anderen auch durch die Sicherheitskontrolle. Auf die hatte ich damals noch vertraut. Woher sollte ich wissen, dass jemand eine Bombe an Bord schmuggeln kann? Und dann, während des Anflugs, schrie er plötzlich ‚Allahu akbar‘, es gab einen lauten Knall und dann blies der Wind durch die Kabine. Das kann man eigentlich nicht beschreiben. Sowas muss man erlebt haben.“
John guckte Jeremy an. Er bemerkte, dass Jeremy aufhörte zu essen. Und wie es schien blitzte seine Menschenkenntnis kurz durch, denn er legte seine Hand auf Jeremys.
„Nicht, dass ich dir das wünsche. Niemand sollte so etwas erleben. Ich meine nur, man kann es mit nichts vergleichen.“
Und dann biss er wieder in seine Pizza.
„Ich weiß nicht, wie lange es dann dauerte, bis wir unten waren. Vielleicht weniger als eine Minute, aber es kam mir ewig vor. Auf einmal gab es einen heftigen Ruck, und dann war ich kurz weg. Ich weiß nicht, wie lange. Als ich zu mir kam saß ich angeschnallt in meinem Sitz, aber der Sitz schwamm in der Kabine herum. Überall um mich herum war Wasser. Ich konnte Leute schreien hören. Es gab keine Beleuchtung und die Fenster waren unter Wasser, aber von irgendwo kam Tageslicht herein. Ich weiß nicht mehr wie, aber ich konnte meinen Gurt loswerden, bevor alles voller Wasser war. Hinter mir war das Flugzeug auseinandergebrochen, der ganze hintere Teil fehlte. Ich schaute mich um, nach meiner Frau und meinen Töchtern, aber ich konnte sie nicht sehen. Einige Leute schwammen an mir vorbei nach hinten. Einer fragte mich, ob ich alleine zurecht käme, und nahm dann eine der Stewardessen mit, die neben uns leblos im Wasser trieb. Später erfuhr ich, dass sie es nicht geschafft hatte. Genau wie meine Familie. Ich fand sie nicht mehr. Aber irgendwann war ich dann draußen. Und dann kam irgendwann die Küstenwache und fischte mich raus. Ich wünschte mir, ich wäre mit untergegangen.“
John trank sein Bier aus.
„Marco! Noch eins!“
Dann wandte er sich wieder Jeremy zu.
„Jedenfalls überlebte ich. Irgendwie. Aber ein Teil von mir ist mit meiner Familie gestorben. Der Lehrer, der ich davor war. Übrig blieben Zorn und Wut. Ich habe meinen Job gekündigt und wollte zum Heimatschutz, um es diesen Hurensöhnen heimzuzahlen. Aber die wollten mich nicht. Ich wäre zu alt und zu dick. Und dann habe ich mich bei der Polizei beworben. Gerade zu der Zeit, als diese Spezialeinheit gegründet wurde. Offenbar hat denen meine Motivation gefallen.“
„Die da gewesen ist?“, fragte Jeremy, die Antwort bereits ahnend.
„Hurensöhne killen…“
Jeremy aß seinen Burger nicht mehr auf. Ein weiteres Bier und noch ein paar – diesmal belanglosere – Gespräche später brachen sie auf. Jeremy bot an, zu fahren, aber John ließ sich trotz seines Alkoholkonsums nicht vom Lenker fernhalten. Er fuhr Jeremy zu dessen Unterkunft. Es handelte sich, wie bei allen Häusern in der Umgebung, um einen Bungalow mit ausladendem Vorgarten.
„Hier wohne ich?“
„Ja, vorübergehend. Hat Kabelanschluss und Klimaanlage. Du kannst dich dann in aller Ruhe nach einer Wohnung und einem Auto umsehen.“
„Apropos Auto, wie komme ich morgen zur Arbeit?“
„Ich hol dich ab. Um halb neun. Und jetzt raus hier, ich muss meinen Rausch ausschlafen.“
„Schlaf gut, John. Bis morgen.“
Jeremy stieg aus und ging zum Haus. Mittlerweile war es tiefste Nacht. Nur ein Rauschen war noch zu hören. Jeremy war sich nicht sicher, ob es sich nur um den Wind handelte, der durch die Palmen und Bäume wehte, oder ob er von hier das Meer hören konnte. Er hatte keine Ahnung, wie weit das Meer weg war.
Er sperrte die Tür auf, betrat das Haus und schaltete das Licht an. Die Wohnung war möbliert, wenn auch sehr spärlich. Eigentlich genau nach Jeremys Geschmack. Er betrat das Schlafzimmer und stellte seinen Koffer neben den Schrank. Dann inspizierte er noch die restlichen Räume und suchte das Badezimmer auf, bevor er zurück ins Schlafzimmer ging, sich auszog und ins Bett legte.
Obwohl er müde war, lag er noch lange wach und dachte über den Tag nach. Er hatte Probleme, einzuschlafen. Die hatte er nach seinen beiden Tötungen in L.A. nicht.