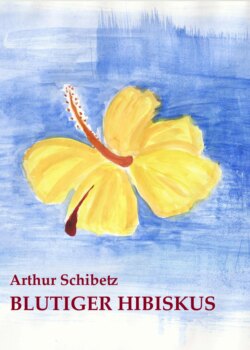Читать книгу Blutiger Hibiskus - Arthur Schibetz - Страница 8
Kapitel 5
ОглавлениеDie nächsten drei Wochen vergingen auf ähnliche Art und Weise wie der erste Tag. Die beiden fuhren die einzelnen Städte und Küstenabschnitte ab und kehrten in diversen Bars und Restaurants ein. Zweimal reagierte John auf einen Funkruf und man beteiligte sich an der Polizeiarbeit: Einmal an einer Verfolgungsjagd und einmal, in der Spätschicht, griffen sie in einer Schlägerei zwischen Touristen am Wailea Beach ein. Ansonsten hatte Jeremy genug Zeit, um sich um eine Wohnung und ein eigenes Auto zu kümmern. Zwei Wochen nach seiner Ankunft auf Maui hatte er beides. Die Wohnung lag in Wailuku, direkt am Fuß des Mauna Kahalawai, eines erloschenen Vulkans. Das Auto war ein alter Prius 2.
Gleich nach dem Kauf des Autos übernahm Jeremy den Fahrdienst. Zum einen, weil der Prius deutlich weniger verbrauchte als Johns 95er Dodge Stratus und Sprit nicht wirklich günstig war. Außerdem wollte er das Risiko vermeiden, in einem vom unter Alkoholeinfluss stehenden Kollegen verursachten Verkehrsunfall zu sterben.
Eines Morgens verließ Jeremy wie immer in der Frühschicht um halb neun das Haus. Er wollte gerade ins Auto steigen, als er das sich nähernde und immer lauter werdende Geräusch eines schnell fahrenden Autos hörte. Es war Johns Auto, das um die Ecke gerast kam und mit quietschenden Reifen neben Jeremy anhielt.
„Hast du schon gehört?“, rief John durch das geöffnete Beifahrerfenster. „Die Nachtschicht hat einen laufen lassen!“
„Was?“
„Hast du dein Funk nicht an?“
„Nein. Ich bin noch nicht im Dienst, die Schicht beginnt erst um neun.“
„Sie beginnt jetzt, mein Freund! Wir sind auf der Jagd! Na los, spring rein.“
„Soll ich nicht fahren?“
„Ich fahre. Ich kenne die Gegend besser.“
Mit einem unguten Gefühl stieg Jeremy ein. Kaum, dass die Tür zu war, gab John auch schon Gas. Jeremy mühte sich, sich anzuschnallen.
„Guck auf dein schlaues Gerät“, begann John, während er mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Wohngebiet fuhr. „DaMichael Muhammad Johnson. Muhammad! Ein verdammter Moslem!“
John schaltete sein Dienst-Smartphone an und bekam auch prompt die Nachricht mit dem Steckbrief angezeigt. Er klickte sie an und bekam das Polizeifoto eines Schwarzen zu sehen.
„Muss nichts heißen“, antwortete er. „Viele Schwarze haben muslimische Namen.“
„Meinst du? Ich weiß nicht.“
„DaMichael. Klingt nicht sonderlich muslimisch.“
„Egal. Wir kriegen den Nigger schon noch.“
Jeremy sah John an. Dieser hatte schon bei mehreren Gelegenheiten durchblicken lassen, dass er ein Rassist war. Das N-Wort hatte er bisher aber noch nicht von sich gegeben.
„Er wird aus der Masse herausstechen. Es gibt ja nicht so viele von denen auf Maui“, ergänzte John.
„Genauso wenig wie in Glendale.“
„Was?“
„Hier steht er kommt aus Glendale. Sehr ungewöhnlich. Das ist ein weißer Vorort von Los Angeles. Da gibt’s kaum Schwarze. Doktor DaMichael Muhammad Johnson“, sagte Jeremy, das Wort Doktor betonend. „28 Jahre alt, Luft- und Raumfahrtingenieur am Jet Propulsion Laboratory in Pasadena.“
„Ja, und?“
„Das ist ein Einstein!“
„Das war er vielleicht mal. MODAPS wird auch aus seinem Hirn Käse machen.“ Ohne langsamer zu fahren schaute John Jeremy ins Gesicht. „Warte mal, hast du etwa Mitleid mit ihm?“
„Nein habe ich nicht, und könntest du bitte auf die Straße gucken?“
„Jaja, mach dir mal nicht ins Hemd.“ John drehte seinen Kopf wieder nach vorne. Jeremy steckte sein Smartphone ein und legte sich die Schutzausrüstungen um den Hals.
„Dann bring mich mal auf den neuesten Stand“, sagte er. „Wo steckt er.“
„Wissen wir nicht genau. Irgendwo in den Bergen westlich von hier.“
„Was ist mit seinem Chip?“
„Kein Signal. Muss er rausgenommen haben.“
„Woher weiß man, dass er hier ist?“
„Gesichtserkennung. Eine Kamera in Kapalua hatte ihn erfasst und identifiziert. Das war gegen zwei Uhr. Die Kollegen Costello und Walton waren kurz danach dort, die waren eh gerade an der Westküste unterwegs. Sie hatten ihn auch fast. Sie konnten ihn gerade noch sehen, wie er den Hang hinauflief und in den Wäldern verschwand.“
„Der Wald ist groß.“
„Und dicht. Die Navy hatte einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera vorbei geschickt. Der hat die ganze Nacht die Westflanke abgesucht aber nichts finden können.“
Sie fuhren mittlerweile die Main Street westwärts. Auf Höhe des Gerichtsgebäudes fuhr John an den Straßenrand und machte den Motor aus.
„Und nun?“, fragte Jeremy.
„Lass uns mal überlegen, wo wir ihn fangen können. Du bist doch Jäger, und die Wälder in Wisconsin sind bestimmt größer als dieser kleine Berg hier vor uns. Wo würdest du ihn suchen?“
Jeremy dachte nach. Fast eine Minute saß er stumm im Auto und blickte starr auf die Berge vor ihm. Dann begann er, seine Überlegungen auszuführen.
„Wäre er ein Tier, dann dort, wo er jetzt steckt. Das ist ein großes Gebiet. Ein Tier hätte da alles, was es zum Leben braucht. Aber er ist kein Tier. Er ist ein hochintelligenter Mensch. Auf der Insel wird er früher oder später entdeckt werden. Er wird sie verlassen müssen. Wenn er für den Rest seines Lebens im Wald leben wollte, dann wäre er ja auf Moloka’i geblieben. Also wird er runter wollen. Aber wie? Die Flughäfen werden kontrolliert.“
„Die Häfen“, sagte John.
„Ja, das würde mir auch als erstes in den Sinn kommen.“
„Dir und vor dir auch einigen anderen. Wir haben da schon mehrere erwischt.“
„Schön für sie, aber wer nimmt sie von dort mit?“
„Niemand. Aber soweit denken die nicht.“
„Dieser hier schon.“ Jeremy drehte seinen Kopf zu John. „Er wird niemanden bitten, mitgenommen zu werden. Er wird versuchen, heimlich an Bord zu kommen und sich zu verstecken. Und dafür braucht er ein Schiff, das groß genug ist.“
„Ein Kreuzfahrtschiff! Kahului Harbor!“, sagte John, startete den Wagen und gab Gas. Dabei bremste er einen anderen Verkehrsteilnehmer aus, der mit lautem Hupen auf sich aufmerksam machte.
„Nicht so schnell. Weiß er von den Kameras und der Gesichtserkennung?“
„Wie meinst du das?“
„Ist das allgemein bekannt? Also ich wusste es nicht.“
„Es ist kein Geheimnis. Wenn er klug ist, dann weiß er es.“
„Gehen wir mal davon aus, dass er es weiß. Also wird er die Zivilisation meiden. Bis wie weit nach Süden haben die Hubschrauber gesucht?“
„Keine Ahnung. Ich habe nur gehört, dass einer da war. Aber nicht wo.“
Jeremy drückte den Knopf des Funkgeräts an seiner Schulter und fragte im Revier nach. Hier kam erst nur ein knappes „Müssen bei der Navy nachfragen“ als Antwort zurück. Es dauerte mehrere Minuten, bis man offenbar den richtigen Ansprechpartner dran hatte. Mittlerweile erreichten sie den Hafen. „Südlich bis Kaanapali“, lautete dann die Antwort. Und dass wieder ein Hubschrauber über dem Berg wäre, ohne Erfolg bisher.
„Das ist fünf Meilen von Kapalua weg“, sagte John. „Die hätten ihn entdeckt, wenn er da entlang wäre.“
„Meinst du? Hat er sich so gut in den Wäldern versteckt, dass er immer noch nicht entdeckt wurde? Ich an seiner Stelle wäre im weiten Bogen südlich um den Berg und die Stadt herum.“
„An der Südflanke sind aber kaum Wälder, in denen er sich verstecken kann.“
„Wozu verstecken, wenn ihn da keiner sucht?“
Man konnte John förmlich ansehen, wie er über diese Worte nachdachte.
„Dieser verfluchte Hund!“, schimpfte er und fuhr erneut los.
Kurze Zeit später verließen sie die Stadt und rasten über den Highway in Richtung Süden. Dieser war zu beiden Seiten und scheinbar durchgehend mit zehn Fuß hohen Zuckerrohrpflanzen flankiert, welche sich ununterbrochen im Wind wogen.
„Sieh dich doch mal um“, sagte Jeremy. „Das ist doch die beste Deckung für ihn. Wenn er erst mal die Felder hier erreicht hat, dann spaziert er in aller Seelenruhe wenige Fuß an uns vorbei. Und wir sehen ihn nicht.“
Nach einigen Minuten erreichten sie eine Kreuzung, an der die Zuckerrohrfelder zu ihrer rechten Seite aufhörten. Stattdessen gab es hier eine Steppenlandschaft, die die Sicht bis weit auf den Berg hinauf frei gab, der hier ebenfalls kahl war. John hielt am Straßenrand.
„Und du meinst, er kommt hier vorbei?“, fragte er.
„Höchstens in der Nacht. Hier kann er zu leicht entdeckt werden.“
„Es ist kurz nach neun. Wollen wir warten, bis es dunkel wird?“
„Was schlägst du vor?“
„Wir könnten bis dahin dort suchen, wo er auch tagsüber unentdeckt wäre.“
Jeremy zog die Augenbrauen hoch.
„Sollen wir die Zuckerrohrfelder durchstreifen?“
John lachte.
„Nein, nicht ganz. Aber zuerst eine Frage. Glaubst du, dass er schon hier ist? In den Feldern?“
„Über den Berg und durch den Wald? In sieben Stunden ist das eher unwahrscheinlich.“
„Gut“, sagte John. „Es gibt hier nämlich einen schmalen Streifen zwischen Wald und Feldern, der gut einsehbar ist.“
„Du meinst, er würde es da eher riskieren? Wie lange braucht man zu Fuß durch diesen Streifen.“
„Kommt ganz aufs Handicap an.“
Jeremy schaute John fragend an.
„Was?“
„Da gibt es einen Golfplatz. Oder besser gesagt zwei, direkt nebeneinander. Schmal und lang. Insgesamt gut zwei Meilen lang. Genau am Fuß des Berges. Wenn er nicht durch die Steppe hier will, dann muss er dort durch.“
Jeremy lächelte.
„Ein Schwarzer auf einem Golfplatz“, sagte er. „Auf Hawaii. Der sollte doch auffallen, wenn er da auftaucht. Na los, worauf wartest du?“
John wendete und fuhr ein Stück den Highway zurück. Nach etwa einer Meile bog er nach links ab und fuhr in Richtung Berge. Er steuerte den südlichen der beiden Plätze, den Kahili Golfplatz an, und setzte Jeremy am Clubhaus ab.
„Denk dran, bleib in Deckung“, sagte John. „Wenn du recht hast, dann steckt er irgendwo dort drüben im Unterholz. Oder er kommt noch. Auf alle Fälle hat er genug Deckung. Wenn er dich sieht, dann ist unser Vorteil dahin.“
„Bin ich der Jäger oder du?“, konterte Jeremy.
„Alles klar. Wir bleiben über Funk im Kontakt. Wenn du etwas siehst, dann sag Bescheid.“
„Und wenn er bei dir auftaucht? Ich habe kein Auto und du bist eine Meile weit weg.“
„Wenn er bei mir auftaucht dann erledige ich ihn. Wäre nicht der Erste. Ach ja, leih dir doch ein Golfcart. Damit bist du mobil.“
Er wartete Jeremys Reaktion nicht ab, sondern gab Gas und entfernte sich rasch. Jeremy schaute sich einmal in alle Richtungen um und ging dann ins Clubhaus. Das Restaurant hatte er schnell gefunden. Hier saßen ein paar Leute und tranken Kaffee. Sie unterbrachen ihr Gespräch und schauten zu Jeremy, als er den Raum betrat.
„Wo finde ich den Manager?“, fragte er.
Von den Anwesenden erhielt er keine Antwort, sie starrten ihn weiterhin an, als hätten sie noch nie einen Polizisten mit um den Hals hängender Schutzausrüstung gesehen. Dann wurde er von hinten angesprochen.
„Kann ich Ihnen helfen, Sir?“
Jeremy drehte sich um. Ein weißer Mittdreißiger sah ihn an, er war relativ sportlich gebaut und hatte ein aufdringliches Zahnpasta-Lächeln. Jeremy zeigte seinen Ausweis.
„HPD, Spezialeinheit. Haben Sie hier das Sagen?“
„Darf ich fragen, worum es geht?“
„Polizeieinsatz. Ich brauche ein Golfcart.“
Das Lächeln des Mannes verschwand.
„Ist hier einer von… denen?“, fragte er.
„Weiß ich nicht. Ich bin hier, um es herauszufinden.“
„Warten Sie kurz.“
Der Mann ging in Richtung des Shops und kam wenige Sekunden später wieder heraus. Er gab Jeremy einen Schlüssel und führte ihn hinaus zu den in mehreren Reihen abgestellten Carts.
„Hier. Nehmen Sie den. Aber wenn ich Sie um etwas bitten darf: Bitte nicht auf dem Golfclub“, bat er Jeremy mit eindringlicher Stimme. Jeremy nickte vielsagend, stieg in den Cart und startete ihn.
„Sir?“, sagte er zum jungen Mann.
„Ja?“
„Haben Sie schwarze Mitglieder oder Gäste?“
„Sir. Wir sind ein weltoffener Club. Hier dürfen Leute jeder Rasse, Weltanschauung…“
„Nein, nein“, fiel Jeremy dem Mann ins Wort. „Der Gesuchte ist schwarz. Ich will nicht, dass ich ihn versehentlich mit einem Gast verwechsle.“
„Was? Nein. Nein, heute ist keiner da.“
„Wenn welche kommen, dann halten Sie sie bitte vom Platz fern.“
„Ja, klar, sicher“, stammelte der junge Mann. „Und wie?“
„Lassen Sie sich was einfallen.“
Jetzt wollte es Jeremy John nachmachen den verunsicherten jungen Golfclubangestellten stehen lassen. Er wartete dessen Antwort nicht ab, sondern gab Gas. Untermalt vom leisen Surren des Elektromotors entfernte er sich im Schritttempo. Das war nicht der Abgang, den er sich erhofft hatte. Darüber musste Jeremy grinsen.
Die nächsten Stunden verbrachte er damit, die Wiesen des Golfplatzes auf und ab zu fahren. Ganz zu Beginn seiner Patrouille fuhr er noch über die Fairways, was einige Spieler, die da gerade spielen wollten, sehr erzürnte. Also wich er auf die Roughs zwischen den Spielbahnen aus. Hier fiel er auch weniger auf, das kam ihm zugute.
Über Funk blieb er im ständigen Kontakt mit John. Auf dessen Golfplatz blieb es auch ruhig, so dass sie oft in belanglose Gespräche verfielen. Irgendwann wurden sie von der Zentrale aufgefordert, den Kanal zu wechseln, da es sie nicht interessierte, welche Zutaten zwingend auf einen Burger mussten oder warum es in Wisconsin mit seinem kalten Winter besser wäre als auf Hawaii.
Gegen Mittag bekam Jeremy Hunger, außerdem musste er austreten. Also beschloss er, zum Clubhaus zurück zu fahren und eine kleine Pause zu machen. John war dagegen.
„Piss doch gegen einen Baum“, sagte er.
„Und wenn sich einer beschwert?“
„Zeig ihm deine Marke. HPD, Spezialeinheit. Und wenn ihn das nicht beeindruckt, dann piss ihm ans Bein.“
Jeremy war die rauen Sprüche Johns inzwischen gewohnt. Er war sich aber nie sicher, ob dieser es ernst meinte. Er interpretierte es trotzdem als Scherz und lachte.
Etwa auf halber Strecke zum Clubhaus, er fuhr gerade durchs hohe Gras zwischen den Bahnen von Loch 10 und 11, bemerkte er in deutlicher Entfernung einen schwarzen Mann, der aus den Bäumen neben dem Green von Loch 11 heraustrat und in Richtung des Clubhauses ging. Er drückte den Knopf an seinem Funkgerät.
„John, ich glaube, ich habe ihn entdeckt.“
„Sicher?“
„Schwarzer Mann. Alleine, ohne Golfausrüstung. Er kommt von Westen und geht in Richtung des Clubhauses.“
„Fahr näher ran. Setz Brille und Mundschutz auf. Wenn er abhaut, ist er’s.“
„Aye, Sir. Falls ich ihn einhole.“
„Was meinst du damit?“
„Er ist gut zweihundert Yards weit weg.“
„Scheiße. Bleib dran. Ich komm rüber.“
Jeremy trat das Gaspedal durch, sein Cart fuhr aber trotzdem nicht viel schneller. Langsam näherte er sich dem Clubhaus. Der Verdächtige ging schnellen Schrittes vor diesem vorbei und näherte sich einer Baumgruppe östlich des Clubhauses.
„Er ist es!“, rief Jeremy in sein Funkgerät. „Wiederhole: er ist es! Der Verdächtige läuft zielstrebig über den Platz Richtung Osten.“
„Kannst du auf ihn schießen?“
„Negativ. Er ist zu weit weg.“
„Kannst du ihm den Weg abschneiden?“
„Nein. Ich kann nur versuchen, ihn einzuholen.“
Er legte die Schutzbrille und den Mundschutz an. Etwa auf Höhe des Abschlages von Bahn 10 hielt er seinen Cart an und lief quer über das Green. Den Spielern, die hier gerade abschlagen wollten, gefiel das nicht besonders. Aber mit der Schutzausrüstung im Gesicht und der Waffe in der Hand schaffte er es zumindest, dass sich ihm keiner in den Weg stellte oder lautstark beschwerte. Als der Verdächtige die Baumgruppe erreichte, war Jeremy immer noch gut 70 bis 80 Yards weit weg. Er blieb stehen und zielte auf ihn.
„Honolulu Police Department! Stehenbleiben!“
Als der Verdächtige Jeremy hörte, begann er, zu rennen. Jeremy zog am Abzug. Insgesamt fünfmal schoss er auf den Flüchtigen. Dieser zuckte kurz, hielt sich die Schulter und rannte weiter. Dann verschwand er zwischen den Bäumen.
Jeremy rannte hinterher. An den Bäumen angekommen blieb er stehen und schaute sich um. Den Verdächtigen konnte er nicht mehr sehen, aber auf dem Gras fand er frische Bluttropfen.
„Verdächtiger getroffen“, funkte er an John.
„Ist er tot?“
„Nein. Aber wir haben ihn bald. Er blutet.“
Die Bluttropen waren recht dünn, aber für einen geübten Jäger wie Jeremy deutlich zu sehen. Er folgte ihnen bis zum Rand des Zuckerrohrfeldes.
„Ich bin auf dem Parkplatz. Wo steckst du?“, meldete sich John über Funk.
„Im Feld. Er ist da drin.“
„Scheiße. Kriegst du ihn?“
„Wenn er nicht aufhört zu bluten, ja. Ist nur noch eine Frage der Zeit.“
„Ist dein GPS im Smartphone an?“
„Ja, warum?“
„Dann scheuch ihn durchs Feld. Ich warte am Highway. Und Jeremy, Kumpel?“
„Ja?“
„Fass auf keinen Fall das Blut an.“
Jeremy betrat das Feld. In so einer Umgebung hatte er bisher noch nicht gejagt. Aber er gewöhnte sich schnell an die hohen, dicht stehenden Pflanzen. Mit seinem geübten Blick achtete er auf umgeknickte Halme und Blutspuren. Er konnte die Spur hier drin lesen und folgte ihr. Er wusste nicht, wie schwer der Verdächtige verletzt war, und konnte daher schlecht abschätzen, wie gut dieser im Feld vorankäme. Daher wollte er keine Zeit verlieren und folgte der Spur, so schnell er konnte. In den Wäldern Wisconsins war er auch nach Gehör vorgegangen, aber hier war das Rauschen des Windes in den hohen Gräsern allgegenwärtig.
In der immergleichen Umgebung mit einer Sichtweite von gerade mal einigen Yards in Verbindung mit seiner Anstrengung, die Spur nicht zu verlieren, verlor Jeremy bald jegliches Zeitgefühl. Er wusste nicht mehr, ob er fünf oder dreißig Minuten hier drin war, als er plötzlich in unmittelbarer Nähe mehrere Schüsse hörte. Jeremy blieb stehen und hielt die Luft an.
„Alles klar“, meldete sich John über Funk. „Ich hab ihn.“
Jeremy ging weiter voran. Nach einiger Zeit erreichte er den Rand des Feldes. Vor ihm lag der Highway. Der Verdächtige lag in der Mitte des Highways in einer Blutlache, John stand mit gezogener Waffe daneben. Auf dem Highway fuhr keiner mehr, die Autos hielten in beiden Fahrtrichtungen in einiger Entfernung zum Tatgeschehen an.
Jeremy ging zu John. Dieser funkte gerade an die Zentrale, dass der Flüchtige ausgeschaltet wäre und forderte einen Reinigungstrupp an.
„Aus welcher Entfernung hast du geschossen?“, fragte John.
„Weiß nicht. 80 Yards, vielleicht 90.“
„Mit einer 38er? Nicht schlecht. Ich weiß noch nicht mal, ob meine Kugeln überhaupt so weit fliegen.“
„War auch viel Glück. Ich musste schießen, er wollte weglaufen.“
„Hatte er dich entdeckt?“
„Nein. Ich rief ihm zu, er solle stehenbleiben.“
„Was? Du Idiot!“, sagte John. „Wir sollen die nicht verhaften. Wir sollen die erschießen! Mach das nie wieder, ja? Geh so nah ran wie möglich, und dann BÄMM! Klar?“
Jeremy sah John an. Er sagte nichts, sondern nickte nur.
„Okay. Die Cleaner sind unterwegs. Wir machen uns jetzt nützlich und verscheuchen die Autofahrer. Keiner darf näher als fünfzig Yards heran. Ich nehme die Seite, und du die.“
Jeremy wurde die südliche Richtung zugeteilt. Er ging auf das erste Auto zu, das in der Schlange wartete. Es war deutlich näher als fünfzig Yards am Geschehen. Jeremy nahm seine Marke in die Hand und hielt sie hoch. Mit der anderen Hand deutete er dem Fahrer an, dass dieser umkehren sollte. Doch der reagierte im ersten Moment nicht, er saß nur mit offenem Mund da und starrte verängstigt auf Jeremy. Mit einigen Nachdruck verleihenden Worten konnte Jeremy ihn aus seiner Angststarre befreien und ihn zum Wenden bringen. Die Fahrer hinter ihm waren dann leichter zu überzeugen.
Etwa eine halbe Stunde später trafen mehrere größere schwarze Fahrzeuge ein, drei SUVs und zwei Kastenwägen. Die Cleaner, wie sie genannt wurden. Etwa ein Dutzend Menschen in weißen, den ganzen Körper einhüllenden Schutzanzügen machten sich über den Tatort her. Die Leiche wurde in einen Plastiksack gepackt und in einen der Kastenwagen gebracht. Die Blutlache wurde mit einer Chemikalie besprüht. Weitere Cleaner schienen das nähere Umfeld bis zum Zuckerrohr zu untersuchen, auch hier wurde intensiv gesprüht.
„Was ist mit den Blutstropfen im Feld?“, funkte Jeremy.
„Die werden dich hassen“, funkte John mit einem Lachen zurück.
„Und was ist jetzt mit uns?“
„Gut, dass du fragst, jetzt sind wir dran. Komm wieder zurück.“
Jeremy ging zu den schwarzen Wagen.
„Du machst es spannend“, sagte er zu John, der kurz vor ihm hier ankam und bereits untersucht wurde. Er stand breitbeinig und mit ausgestreckten Armen da und wurde von einem der Cleaner mit einer UV-Lampe aus nächster Nähe intensiv abgesucht. Danach war Jeremy an der Reihe.
„Ist das Ihr Blut?“, fragte der Cleaner, als er Jeremys Hose untersuchte.
„Nein, das ist vom Flüchtigen.“
„Ausziehen.“
John lachte.
„Mach lieber, was sie sagen“, sagte John. „Die werden die Hose abfackeln. Ob du drin steckst oder nicht.“
Widerwillig zog er sie aus. Auch an den Schuhen wurde Blut gefunden, so dass er auch Schuhe und Socken ausziehen musste.
„Ich sehe lächerlich aus“, sagte er.
John lachte noch herzhafter.
„Kennst du Walter White? So siehst du aus.“
„Das sind keine Spritzer, das sind Streifen“, sagte der Cleaner. „Wie kommt das Blut überhaupt an Ihre Hose?“
„Vermutlich vom Zuckerrohr“, antwortete Jeremy.
Mehrere Cleaner drehten sich in Richtung des Feldes um. Nun musste sich John den Bauch halten vor Lachen.
„Wie weit?“, fragte der Cleaner.
In Unterhose und barfuß mitten auf der Straße stehend und sich bewusst werdend, dass er hier offenbar viel Arbeit angerichtet hatte, verlor Jeremy seine übliche Selbstsicherheit.
„Bis zum Golfplatz…“, murmelte er.
Einer der Cleaner legte seine Hände in die Hüfte, ein anderer senkte den Kopf.
„Alter, ich krieg keine Luft mehr!“, stammelte John zwischen seinen Lachschwaden.
„Können wir jetzt weg?“, fragte Jeremy.
„Ja“, sagte der Cleaner. „Gehen Sie. Und suchen Sie sich einen neuen Job!“
„Na komm schon, Heisenberg“, sagte John, immer noch lachend. „Fahren wir in die Wüste, etwas Meth kochen.“
Sie stiegen ins Auto und fuhren los. Jeremy war froh, endlich der peinlichen Situation entkommen zu sein. Wobei ihm noch der Weg vom Auto zu seiner Haustür bevorstand. Er hoffte, dass kein Nachbar ihn sehen würde.
„Und nun?“, fragte er.
„Nun werden die einen ganzen Streifen durchs Feld mit Herbiziden töten und danach abfackeln.“
„Nein, ich meine, was ist mit uns?“
„Wir schreiben einen Bericht. Der geht an Morris und auch an Captain Iz, damit der weiß, was auf seiner Insel passiert. Morgen Nachmittag, mindestens 24 Stunden nach dem Einsatz, müssen wir zum Bluttest. Drei Tage später bekommen wir dann das Ergebnis. Ist es negativ, geht alles weiter wie bisher. Ist es positiv, dann geht’s ab nach Moloka’i.“
„Nein, ich meine, müssen wir jetzt zum Psychologen? Kriegen wir jetzt Zwangsurlaub?“
„Nein. Wir doch nicht. Wir hätten den falschen Job, wenn wir das müssten.“
„Wir haben gerade jemanden getötet.“
„Nein. Er war schon tot. Gewöhn dich lieber daran, Greenhorn. Gewöhn dich daran oder such dir einen neuen Job.“
Jeremy sah sich um, ob jemand in der Nähe war. Dann beeilte er sich in sein Haus. Er zog sich eine neue Hose und neue Schuhe an und ging zurück zum Auto. Der restliche Arbeitstag verlief im Vergleich zum Vormittag sehr ruhig.
Einen Tag später mussten beide zur Blutabnahme. Drei Tage später bekamen sie die Ergebnisse des Tests. Beide waren negativ.