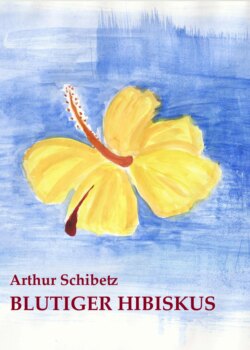Читать книгу Blutiger Hibiskus - Arthur Schibetz - Страница 9
Kapitel 6
ОглавлениеJeremy lernte schnell dazu. Bereits wenige Tage, nachdem sie die negativen Testergebnisse erhalten hatten, erhielten die beiden einen neuen Auftrag. Diesmal war es Jeremy, der den tödlichen Schuss abfeuerte, und er passte gut darauf auf, sich und die Umwelt dabei so wenig wie möglich zu verunreinigen. Ein präzises Vorgehen war auch angebracht, da der Infizierte diesmal in der Nähe der bei Touristen beliebten Strände von Waihea gestellt wurde.
Da auch John von Jeremys Fähigkeiten und Erfahrungen als Jäger dazulernte, entwickelten sich beide in den folgenden Monaten zum erfolgreichsten Team der Spezialeinheit. Bis zum Kamehameha Tag am 11. Juni erzielten sie in den ersten knapp vier Monaten seit Jeremys Dienstantritt vierzehn Tötungen, neun davon gingen auf Jeremys Kappe.
In der Nacht auf den 11. Juni hatten sie Nachtschicht. Gegen sieben Uhr morgens, zwei Stunden vor Feierabend, piepsten ihre Mobiltelefone. Sie fuhren gerade durch Kahului. Jeremy saß am Steuer, also guckte John nach.
„Wir haben was zu tun, Kumpel. Stell dir vor, ein Chip!“
„Was? Wo?“
„Ganz im Norden. Zwischen Kapalua und Kahakuloa. Nein, warte. Zwei!“
Die vierzehn bisherigen Flüchtigen hatten keinen Chip mehr. Jeremy hatte nicht damit gerechnet, dass jemand, der von Moloka’i fliehen möchte, nicht daran dachte, ihn zu entfernen. Jeremy bog an der nächsten Kreuzung ab und gab Gas. Das Ziel war die Route 340, auch bekannt als Kahekili Highway.
„Drei!“, sagte John. „Das werden ja immer mehr.“
Mehr als drei wurden es nicht mehr. Nach einigen Minuten erreichten sie den Highway.
„Mary Scott, Alice Davies und Jessica Bleeker“, las John vom Display ab.
„Frauen!“, sagte Jeremy überrascht.
„Ja, Frauen. Die gibt’s auch. Sie fliehen nur deutlich seltener.“
Das war ein weiteres Novum für Jeremy. Bisher musste er noch nie eine Frau jagen.
„Du hast doch keine Bedenken, oder?“, fragte John.
„Ehrlich gesagt, an diese Möglichkeit habe ich noch gar nicht gedacht. Also, dass ich auch Frauen jagen muss.“
„Kein Unterschied zu Männern. Infiziert ist infiziert. Und geflohen ist tot.“
Der Weg war mit knapp zwanzig Meilen nicht weit, aber die vielen engen Serpentinen des Kahekili Highway ließen keine hohe Geschwindigkeit zu. Sie verschafften Jeremy viel Zeit zum Nachdenken.
„Kommen viele Frauen nach Moloka’i?“, fragte er nach einigen Minuten.
„Keine Ahnung“, antwortete John. „Ich kenne keine Statistiken. Wohl auch so viele wie Männer, vermute ich.“
„Und warum fliehen sie seltener?“
„Was weiß ich? Vielleicht weil sie schwächer sind. Vielleicht ersaufen sie häufiger als Männer. Keine Ahnung. Du stellst vielleicht Fragen.“
Die nächsten Minuten blieben beide ruhig. Der Weg zog sich scheinbar ewig. Mittlerweile war es schon halb acht.
„Woher hast du ihre Namen?“, fragte Jeremy.
„Sind in den Chips gespeichert. Name, Geburtsdatum und Geburtsort, letzter Wohnort, Datum der Überführung auf die Insel…“
„Wie alt sind sie?“
„Ist das wichtig?“
Jeremy schüttelte den Kopf.
„Nein“, sagte er. „Aber es ist ein weiter Weg und ich bin neugierig.“
John fuchtelte mit dem Finger über das Display seines Telefons. Er war kein Fan dieser filigranen Geräte und ihrer Technologie.
„Scott ist 21… Davies 22… und Bleeker… ebenfalls 21.“
„Gleich alt. Freundinnen?“
„Du hast ein gutes Gespür. Sie kamen zusammen auf die Insel. Und sie wohnten zuletzt alle drei in East Lansing, Michigan.“
„Spartans…“, murmelte Jeremy.
„Was meinst du?“
„Michigan State Spartans. In East Lansing ist die Universität. Es waren Studentinnen.“
„Vermutlich.“
„Überprüf mal, wo sie geboren wurden.“
„Du entwickelst viel zu viel Interesse für die Beute. Hast du auch die Hirsche zuhause in Wisconsin nach Namen und Lebenslauf gefragt, bevor du sie getötet hast?“
„Tu mir bitte den Gefallen.“
John seufzte, dann fuchtelte er wieder mit seinem Finger über das Display.
„Hm… du hast wohl wieder recht. Scott kommt aus Virginia, Davies aus Oregon und Bleeker aus New York.“
„Das wären dann die nächsten drei von einer Uni. Macht sieben von siebzehn.“
„Ja, und?“
„Unter Wissenschaftlern und Studenten scheint MODAPS besonders verbreitet zu sein.“
„Tja, das Universitätsleben. Freie Liebe ist gefährlich. Vor einigen Jahrzehnten war es AIDS, jetzt ist es MODAPS.“
Die Antwort schien einleuchtend, aber aus einem Grund, den sich Jeremy nicht erklären konnte, war er doch nicht ganz zufrieden mit ihr. Er fragte aber nicht weiter nach. Sie fuhren noch gut zwanzig Minuten schweigend weiter.
„Warte!“, rief John plötzlich. „Ich habe sie auf meinem Display. Sie sind hier.“
„Wo?“
„Rechts von uns. An der Küste. Halt an!“
Jeremy stellte das Auto im hohen Gras neben dem Fahrstreifen ab. Beide legten ihre Schutzausrüstung an und verließen das Fahrzeug. Jetzt sah auch Jeremy auf das Display seines Smartphones.
„Etwa 150 Yards zur Küste hin“, sagte er. „Also zwei von ihnen. Eine weitere ist noch ein Stück weiter, genau an der Küste.“
„Wir sollten leise sein. Wenn wir sie überraschen können, dann wird es ein Spaziergang werden.“
Da sowohl das hohe Gras im Wind als auch das nahe Meer durch ihr Rauschen für ausreichend laute Nebengeräusche sorgten, mussten sich nicht großartig anstrengen, um leise zu sein. Dennoch bewegten sie sich immer vorsichtiger, je näher sie sich den beiden nächsten Punkten auf dem Display näherten.
„Zehn Yards“, flüsterte Jeremy. „Das verstehe ich nicht. Ich sehe sie nicht.“
„Vielleicht haben sie die Chips rausgenommen und hier zur Ablenkung abgelegt.“
„Ist das schon mal vorgekommen?“
„Bis jetzt noch nicht. Sei trotzdem leise.“
Ein paar Schritte später entdeckten sie sie. Es waren zwei junge Frauen, die hier hinter einem kleinen Felsvorsprung im hohen Gras lagen. Sie rührten sich nicht. Sie waren mit kurzen Hosen und Shirts bekleidet. Neben ihnen lagen drei Neoprenanzüge.
„Unglaublich, sie schlafen“, flüsterte John. „Tja, die lange Reise war anstrengend. Aber leider umsonst. Okay, ich nehme die Linke, du die Rechte.“
John richtete seine Waffe auf eine der Frauen. Jeremy zögerte. Bewaffnete Gangster zu erschießen war das Eine. Unbewaffnete, die das Pech hatten, sich mit einer Krankheit zu infizieren, waren schon etwas problematischer für ihn, aber er hatte sich damit arrangiert. Aber schlafende Frauen zu töten, das war dann doch eine Aufgabe, um die er nie gebeten hatte.
„Was ist?“, zischte John. „Kriegst du jetzt Skrupel?“
Ja, wollte Jeremy ihm ins Gesicht brüllen. Er war gut erzogen worden. Ihm wurde beigebracht, einer Frau die Tür aufzuhalten und ihr einen Platz anzubieten. Nicht, sie im Schlaf zu erschießen. Er hielt aber die Klappe und war froh, dass der selbsternannte Menschenkenner John ihn nicht durch die Schutzausrüstung lesen konnte.
„Nein“, antwortete er dann doch noch. „Fünfzig Yards weiter ist die Dritte. Wenn die die Schüsse hört, dann ist sie gewarnt.“
John dachte nach. Jeremy war sich nicht sicher, ob er ihm die Skrupel herauslesen konnte, oder ob er über eine neue Strategie nachdachte.
„Okay“, flüsterte John. „Such und erledige du die Dritte. Ich warte hier. Sowie ich einen Schuss höre, erledige ich die beiden hier.“
Jeremy nickte und entfernte sich in Richtung Küste. Auf halbem Weg dorthin ging das leichte Gefälle in einen deutlich steileren Abschnitt über. Das Meer hatte sich hier schon zum Teil weit ins Land hineingefressen. Jeremy musste sich einen anderen Weg suchen, um zum Wasser zu gelangen. Nach kurzer Zeit fand er eine Stelle, an der er, sich mit einer Hand am losen schwarzen Boden festhaltend, den Hang vorsichtig herunterrutschen konnte.
Jeremy wischte sich die Hand an seiner Hose sauber und warf einen Blick auf sein Smartphone. Zu seiner Überraschung war die Küstenlinie hier sehr akkurat dargestellt. Der Punkt, der die Gesuchte darstellte, befand sich nur wenige Yards hinter einem Felsvorsprung. Vorsichtig hangelte er sich um diesen herum.
Dann sah er sie, sie war direkt vor ihm. Sie hockte mit nacktem Oberkörper am Wasser und wusch sich. Ihr Shirt lag neben ihr auf einem Felsen. Dann sah auch sie ihn und erstarrte.
Einige Sekunden sahen sie sich gegenseitig an, dann streckte Jeremy langsam seinen Arm vor und richtete seine Waffe auf sie. Zu seiner Überraschung lächelte sie und stieß einige Geräusche aus, die er zuerst nicht einordnen konnte.
„Hah! Hah!“
Es war ein Lachen. Es war ein gequältes und gepresstes Stakkato, aber ein Lachen.
„Es ist gut“, sagte sie. „Ja, es ist gut. Tu, wofür du hier bist. Ich habe…“ Sie stockte. Er war nahe genug an ihr dran um zu sehen, dass sich die Tränen in ihren Augen sammelten. Sie schüttelte den Kopf. „Ja, es ist besser so. Besser als die Hölle. Ich bin vor ihr geflohen, aber ich werde sie immer mit mir tragen. Stimmt’s? Ich habe Dinge erlebt, die…“ Sie schüttelte wieder den Kopf und wischte sich die Tränen aus den Augen. „Der Schmerz bleibt. Solange ich lebe. Ich werde der Hölle nie wirklich entkommen.“ Sie stand auf, streckte die Arme zur Seite, schloss die Augen und legte den Kopf in den Nacken. Sie lächelte. „Hilf mir, zu entkommen…“
Jeremy zielte genau auf ihr Herz, atmete ruhig ein und wieder aus und drückte ab. Während sie ins Wasser fiel ertönten zwei Schüsse in sehr kurzer Abfolge, und nach einer Sekunde nochmal zwei.
„Ich hoffe, ich habe das Signal richtig gedeutet“, funkte John. „Die beiden schlafenden Schönheiten hier sind tot. Deine auch?“
„Ja.“
„Soll ich die Cleaner rufen oder machst du?“
„Mach du. Auf dich sind sie besser zu sprechen“, antwortete Jeremy. Das war gelogen, seinen Anfängerfehler mit der Blutspur im Feld hatten ihm die Kollegen bereits verziehen. Aber ihm war gerade nicht danach, die Cleaner zu rufen. Mit etwas Mühe kletterte er auf demselben Weg den Hang wieder hinauf, auf dem er zuvor heruntergerutscht war.
Es dauerte, bis die Cleaner da waren. Wegen der schweren Erreichbarkeit hatten sie auch einen Polizeihubschrauber geschickt. Dennoch mussten die beiden über eine Stunde warten, bis sie auch auf Spuren untersucht werden konnten. Sie waren beide sauber und konnten gehen.
Die ganze Heimfahrt über sagte Jeremy nichts. John erzählte hin und wieder etwas Belangloses. So lief wieder eins seiner Lieblingslieder im Radio und er schimpfte über den vorhergesagten Regen. Ja, Regen, dachte Jeremy. Der Regen, der hier deutlich häufiger fiel als in L.A. Er wusch das Blut weg und tränkte die fruchtbare Vulkanerde, die dann sprichwörtlich das Gras über die Sache wachsen ließ. Und die Menschen sahen nur den Regenbogen, ohne zu wissen, dass an seinem Ende das Blut einiger Mädchen klebte, die nur das Pech hatten, sich mit einem Virus zu infizieren. Jeremy begann, dieses Virus für das, was es von ihm verlangte, abgrundtief zu hassen.
Gegen halb zehn setzte Jeremy John ab.
„Schlaf gut, Kumpel“, sagte John. „Den Bericht schreiben wir morgen.“
Jeremy nickte ihm zu und fuhr nachhause. Er duschte und legte sich danach ins Bett. Aber er konnte nicht einschlafen. Dies war nicht das erste Mal seit seiner Ankunft auf Hawaii, dass er dieses Problem hatte. Ihm kamen Zweifel, ob er nicht doch den falschen Job hatte.
Seine Gedanken rasten ihm durch den Kopf, während er die Zimmerdecke anstarrte. Wenn er jetzt den Job kündigte, überlegte er, hätte er dann noch genug Geld auf der hohen Kante, um sich als Privatier durchzuschlagen? Eventuell könnte er mit dem Geld auch eine Strandbar aufmachen. In Lahaina, der Ort lebt ja vom Tourismus. Um überteuerten Alkohol an Touristen auszuschenken musste er selbst ja keinen trinken. Er versuchte, den für die Eröffnung einer Bar nötigen Aufwand abzuschätzen.
Nein, halt!, dachte er sich, als er sich dabei erwischte, dass er bereits sein Leben nach dem Polizeidasein plante. Wenn er an dem Punkt angelangt war, dann wäre er schon über die Zweifel hinaus. Er musste seinen Kopf freikriegen.
Jeremy stand auf, zog sich eine kurze Hose und ein Hawaiihemd an, ging zu seinem Auto und fuhr los.