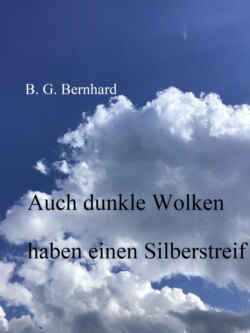Читать книгу Auch dunkle Wolken haben einen Silberstreif - B. G. Bernhard - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Im Labor
Оглавление„Ich dachte nicht, sondern ich untersuchte“
Wilhelm Conrad Röntgen
Nach der Belegschaftsversammlung verzog sich Thalheim in sein Labor, er wollte jetzt keine zwischenmenschlichen Kommunikationen. Er zog das Experimentieren, das Hantieren mit der toten Materie vor. Das Labor unterschied sich in der Grundausstattung kaum von anderen chemischen oder biochemischen Laboratorien. Große Laborschränke mit verschiedenen Glasgeräten, wie Bechergläsern, Messzylindern, Petrischalen, Glastrichtern, Flaschen mit Chemikalien standen an der Wandfront. Wasserbad, Zentrifuge, Fotometer waren auf Wandtischen platziert. Auf einem gesonderten erschütterungsfreien Wägetisch hatten eine Halbmikrowaage und eine Laborwaage ihren Platz. Kleine Roboter dienten zur Dosierung der winzigen Mengen an Reaktionsbestandteilen. Ein Reaktor zur Festphasensynthese von Proteowirkstoffen an polymeren Trägern stand etwas abseits.
Thalheim arbeitete gern experimentell. Die Umwandlung von chemischen Verbindungen – eben das Kochen der Ansätze – bedeutete ihm Erfüllung. Das war wahrscheinlich auch der Grund, dass er zu Hause übers Wochenende das Kochen der Mahlzeiten übernahm. Er benutzte in seiner Wohnung auch Erlenmeyerkolben und Bechergläser als Vasen und Karaffen oder auch mal als Trinkgefäß. Nicht eingeweihte Gäste wussten sehr schnell, dass sie bei einem chemisch Arbeitenden zu Besuch waren, wenn er mit typischer Berufsgestik nach dem Umrühren seines Tees mit der Spitze des Teelöffels die Innenseite des Teeglases berührte, wie er es eben von der quantitativen Analyse her kannte. Das Verfolgen der Reaktionen im Labor bereitete ihm in der Regel Befriedigung, gern veränderte er die Stoffe und stellte neue Verbindungen her. Für ihn waren die chemisch–biochemischen Versuche intellektuelles Handwerk, wofür er den Kopf wie die Hände einsetzen musste, alles im dosierten Verhältnis. Die Missachtung dieser ausgewogenen Beziehung wäre ihm einmal bald zum Verhängnis geworden. Während des Studiums unterrichtete er vertretungsweise in einer Schule Chemie. Zur Faschingszeit wollte er eine besondere Einlage geben und die Sinnesfreuden der Chemie spüren lassen. In eine schüsselförmige Reibschale, den Mörser, gab er eine Spatelspitze Chlorat und ebenso eine kleine Menge elementaren Schwefels. Er umwickelte die Hand mit einem Handtuch, mischte und rieb kräftig mit dem Pistill, dem keulenförmigen Stößel. Es sollte knistern und leicht knattern. Es tat sich nichts. Also fügte er noch mehr Schwefel hinzu und rieb. Mit einem riesigen Knall trat plötzlich die Reaktion ein, der Porzellanstößel war zerbrochen, das Handtuch hatte ein gewaltiges Loch – er als Experimentator war unverletzt, aber die Schüler der ersten Reihe bekamen Nasenbluten und in der Tür erschien kurz danach stürmisch die gesamte Lehrerschaft.
Die jetzigen Versuche waren komplexer Natur, er musste genau wissen, wo die Reaktionspartner angreifen sollten, unerwünschte Reaktionen waren zu unterbinden. Bei der Planung und Durchführung der Experimente, mit der konzipierten Versuchsstrategie im Kopf, dachte er nicht an andere Dinge, persönliche Probleme oder Fragestellungen waren verdrängt.
Thalheim synthetisierte bioaktive Eiweißkörper. Nacheinander wurden die verschiedenen Aminosäurebausteine in einem aufwendigen Verfahren aneinander gefügt. Wie bei der Paarung zweier Partner im Alltag suchte sich die aktivierte, reaktionsfreudige Carboxylgruppe eines Partners die reaktionsbereite Aminogruppe eines anderen Partners. Sie kamen sich näher. Sie umarmten sich sinngemäß. Die Elektronen des Stickstoffs an der Aminogruppe des einen Partners wurden von der partiell positiven Stelle am Kohlenstoff der Carboxylgruppe des anderen angezogen, sie näherten sich an. Sie vereinigten sich zu einer dauerhaft festen Bindung, der Peptidbindung. Die Kette wuchs. Nach Abspaltung der Schutzgruppe und der Freisetzung der endständigen Aminogruppe suchte sich diese wiederum einen vom Experimentator vorherbestimmten bindungsfähigen Partner in der Lösung, hielt ihn fest und vereinigte sich mit ihm. So bildeten sich hochspezifische langkettige, vielleicht spiralförmig verdrehte, teilweise gefaltete Strukturen heraus.
Thalheim strebte hochmolekulare Eiweißkörper an, die wichtige Lebensfunktionen ausführen können. Während er am Reaktor manipulierte, philosophierte er gedanklich. Wenn die Eiweißkörper Grundlage des Lebens seien, wenn Leben die Daseinsweise nativer Eiweißkörper sei, wie entstand dann das Leben, fragte er sich. Es gab verschiedene Erklärungsversuche, wie vor Milliarden Jahren Kohlenwasserstoffe und daraus auch Aminosäuren entstanden, die komplizierte organische Verbindungen, so auch Proteine und Nukleinsäuren bildeten. Dies geschah besonders im Umfeld vulkanischer Ausdünstungen. Aber wie wirkten diese Stoffe zusammen und wie vermehrten sie sich? Wie entstand lebende Materie mit Stoffwechsel? Bis heute nicht restlos geklärt.
Ein Anruf holte ihn zurück in die Jetztzeit mit den gerade erlittenen Demütigungen und öffentlichen Anklagen.
An diesem Tag beendete Thalheim pünktlich mit dem Klingelzeichen seine Arbeit. Voll innerlicher Wut stürmte er mit der Masse der Angestellten aus dem Werk.
Den Nachhauseweg wählte er durch den Großen Garten. Er sicherte sein Rad und wechselte die Kleidung. Sportsachen hatte er immer dabei, wenn er mit dem Rad unterwegs war. So durchlief er während seiner Joggingrunde den äußeren Bereich. Er begann auf der Südallee, rannte am Parktheater vorbei, überquerte die Hauptallee zum Neuen Teich neben der Drachenwiese und kehrte am Rhododendrongarten, vorbei am südlichen Kavalierhäuschen, wo in den neunzehnhundertzwanziger Jahren Oskar Kokoschka wohnte, zum Ausgangspunkt zurück.
Die Kränkungen und Schmähungen des Nachmittags konnte er so etwas vergessen.
Aber er brauchte jemand zum Schwatzen. Bevor er zu seiner Wohnung in der dritten Etage emporstieg und seine Frau Sonja begrüßte, klingelte er im Erdgeschoss bei Frau Mehnert. Sie sah ihm die Sorgen und auch Wut in seinem Gesicht an, kredenzte aus einer Flasche die Reste eines Pfeffis und ließ ihn über den verteufelten Arbeitstag berichten. Er schilderte, dass er im Labor am besten die Diffamierungen und Herabwürdigungen vergessen könne. Die chemischen Vorgänge in seinen Retorten verlangten die volle Aufmerksamkeit. Frau Mehnert wollte wissen, wie er denn auf seinen Chemieberuf gekommen sei. Er meinte, dass dies schon in der Kindheit begonnen habe. Aber um dies alles zu schildern, müsse er weit ausholen und eine lange Geschichte erzählen. Sie vereinbarten, dass Frau Mehnert zum Wochenende zum Kaffee zur Familie Thalheim kommen möge.
In dem Moment als Thalheim gehen wollte, klingelte Herr Zietschmann an Frau Mehnerts Wohnungstür. Zietschmann hörte, wie eine Etage über ihm die Tür lautstark ins Schloss fiel. Mit harten Trippelschritten auf den Steinstufen kam die Fürstin, wie sie im Haus genannt wurde, die Treppe herunter. Ihre graziöse, leicht tänzelnde, aufrechte Haltung unter Betonung ihres Vorderbaus und wackelndem Hinterteil brachten ihr den Necknamen ein. Sie trug einen kleinen Koffer. Frau Mehnert öffnete gerade die Tür, als die Fürstin grüßend an ihnen vorbei ging.
„Seien sie gegrüßt, Frau Winterstein. Wollen sie verreisen?“
Frau Winterstein verweilte kurz.
„Nur hundertfünfzig Kilometer weiter. In unserem Land kann man doch keine großen Reisen machen.“
Eilig verschwand sie durch die Haustür und hinterließ eine Wolke durchdringenden Luxusparfüms, das eine Assoziation zur großen weiten Welt hervorrief.
In Mehnerts Wohnung meinte Zietschmann, dass dieser Duft schon die Sinne entzücken könne. „Dr Dunst haud einm um, dr durschdringd alles.“
„Ich tippe auf Chanel oder Chypre, solche französische Noten habe ich oft bei meinen Schauspielerkolleginnen erschnuppert“, sagte Frau Mehnert.
„Wohin wärtse denn fahrn?“
„Aber Herr Zietschmann, es ist Messezeit in Leipzig“, sagte Frau Mehnert.
„Aus aller Welt kommen die noblen Herren, Manager, Handelsleut‘“, meinte Thalheim, der eigentlich schon gehen wollte.
„Nu dlar, Leipzcher Messe. Un was macht se dort?“
„Herr Zietschmann, wie kommt man an betörende Düfte und Devisen?“
„Ja, ja, isch wees Bescheid. Wenn immer in dr erstn Edache de ‚lustsche Zeit‘ ist, wärn de Fenster geöffned, damit alle was drvon ham.“
„Zietschmann, das erinnert mich an Wilhelm Busch –
Dorette weiß auch voll List,
wo Knopp seine lustige Stelle ist.
Und unter die Decke eingebohrt,
wo man recht fröhlich herumrumort.“
Frau Mehnert wollte das weitere kriminalistische Vorgehen in der Sache Läufer mit Zietschmann besprechen. Da musste Thalheim noch bleiben und sich über den aktuellen Stand unterrichten lassen. Frau Mehnert informierte über das Neueste.
Familie Fabius wechsle mit Familie Mehlhorn kein Wort mehr, man gehe sich aus dem Weg. Wenn Mitglieder der Familie Fabius Geräusche und Bewegungen an der Tür der gegenüberwohnenden Familie wahrnehmen, warteten diese, bis wieder Ruhe eintrete, ehe sie die Tür öffneten.
Täglich am späten Abend sei Frau Mehnert in den vergangenen Tagen die Stufen bis zum vierten Stock hinauf gestiegen. Aus dem Türschlitz der Familie Fabius sei kein Licht erkennbar gewesen, also ein Indiz dafür, dass in der Wohnung alle schliefen. Kurz über der Schwelle habe sie mit Knetmasse ein langes Haar an Tür und Rahmen befestigt. Herr Zietschmann habe den Auftrag von ihr gehabt, früh morgens zeitig ihre Konstruktion zu überprüfen, bevor alle die Wohnung verließen. Er habe an keinem Tag eine Beschädigung festgestellt.
Sie habe gehört, dass Frau Fabius jeden Tag den Läufer Millimeter genau vermessen habe, sie habe die Werte in eine Tabelle eingetragen. Es sei Fakt, der Teppich werde immer kürzer, er franse weiter aus.
Über eine Woche habe man ermittelt und keinen Anhaltspunkt gefunden, dass jemand versucht habe, von außen in irgendeiner Art an den Läufer zu kommen.
„Thalheim, es ist Tatbestand, dass die Ursache in der Wohnung zu suchen ist“, sagte Frau Mehnert.
„Vielleischt will dr Sohn Garle seinr Mudder äns auswischn, se is doch sei Stiefmudder oder dr Babbah will sei Frau ärchern. Wir wärns nisch glärn, vielleischt bringt´s de Sonne an dn Dag“, meinte Herr Zietschmann.
„Ja, das scheint ein innerfamiliäres Problem zu sein. Frau Mehnert, Sie müssen mit Frau Fabius weiter im Gespräch bleiben. Vielleicht finden Sie ein Indiz“, sagte Thalheim. Danach verabschiedete er sich und sagte im Hinausgehen:
„Dann bis Sonntag, zwei Uhr, ich habe viel zu erzählen.“