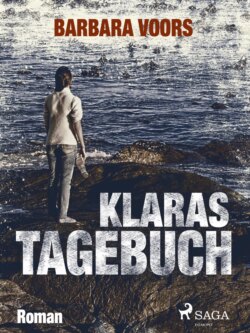Читать книгу Klaras Tagebuch - Barbara Voors - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеNicht von mir wird diese Geschichte handeln, sondern von meiner Schwester. Was läßt sich darüber sagen, Schwester zu sein? Daß es verheerend ist? Zerstörend? Wundervoll? Die Beziehung zwischen Klara und mir ist eine von der bedrängenden Art, bei der man bis zum Überdruß liebt, es ist die Art Schwesternschaft, an der eine schließlich sterben muß. Ich weiß nicht, warum. Kann es daran liegen, daß wir uns immer gezwungen fühlten, in die Haut der anderen zu schlüpfen? So wie es auch bei engen Freundinnen ist, die keine Mauern zwischen sich zulassen? Die Grenze, wo deine Haut beginnt und meine endet, ist zwischen Schwestern einfach ausradiert. Ich weine, wenn du weinst, leide, wenn du leidest, blute, wenn du blutest.
Meine Zwillingsschwester gibt es nicht mehr. Ich rede so schön über dieses Schwestersein, und in Wirklichkeit ist meine andere Hälfte tot. Als große Schwester – nur ganze acht Minuten älter, doch, glaubt mir, sie waren entscheidend – bin ich immer die Stärkere gewesen. Mit der selbstverständlichen Autorität, die der Älteren zusteht, habe ich Befehle erteilt und die Führung übernommen. Immer habe ich einfach Anweisungen gegeben, ohne sie jemals zu bitten: »Sag mal, könntest du mir nicht helfen?« Habe immer gesagt: »Mach jetzt folgendes ...!« Ich bin die kompetente, unbeirrbare, erfolgreiche große Schwester, die stets zur Stelle war, um die Dinge zu übernehmen, wenn es nötig sein sollte. Es war nötig. Ich übernahm sie. Und Klara verschwand.
Zehn Jahre ist es jetzt her. Man gewöhnt sich nie daran. Trauer hat kein Ende. An manchen Tagen fällt das Aufwachen leichter, das ist alles. Stunden können vergehen, in denen man überhaupt nicht daran denkt. Trotzdem nimmt die Trauer kein Ende. Nur die Vormittage ohne nennenswerten Schmerz werden länger. Klara war eine Schwester, die es einem so leicht machte, sie zu lieben, daß es mir schon Sorgen bereitete. Sie war so voller Liebe, daß sie Menschen, die der Rettung bedurften, unwiderstehlich anzog. Ist man wie Klara, die dafür lebte, andere vor dem Zugrundegehen zu bewahren, dann wird es verhängnisvoll. Und es wurde verhängnisvoll. Ich glaube, niemand kann einen anderen Menschen vor dem Untergang retten. Hat man Glück, findet man jemanden, der das Beste aus einem herausholt, mehr ist nicht möglich. Will ein Mensch den Tod, können wir nichts tun, um ihn am Fallen zu hindern. Ich wünschte, ich hätte das Klara deutlich machen können. Doch zu jener Zeit lag ich gleichsam brach, erreichte nicht den Boden, den meine Schwester betreten hatte. Ich war jene Schwester, die der Dinge harrte, ich war Saskia, die ihre Zeit abwartete.
Klara stand Desirée fast ihr ganzes Leben lang nah, vom zehnten Lebensjahr an bis zu ihrem Tod im August 1984, als sie gerade dreißig war. Ich selbst hingegen habe Desirée nicht besonders gut gekannt, ich gehörte nicht zu denen, die sie in ihren Bann ziehen konnte. Ich habe nur gesehen, welche Auswirkungen ihr Tun hatte, ich war die Person, die hinterher Ordnung schaffen mußte. Desirée ist schuld, daß ich nur ein halber Mensch bin. Das kann ich ihr niemals verzeihen. Ich wünschte, ich müßte nicht in der Sache herumstochern, aber ich habe keine Wahl. Doch, natürlich habe ich die Wahl, genau das habe ich begriffen. Zehn Jahre sind vergangen, und ich bin alt genug, dürfte es sein, um kleinere Schläge im Leben zu verkraften. Zu meinem Erstaunen war das aber nicht der Fall. Ein harmloser Sturz, und meine Welt brach auseinander. Davon will ich jetzt erzählen.
Seit fast zehn Jahren bin ich verheiratet mit Magnus – wir sind ein modernes Paar, ich habe meinen Mädchennamen Van Ammer behalten, er heißt Ehrengren –, und zusammen haben wir dieses Erstaunliche geschaffen, das man ein Kind nennt, eine Tochter, jetzt fast neun Jahre alt, die Malin heißt. Wir wohnen in Amsterdam, der wirklich freiesten und schönsten aller Städte. Ein paarmal die Woche pendle ich zur Universität nach Groningen, wo ich schwedische Literatur lehre. Ich habe den Ruf, eine feministische Literaturwissenschaftlerin zu sein. Darauf bin ich stolz, weil es etwas ist, für das ich mich mein Leben lang engagiert habe. Ich bin der Ansicht, daß ein Mensch die Pflicht hat, einen Weg, der für ihn bestimmt ist, auch einzuschlagen. Schwäche und Faulheit ertrage ich nur schwer, ebenso bloßes Gerede, dem keine Taten folgen. Magnus sagt, meine Haltung den Menschen gegenüber sei zynisch. Ich antworte ihm, wenn es tatsächlich so ist, hat mich mein Leben dahin gebracht. Er schüttelt den Kopf über mich, was Psychotherapeuten bei ihrer Arbeit nicht dürfen. Doch bin ich nicht seine Patientin. Darauf weisen wir uns gegenseitig immer wieder deutlich hin.
Ich habe nur wenige Freunde, vielleicht sollte ich sagen, ich habe keine. Kann man Kollegen, mit denen man nach der Arbeit ein Bier trinken geht, Freunde nennen? Ich glaube nicht. Sie könnten es vielleicht werden, doch ich lasse es nicht zu. Immer sorge ich dafür, daß ein Zug auf mich wartet. Damals, vor langer Zeit, spielte ich stets mit offenen Karten und ließ die Menschen beunruhigend nahe an mich heran. Ich will nicht, daß es sich noch einmal wiederholt. Ich weiß, was sie einem antun können, weiß genau, was daran wunderbar und was entsetzlich ist. Ich tue es nicht noch einmal, tue es einfach nicht.
Mein Vater ist Holländer, meine Mutter Schwedin, ich selbst habe mich für die holländische Staatsbürgerschaft und Vaters Namen entschieden, Klara hat den schwedischen gewählt: Mårstedt. Es ist immer so gewesen: Ich war Papas Töchterchen und Klara das von Mama. Mit Malin sprechen wir schwedisch, ansonsten sind wir eine ganz und gar holländische Familie hier in unserem Haus, das man twee onder één kap nennt, zwei Familien unter einem Dach. Hier lebe ich, hier habe ich all die Jahre überlebt, und ich finde, ich habe wirklich das große Los gezogen, denn ich bin, was nicht gerade oft vorkommt, glücklich gewesen. Gemeinsam haben wir drei uns eine Freistatt geschaffen, und zusammen mit Magnus bin ich zu etwas geworden, was ich nie für möglich gehalten hätte: mein allerbestes Ich. Wir waren entkommen, die Welt hatte uns freigegeben. Bis vor wenigen Monaten.
Ein Radfahrer fuhr mich von hinten um, daran war nichts Besonderes. Amsterdam ist die Gelobte Stadt des Fahrrads, die Leute fahren, wie und wo immer sie wollen, die Gepäckträger überladen, keiner trägt einen Helm, die Räder klappern laut, und mir hat das immer enorm gefallen. Es war wirklich nichts Besonderes, ganz plötzlich lag ich da in der Prinsengracht, ein junger Mann auf meinen Beinen, und über uns rotierte sein Rad. Doch als ich den Kopf nach hinten bog, sah ich durch die gebrochenen Speichen, wie sich die Welt blitzschnell im Kreise drehte. Sie war nicht mehr dieselbe. Durch die Speichen sah ich, äußerst langsam – denkt man nicht, es müßte furchtbar schnell gehen –, wie all die Jahre zurückkehrten, die ich hinter mich gebracht hatte. Ich war ganz und gar nicht frei.
»Kommst du klar?« fragte der junge Mann recht unbeschwert, denn er wußte, was Leute, die ihren Stolz haben, auf so eine Frage antworten.
»Nein«, hörte ich mich sagen. »Nein, ich glaube nicht. Ich komme nicht klar.«
Verwirrt hörte der Mann auf, seine Kleider abzuklopfen, und rasch sammelte sich ein Trupp engagierter Amsterdamer Damen um uns, die mal dem Mann Anweisungen erteilten, mal meine Hand streichelten. Beharrlich wie ein Kind hörte ich mich selbst wiederholen: »Nein, ich komme nicht klar.«
Hatte ich Schmerzen? Tat mir was weh? Hatte ich mir ein Bein gebrochen? Nein. Sie riefen meinen Mann vom Handy des Radfahrers an – auch das erregte Aufsehen, gab es tatsächlich Leute, die so ein Ding bei sich trugen –, und Magnus kam. Als er mich ansah, fing ich zu meinem Erstaunen an zu weinen. Vielleicht, weil ich ahnte, was kommen würde.
»Saskia«, murmelte er. – »Magnus«, flüsterte ich. »Magnus, Lieber, erzähl von uns.«
Die Menschenansammlung verlief sich, der Mann, halbe Entschuldigungen murmelnd, verschwand, und zurück blieben nur Magnus und ich, ganz liebevoll gingen wir miteinander um, so wie wir es immer taten, so wie es eigentlich immer hätte sein sollen. Jetzt, wo Erschöpfung und ein schlechtes Gedächtnis unser Zusammenleben prägen, vermisse ich das so sehr.
»Erzähl von uns«, wiederholte ich, vielleicht, weil ich wußte, daß das hier der Anfang vom Ende der zehn Jahre Frieden war, weil ich wußte, daß wir überhaupt nicht entkommen waren, während ich zugleich verzweifelt versuchte, die Zeit des Glücks festzuhalten, die unwiderruflich vorbei war.
»Ich verspreche es«, sagte Magnus, als begriffe er nichts von dem, was kommen würde.
Man schrieb mich krank. Magnus hatte sich darum gekümmert. Er hat immer gewußt, wann es Zeit ist zu fliehen. Auch ich wußte, wo ich hinfahren, wo ich Ordnung schaffen mußte. Jetzt sind wir hier, in Mutters Haus in den Stockholmer Schären. Wir nennen den Ort »Die Insel«, denn das Haus liegt auf einer Insel, und als Kinder haben weder Klara noch ich begriffen, warum man Dingen einen Namen geben, sie voneinander unterscheiden mußte. Die Schären waren schließlich voller Inseln, und auf einer von ihnen wohnten wir. Außerdem wußten wir ja, wie die Anlegebrücke aussah, an der wir aussteigen mußten. Wir kannten unsere Insel, wir kannten unser Haus, das reichte. Doch jetzt ist die Insel bis zur Unkenntlichkeit verkommen. Nun ja, nicht die ganze Insel, aber das Haus meiner Familie, wo Klara und Saskia ein paar ihrer Kindheitssommer mit Papa Joop und Mama Elisabeth verbracht hatten. Das war lange vor der Scheidung gewesen, die die Familie buchstäblich in zwei Teile zerbrach. Die mich zerbrach.
»Saskia, das Haus verkommt jetzt schon lange genug«, hatte Magnus immer wieder gemahnt.
Und meine Tochter Malin hatte in diesem überraschenden und manchmal unerträglichen Ton hinzugefügt, den sie seit ein paar Monaten an sich hatte – ich weiß sehr wohl, wo er herkommt, sie hat ebensoviel Angst wie ich –: »Genau, Mama. Lange genug.«
Und jetzt sind wir also hier: im Frühsommer 1994.
Dieses Haus gehört Klara. Ich weiß es. Ich spüre es daran, daß meine Schritte langsamer werden vor dem steilen Hang, der zum Haus führt, das mein Vater zusammen mit Großvater auf dem Felsen gebaut hat. Es macht mir unglaubliche Mühe, den Hang gerade und unverkrampft hochzugehen. Die Arme werden nach unten gezogen, unsere Einkaufsbeutel sind bleischwer. Magnus wirft mir einen bekümmerten Blick zu. Ich mag diese Art nicht, wie er mich neuerdings oft ansieht. Meine Familie macht mich nervös. Es fällt mir schwer, sie zu lieben. Das einzige, was ich mir jetzt wünsche, ist, in Ruhe gelassen zu werden. Wenn ich nur wüßte, warum. Ich weiß genau, warum.
»Klara«, flüstere ich vor der Tür, deren Innenseite noch die Striche aufweist, die unsere Größe mit entsprechendem Alter markierten. Nun bin ich wirklich hier.
Der Nachbar ist auf seine Veranda getreten, um die Neuankömmlinge zu betrachten. Mir bricht der Schweiß aus, obwohl ich weiß, daß die meisten auf dieser Seite der Insel erst kürzlich zugezogen sind und nichts wissen dürften von den Dingen, die sich vor zehn Jahren ereignet haben. Die Tür klemmt, Magnus greift ein, und sie öffnet sich mit einem Knarren. Das macht mich noch nervöser. Ich sehe ihn nicht mehr an. Malin ist als erste im Haus. Ihre Augen glänzen vor Entzücken, sie bemerkt nicht den Staub von drei Jahren, nicht die Berge von Fliegen in den Ecken, die Waldmaus, die tot im Spülbecken liegt, die Möbel, die nach vierzig Jahren rissig und ausgeblichen sind. Sie sieht die Möglichkeiten, wie ich es früher getan hätte, vor dem Sturz und der großen Müdigkeit, der Apathie und dem schlechten Gedächtnis.
»Das ist super, Mama«, ruft sie und springt vor Freude umher.
Magnus läuft ihr nach, packt sie und läßt sie mit dem Kopf nach unten baumeln, bis ihr Gesicht vor Lachen und Erregung rot ist. Ich murmle: »Phantastisch.«
Wie soll ich diesen Sommer hinter mich bringen?
Wir machen den ganzen Tag Ordnung. Auf mein Geheiß. Ich installiere meinen Computer im Zimmer, wo ich zu arbeiten gedenke, und lege meine Forschungsergebnisse und die anderer in fein säuberlichen Stapeln auf den Schreibtisch. Ich bin ein ziemlich kühler und systematischer Mensch – wenn auch jetzt krankgeschrieben –, es sind diese Eigenschaften, die mir Erfolg in der akademischen Welt beschert haben. Es gibt so viele vergessene Schriftstellerinnen. Ich habe es zu meinem Anliegen gemacht, der Öffentlichkeit zu zeigen, daß nicht nur Männer das Patent besaßen, die Welt zu beschreiben. Ich weiß, daß derjenige, der sie beschreibt, auch die Macht über sie hat. Mein Ziel war es, andere Erklärungsmuster zu liefern. Für mich sind Frauen, besonders die Autorinnen des 19. Jahrhunderts, die im Hintergrund gelebt haben, eine Goldgrube geworden, und sie haben mir Titel, Stipendien und Auszeichnungen gebracht. Titel gefallen mir. Mir sind im Leben so viele Menschen ohne jedes Etikett begegnet, ich kenne die Risiken und bin auf der Hut. Ein zynischer Mensch bin ich keineswegs, ich bin nur müde und mag keine bekümmerten Blicke. Ich liebe die Arbeit. Das einzige, was ich will, ist, mich um das Meinige zu kümmern und Ruhe zu finden. Deshalb bin ich hier, habe ich zu Magnus gesagt. Und natürlich auch, um mir dieses verkommene Haus, meine Familie, meine Geschichte, alles, was ich bin, vorzunehmen. Viel Staub ist wegzuwischen, ich tu es nicht gerade mit Freude. Um die Waldmaus muß Magnus sich kümmern. Ich habe genug vom Tod, doch scheint der Tod nicht genug von mir zu haben. Drei Jahre ist es jetzt her, daß Mutter gestorben ist, drei Jahre, in denen ich hätte herfahren und das Haus aufräumen sollen, das sie geliebt hat, das Haus, in das ich, seit Klara verschwunden ist, keinen Fuß gesetzt habe.
Meine Mutter war eine emanzipierte Frau. Sie starb auf einer Vorstandssitzung am Herzinfarkt, so wie es männliche Direktoren tun. Meine Mutter war erfolgreich, und sie starb einen für erfolgreiche Menschen normalen Tod. Ich hätte es lieber gesehen, wenn sie dem Tod ein Schnippchen geschlagen, ihren Posten als einzige Frau im Vorstand behalten und statt dessen hier in der Tür gestanden hätte, um mich zu empfangen. Daß sie die Sache mit Klara nicht mir allein überlassen hätte. Magnus sieht, was ich denke, an wen ich denke. Er weiß mehr von mir, als ein Mann über seine Frau wissen sollte. Er stört mich unendlich.
»Es ist nicht, wie du glaubst«, sage ich leichthin.
»Ich glaube nichts.«
»Aber du weißt eine Menge.«
»Ja.«
»Zum Beispiel?«
»Daß wir hier aufräumen müssen. Und daß wir hier den ganzen Sommer bleiben müssen, daß du Ruhe brauchst und wir nicht nach Amsterdam zurückkehren können, bevor es geschafft ist.«
»Ja.«
»Was ist?«
»Wie wäre es, wenn du in deinen Ecken aufräumst und ich in meinen?«
Ich räume die Liebe aus unserem Leben weg, und das erfordert nur wenige Worte, barbarisch wenige. Liebe erfordert Sanftmut und ein gutes Gedächtnis, damit man den Anlaß für seine Versprechen lebendig hält. In den letzten Monaten – oder ist es schon länger her – ist unser Liebesleben in Vergessenheit geraten. Unser Ehebett steht verstaubt, und ich bin schuld daran. Magnus wird es nicht so weitergehen lassen: Er hat ein scharfes Gedächtnis. Doch kennt auch er nicht die ganze Wahrheit. An Malin, die mich nicht mehr anfaßt, an ihrer Art, sich zu bewegen, merke ich, daß ich sarkastisch geworden bin, manchmal sogar gemein. Das ist nichts, worauf ich stolz bin, aber es hilft einem beim Überleben, besonders mit einer Geschichte, wie ich sie habe. Doch werde ich mich um Gottes willen vor Fahrrädern hüten, ich glaube nicht, daß ich noch einen Zusammenstoß verkrafte.
Beim Aufräumen gelange ich ins Schlafzimmer meiner Mutter. Dort steht ein einsames Bett. Ich sehe sie vor mir, allein draußen auf der Veranda, allein im Bett, und wie sie das Essen für nur eine Person zubereitet. »Warum sind erfolgreiche Frauen so einsam?« frage ich Magnus. »Das ist nicht so einfach zu sagen«, antwortet er. Natürlich ist nichts einfach. Doch was ich mich immer gefragt habe: Warum kommt es so häufig vor? Mutter. Ich hätte öfter hier sein sollen. Ich hätte hier sein sollen. Neben ihrem Bett steht der Nachttisch, den Vater und ich in einem Sommer gebaut haben. Er ist blau, mit Rosen bemalt, die Rosen sehen eher aus wie explodiertes Preiselbeerkraut. Auf dem Nachttisch steht ein Kinderbild von Klara und mir, in genau den gleichen Kleidern mit lila Rock und gepunktetem Mieder, vor unserem Zuhause in Arnhem, in Holland. Neben unserem Foto steht eins von Vater, und es geht mir durch den Kopf, wie wenig ich von meiner Mutter weiß. Dort liegt auch ein Brief. Er ist an mich adressiert. Ich starre ihn lange an, schüttle den Staub von der Tagesdecke und lege mich aufs Bett. Dann greife ich nach dem Brief. Er ist nicht beendet worden, fast nur ein Entwurf und nach dreijährigem Warten ein wenig vergilbt. Drei Jahre Warten auf mich. Dort steht:
Meine geliebte Tochter,
ich weiß, was Du nicht willst, und auch, was Du meinst, nicht zu können. Aber, glaub mir, ich kenne Dich durch und durch – ich, wenn überhaupt jemand, weiß, was Du tun mußt. Du hast schon verstanden. Ich will, daß Du auf den Boden hochsteigst. Dort wirst Du einen grünen Pappkarton finden, und Du wirst genau wissen, was da drin liegt. Er ist deutlich sichtbar hingestellt. Ich will, daß Du das liest, was Du dort findest, und ich bitte Dich, die Konsequenzen zu ziehen. Du mußt die Wahl treffen, die von Dir gefordert wird, um Malins willen, um Magnus’ und Deinetwillen. Denke daran, daß ich Dich immer liebe. Ich weiß nicht, ob Dir das genügend Kraft geben kann. Als Mutter wünscht man, daß die eigene Liebe die Kinder vor all den Dingen schützt, die weh tun. Aber so ist es nicht. Wir wissen es nur allzu gut. Ich schreibe das hier, weil ich weiß, daß nichts einfach sein wird, daß ich vielleicht ...
Es scheint, als hätte sie den Stift nur weggelegt, um ein wenig nachzudenken. Doch etwas mußte sie in die Stadt zurückgezogen haben, irgendeine Arbeit, die nicht warten konnte, und sie hatte sicher vorgehabt, hierher zurückzukehren und den Brief zu beenden, doch statt dessen brach sie tot zusammen. Ihre Art zu schreiben wirkt, als hätte sie geahnt, daß etwas geschehen würde. Als ob sie gewußt hätte, daß sie ein paar Dinge beenden müßte, das Haus aufräumen, einen Brief an mich schreiben, auf Sitzungen gehen. All das, außer sich Ruhe zu gönnen, Luft zu holen, sich um sich selbst zu kümmern in einem dieser eitlen, doch hilflosen Versuche, den Tod nicht an sich ranzulassen. Was für ein Recht habe ich, darüber zu urteilen, wie sie gelebt hat? Jedes Recht. Ich gebe mein Urteil ab, weil ich weiß, daß ich ohne sie keine Chance habe. So wenige sind es, die die Wahrheit kennen, und einer nach dem anderen sterben sie. Bald bin nur ich allein übrig. Nur ich. Mit einer Erinnerung so unglaublich leer.
Klara. Es gibt keinen Weg zurück, kaum einen vorwärts. Ich weiß alles von dir, ich weiß nichts von dir. Ich weiß, wie es war, wenn du geliebt hast, doch kann ich das Gefühl nicht mehr spüren. So lange bin ich eine Frau ohne Vergangenheit gewesen, daß ich vergessen habe, wieviel Wärme man empfindet, wenn man mit Erinnerungen lebt. Mein erwachsenes Leben habe ich der Forschung gewidmet, ich beschäftige mich mit Menschen, die vor hundert Jahren gestorben sind, ohne zu begreifen, daß darüber zehn Jahre meines Lebens vergangen sind. An mein eigenes Leben erinnere ich mich überhaupt sehr schlecht, während ich alles über ein paar jener Frauen weiß, die die Welt im 19. Jahrhundert geschildert haben. Wer bin ich geworden? Meine Mutter will, daß ich auf den Dachboden steige. Malin will, daß ich bei ihr bin. Magnus will eine Frau haben, die wieder lieben kann. Klara will, daß man sich an sie erinnert. Desirée will erneut gerettet und akzeptiert werden. Und ich? Ich will nach Amsterdam zurückkehren, wo ich mir ein Leben aufgebaut habe und mich niemand von früher her kennt. Ich will nach mir selbst suchen, indem ich das Leben anderer, doch nicht mein eigenes ergründe. Meine Mutter aber will, daß ich diesen Sommer auf den Dachboden steige. Sie will, sie verlangt, daß ich mich den Dingen dort oben stelle.
Den ganzen Tag verbringe ich damit, Mut zu fassen. Es gelingt mir nicht. Der Abend bricht an, dann die Nacht, und mit ihr kommt die Schlaflosigkeit. Ich weiß, daß ich keine Ruhe finden werde, bevor ich die Sache erledigt habe. Das Gehirn schläft nie. Mein Gehirn schweigt niemals. Ich wünschte so sehr, daß ich es abschalten könnte, auch wenn es nur für ein paar Nachtstunden wäre. Ich höre Magnus atmen und im Nebenzimmer Malin im Schlaf reden. Um Malins willen? Ich verlasse das Bett und schleiche in die Diele, wo sich die Luke zum Boden befindet. Vorsichtig ziehe ich die Treppe herunter, die erstaunlich leicht vor meine Füße klappt. Es riecht nach Öl. Ich habe keine Angst; ich habe so viel Angst, daß es mich schüttelt. Sich zwischen dem rechten und dem linken Fuß zu entscheiden, bereitet unüberwindliche Schwierigkeiten. Ich schließe die Augen und versuche es mit beiden Füßen. Es gelingt nicht. Bin jetzt allein, nur ich bin übrig, keine Bücher gibt es zum Schutz gegen die Erinnerung, keine Blicke, denen man ausweichen, keine Fragen, auf die man gereizt antworten kann. Ich könnte die Treppe geräuschlos wieder in Richtung Himmel schieben. Wäre es nicht am besten so? Wenn Geheimnisse begraben, verschwundene Menschen tot blieben, unsere Sünden vergeben sein könnten? Als ich auf dem Dachboden ankomme, stoße ich direkt neben der Luke auf den grünen Karton. Nein, Mutter, ich konnte ihn nicht verfehlen. Ich kauere mich hin und betrachte ihn. Es ist ein alter Karton mit Stahlkanten und einem Metallrähmchen auf der Vorderseite, in den ein Zettel mit Inhaltsangabe gehört. Diesem hier fehlt das Verzeichnis. Meine Finger heben den Deckel hoch, und zuoberst liegt ein leeres Blatt Papier. Ich nehme es weg, und ein weiteres folgt. Blatt für Blatt, alle leer, und Panik überfällt mich bei dem Gedanken, daß all das Papier im Karton wirklich leer sein könnte, obwohl es so natürlich am besten wäre. Doch nein, da erscheint schließlich ein vergilbter Zeitungsausschnitt auf einem Stapel von Schreibheften. Die Notiz ist kurz, der Ton sachlich, die Sprache nüchtern. Niemand hatte damals wohl geahnt, daß dieser Notiz aus der Mitte der achtziger Jahre ein Artikel nach dem anderen folgen würde, bis der Fluß der Nachrichten wegen fehlender Klärung versiegte. Der Ausschnitt trägt das Datum vom 23. August 1984. Dort steht:
In einem Haus, unweit von Stockholm, wurden gestern zwei Menschen tot aufgefunden. Die Frau, 33, war in den Kopf und der Mann in die Brust geschossen worden. Im Zusammenhang mit den Todesfällen wird vom Verschwinden einer dreißigjährigen Frau berichtet. In letzterem Fall hat die Polizei Anlaß, Selbstmord zu vermuten. Eine Leiche wurde jedoch noch nicht gefunden, und die Umstände der Sache sind äußerst unklar. Es ist ebenfalls unklar, ob und wie dieses Verschwinden mit den beiden Todesfällen in Verbindung zu bringen ist.
Die erschossene Frau hieß Desirée Cronenfelt. Sie war Klaras beste Freundin. Der Mann hieß Henrik von Rensen. Er war eins von Desirées Spielzeugen. Die verschwundene Frau war Klara Mårstedt. Ich bemerke, daß ich weine. Das einzige, was ich denken kann, ist seltsamerweise: Könnte sie doch wieder zu mir nach Hause finden. Tief in mir höre ich einen Schrei. Ich war es, die immer wieder geschrien hatte: »Mein Gott, gibt es nicht jemanden, der mir helfen kann.« Dieser jemand war Magnus.
Unter der Notiz liegen Klaras Tagebücher. Sie sind an mich adressiert, ich weiß es. Mutter hat einen Zettel darauf gelegt mit dem Datum der Hefte: Herbst 1980 bis Sommer 1984. Ich glaube, das hier wird ein langer Sommer. Ich weiß nicht, wer ich sein werde, wenn er vorüber ist. Das erschreckt mich. Mir bleibt noch jede Wahl, doch habe ich das Gefühl, als hätte ich keine mehr. Nur diese: Klara, geliebte Klara, meine Schwester.