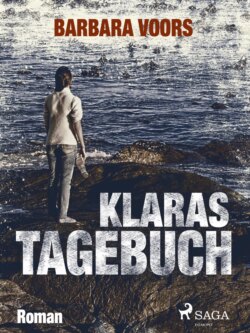Читать книгу Klaras Tagebuch - Barbara Voors - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеStockholm, Januar 1981
Liebe Saskia,
ich schreibe ohne jedes System, ohne Forderung nach Konsequenz und Regelmäßigkeit. Ich schreibe, wenn ich nicht mehr weiß, wer ich bin, wenn ich vor einem Schaufenster stehenbleibe und dem Blick einer Fremden begegne und begreife, daß diese Verrückte dort ich bin. Ich habe diesen Herbst und Winter vielleicht intensiver gelebt als je zuvor. Habe wirklich gelebt. Das ist nicht nur einfach, ich habe Dinge über mich gelernt, auf die ich nicht stolz bin – mein mangelndes Gefühl für Moral und Verantwortung, meine Mitschuld –, und ich habe Sachen bei anderen entdeckt, die ich, wenn ich selbst hätte wählen können, lieber nicht gewußt hätte. Aber wählen konnte ich nicht. Ich gewöhne mich daran, so muß es einfach sein, gewöhne mich an die Eigenarten im Leben von Erwachsenen.
Desirée ist es, die mein Leben lenkt und meine Zeit bestimmt. Vielleicht sollte ich sagen, sie und ich tun es, aber ich habe meist das Gefühl, als sei sie es allein. Die Sache ist schwer zu erklären, doch werde ich von ihr angezogen, oft gegen mein eigenes Bestes, ja selbst, wenn ich weiß, daß ich eigentlich gehen sollte, bleibe ich. Ob es ihre Stärke oder ihre Schwäche ist, die mich festhält, ist mir nicht klar. Ich habe nicht gewußt, daß ein Mensch, der eine solche Ausstrahlung, eine solche Anziehungskraft besitzt wie Desirée, gleichzeitig so schwach sein kann. Und mich obendrein so sehr brauchen würde. Ich will sie dir beschreiben: Ihr Haar ist kupferrot und ganz glatt, reicht bis kurz unters Kinn und liegt wie ein Helm um ihren Kopf. Manchmal versteckt sie ihr Gesicht hinter den Strähnen, manchmal schiebt sie das Haar hinter die Ohren, mit einer Geste, die andeutet, daß es rasch wieder zurückfallen wird, daß sie gezwungen ist, noch einmal von vorn zu beginnen, doch tue das nichts zur Sache, denn schließlich haben wir alle Zeit der Welt. Oder etwa nicht? Sie hat einen zierlichen, sehr schönen Körper, alles, was sie anzieht, steht ihr. Als ich ihr wiederbegegnet bin, kam mir als erstes der Gedanke, man müßte sie hochheben, nur um zu sehen, wie es ist, sie einfach wegzutragen. Ich glaube, sie würde überhaupt nichts wiegen, hätte irgendwie kein Gewicht. Sie hat grüne, enorm große Augen, mit denen sie die Menschen einfängt. Sie hat eine Art, dich anzusehen, daß man glaubt, ihr nicht entkommen zu können. Wie von unten herauf schaut sie einen an, zieht einen zu sich herunter, obwohl sie eigentlich nicht viel kleiner ist als andere. Und zwingt die Person, mit der sie redet, sich vorzubeugen, hin zu ihr, man kann einfach nicht anders. Man kann sich ihr nicht entziehen, ich kann es nicht. Führt sie mit jemandem ein Gespräch, ist sie mit jedem Thema vertraut. Mal ist sie die Dame von Welt, dann eine ausgesprochene Feministin, schließlich die Kneipengängerin, die Freundin, ein simpler Flirt, ein Mächen aus gutem Hause oder eine professionelle Begleiterin. Ich kenne alle ihre Rollen, ich weiß bloß nicht, wie sie es macht, warum sie es tut. Ich ahne es nur.
Aber dann diese Liebe und Freundschaft zu mir. Sie sagt, es sei das Größte, was ihr je begegnet ist, die Nähe zwischen uns, die Vertrautheit, das Wissen, daß die eine wirklich alles von der anderen weiß. Daß wir miteinander verkettet sind, bis daß der Tod uns scheidet. Sie lacht, als sie es sagt, ihr scheint der Satz zu gefallen: »Bis daß der Tod uns scheidet.« Ich? Ich komme nicht weg von ihr, will es auch nicht. Wenn ich mit ihr zusammen bin, will ich nirgendwo anders sein, ich langweile mich keine Sekunde. Wenn ich nicht bei ihr bin, frage ich mich, was sie eigentlich mit mir macht, wie sie mich dazu bringt, diese wirklich unangenehmen Dinge zu tolerieren, so daß es fast scheint, als würde ich sie dazu ermuntern. Oft denke ich: Wie kommt es, daß jemand, der mich so ausfüllt, ein solches Gefühl der Leere in mir zurückläßt? Du wärst nicht stolz auf mich, Saskia.
Wir machen Reisen, richtig teure. Sie bezahlt. Ich warte wie ein braver Hund an der Leine, derweil sie kauft und kauft, und am Ende bin ich es, die ihre Tüten durch die Stadt trägt, die sie diesmal mit mir besuchen mußte. Ich sage, einen solchen Lebensstil könne ich mir nicht leisten. Sie sagt, ohne mich sei ihr Leben sinnlos, also müsse ich mitkommen, und sei mir das nur möglich, wenn sie bezahle, was sei dann wohl wichtiger? Ich lasse sie bezahlen, ich fahre mit. Was kann es schon schaden? Ich frage mich nur, wo ihr ganzes Geld herkommt. Sie sagt, daß ihr Vater sie unterstütze, doch daß die Zahlungen nur vorübergehend erfolgten, bis sie auf eigenen Füßen stehe. Tatsächlich hat sie nie eigenes Geld verdient, sie sagt, sie wisse nicht, wie man es macht. Lach nicht, Saskia, denn sie ist nicht stolz darauf. Sie sagt auch, die Sache müsse sich ändern, daß sie zwar ihre Eltern liebe, doch ihnen auch übelnehme, daß man sie so verwöhnt hat. Aber diese Zeit sei bald vorbei. »Können wir es nicht genießen, solange wir es noch so haben, was macht das schon?« fragt sie.
Also reisen wir, kaufen ein, treffen Menschen, gehen nächtelang aus; Desirée findet ständig Leute, mit denen wir uns umgeben können, die bewundern, die verführt werden, die an ihr zerren, die von uns angezogen werden. Manchmal fühle ich mich wie eine Anstandsdame, weil dieses Leben ja eigentlich nicht zu mir paßt und ich meist nur dabei bin, um Desirée zu schützen. »Ohne dich bin ich verloren«, sagt sie. Ich lache sie aus, doch sie behauptet, es ernst zu meinen. Ich müsse dasein, damit ihr nichts Schlimmes passiere. Sie sagt auch, sie sei furchtbar naiv, deshalb gerate sie in all diese Intrigen mit Männern und Frauen, in diese Wortgefechte und Schlägereien, Abrechnungen und Tränen. Irgendwie gerate sie immer mittenrein, sei der Mittelpunkt des Ganzen, und erst sei es wundervoll, alle freuten sich, weil sie so lebendig sei, doch dann verschiebe sich alles, und jemand nehme etwas übel, ein anderer glaube, er werde verspottet, ein dritter sei verliebt, ein vierter fühle sich abgewimmelt, ein fünfter betrogen, ein sechster schlechtgemacht, und mitten in all dem stehe Desirée und werde ausgenutzt, mißverstanden, mit Füßen getreten. Sie sagt selbst, es müsse an ihrer Gutgläubigkeit und Liebe zu den Menschen liegen. Sie will nichts Schlechtes, Saskia, nur ist das Ergebnis dessen, was sie tut, immer genau das. Also bin ich für sie da, bei mir weint sie sich aus. Ohne mich, Saskia, ohne mich ...
Sie lebt auf eine leichtsinnige Weise, die mich verwundert, weil sie so schlecht zu ihrem sonstigen Engagement und auch zu ihrer Großzügigkeit paßt. Sie interessiert sich, genau wie ich, vor allem für das, was in Afrika geschieht, und hat gebeten, zu den Versammlungen mitkommen zu dürfen, bisher aber noch keine Zeit gehabt. Das Herumbummeln und die Verantwortungslosigkeit seien bald vorbei, sagt sie, erst aber müsse sie alles ordentlich auskosten, damit ihr danach nichts fehle. Danach – damit meint sie die Zeit, wenn wir engagierte Frauen und Vorbilder für andere geworden sind. Danach – das ist der Tag, an dem sie ihrem Vater sagt, daß er seine Unterhaltszahlung einstellen kann. »Hilf mir, mit mir selbst zurechtzukommen, Klara«, sagt sie immer. Danach ist, wenn wir Nützliches tun und die Welt verändern, ja, sie sogar retten; sie sagt, daß das möglich sein müsse, was hätte dieses Leben sonst für einen Sinn? Ich stimme ihr zu, erkläre, ich hätte darauf gewartet, mich endlich nützlich zu machen, und wolle dafür sorgen, daß andere nicht zugrunde gehen.
Manche Nächte reden wir ununterbrochen. Manchen Morgen treffen wir uns zum Frühstück, und dann komme ich erst Tage später wieder von ihr weg, obwohl wir Vorlesungen und alles andere versäumen. Ich weiß nicht, wohin die Zeit verschwindet. Sie fragt mich unbarmherzig immer und immer wieder, dort auf dem Sofa in ihrer Wohnung direkt unter den Sternen, sie blinken durch das Dachfenster zu uns herunter, wenn wir Seesternen gleich in ihrem Bett liegen.
»Erzähl mir alles.«
»Von Saskia?«
»Alles, habe ich gesagt, Klara.«
»Saskia ist das, was ich nicht bin. Sie ruht in sich, ist geduldig und zielbewußt. Sie hat ihr Leben im Griff, und sie liebt, ohne daß sie daran kaputtgeht.«
»Ein Vorbild für andere Frauen?«
»Ja. Eines Tages muß ich wie sie werden. Genau wie sie.«
»Und deine Familie, Klara, wie war das mit der?«
»Unsere Familie ist kaputtgegangen. Das war meine Schuld. Sie ist zerbrochen, und Mama und ich sind hierhergezogen.«
»Und Saskia?«
»Sie ist in Holland geblieben, bei Papa. Ich konnte nicht verzeihen. Wenn ich nur mit mir eins gewesen wäre.«
»Was verzeihen, Klara?«
»Wir haben in Arnhem gewohnt. Wir waren eine Familie, eine ganze Familie, und in ihr war man ein anderer Mensch als außerhalb. Bei uns gab es Platz für die Person, die ich sein wollte. Ich habe nur nicht begriffen, daß es ohne unsere Familie nicht mehr dasselbe sein würde.«
»Was verzeihen, Klara?«
»Ich konnte es nicht, sonst hätten wir noch heute zusammenleben können. Meine Mutter hatte mich um Rat gefragt, verstehst du, ich nehme an, sie war verzweifelt. Ich war erst dreizehn. Sie hat gesagt, ich kann entscheiden, was mit unserer Familie wird. Das ist doch nicht richtig, eine Dreizehnjährige zu bitten, sie soll einer erwachsenen Frau raten?«
»Nein, sie war verzweifelt.«
»Das war sie. Mama wußte, daß Papa eine andere kennengelernt hatte. Arnhem war keine kleine Stadt, aber klein genug, daß alle Bescheid wußten. Ich glaube nicht, daß die Affäre schon lange gelaufen war, vielleicht hatten sie sich nur ein paarmal getroffen, vielleicht hatte es nichts bedeutet. Vielleicht war er einfach deprimiert, und meine Mutter konnte ihn in dem Moment nicht ertragen, und statt dessen war dann für kurze Zeit diese andere Frau da, Susanne, und er wandte sich ihr zu. Ein schrecklicher Irrtum, was anderes war es nicht: ein Irrtum.«
»Und danach?«
»Meine Mutter war ganz kopflos. Durch mich ist die Sache nicht besser geworden. Fünfzehn Jahre Vertrauen zueinander, wie schnell kann das zerstört werden? War es vorbei? Wie fängt man sonst wieder von vorn an?«
»Wie haben sie von vorn angefangen?« fragt Desirée und zwirbelt mein Haar zwischen ihren schmalen Fingern.
»Sie haben es nicht. Meine Mutter hat mich gefragt, ich wünschte so sehr, daß sie es nicht getan hätte. Sie hat mich gefragt, ob ich glaube, daß sie, daß ich Vater verzeihen könne.«
»Was hast du geantwortet?«
»Ich habe nein gesagt. Ich habe gesagt, das ist nicht zu verzeihen. Ich erinnere mich noch sehr gut, ich stand vor dem Kofferraum unseres Autos, das vor einem Laden in Arnhem geparkt war, und sie gab mir die Obsttüten. Apfelsinen waren drin, die sind auf die Straße gekullert, als ich wütend wurde. Ich habe gesagt: Nein. Lügen kann man nicht verzeihen. Ich würde es nie erlauben, daß sie wieder mit ihm zusammenlebt, die ganze Stadt wisse es schließlich, ich würde mich furchtbar schämen. Ich habe gesagt, daß ich weg will, daß wir in Schweden neu anfangen können, weit weg von ihm. Daß ich ihn verabscheue und ihn nie wiedersehen will.«
»Und was habt ihr gemacht?«
»Wir haben sie verlassen. Die Familie ist kaputtgegangen, wir haben Saskia und Vater zurückgelassen, und seitdem ist nichts mehr, wie es gewesen ist. Ich nehme alle Schuld auf mich.«
»Sag so was nicht, Klara.«
»Ich hätte antworten sollen: Bitte, Mama, verurteile ihn nicht. Entscheide dich nicht gegen ihn, bleib hier, man kann nicht einfach weglaufen. Ihr habt doch uns, ihr könnt doch uns, euch nicht auseinanderbringen. Wenn man erst jemanden verloren hat, kann man nicht weiterleben, man kann niemals neu anfangen. Ich, wenn überhaupt jemand, hätte es wissen müssen.«
»Haben sie neu anfangen können?«
»Nein. Jedenfalls Mutter nicht. Es hat andere Männer gegeben, doch nein. Vater lebt jetzt mit dieser Susanne zusammen, ich sehe sie aber nie. Saskia trifft sie natürlich, sie ist vernünftig, sie kann so was. Ich nicht, ich will nicht.«
»Aber da muß doch noch was anderes gewesen sein, ein anderer Grund, warum es so geworden ist, wie es heute ist.«
Ich schüttele irritiert den Kopf. Weshalb gehe ich nicht weg? Warum setze ich mich diesen Fragen immer wieder aus, sie weiß bald alles über mich. Sie sieht mich an, ihr stehen Tränen in den Augen, sie streckt die Hand aus. Weiß sie, was sie mit mir macht?
»Klara?«
»Mutter hat gesagt, daß es für mich schlecht ist. Daß sie und ich uns ein neues Leben aufbauen können, in Schweden, wo niemand etwas weiß. Ihr liege am meisten daran, daß ich mich wieder wohl fühle.«
»Dann warst du das Wichtigste für sie.«
»Mag sein. Sagen wir mal, daß es so war.«
Wir gehen zusammen in die Küche. Sie gießt uns etwas zu trinken ein, und ich sitze, an den Spültisch gelehnt, und fühle mich wie neu, als sei alles vorbei, die Schuld gesühnt, der Irrtum aufgeklärt – wir alle können neu anfangen.
»Man verläßt niemanden, Desirée. Das tut man nicht. Hörst du?«
»Ich weiß«, sagt sie, wie um mich zu beruhigen. »Ich weiß, weshalb bin ich sonst wohl hier? Ich verlasse dich nicht. Wir haben es uns doch versprochen, oder? Uns nie zu trennen, was auch kommen mag.«
Ich nicke. Was auch kommen mag. Nicht noch einmal, Saskia. Nicht wieder. Wir essen und reden, der Morgen wird zum Tag, dann zum Abend, und ich merke an ihrer Art, auf die Uhr zu sehen, daß sie weg muß, bald wird das Telefon klingeln, und sie wird Tonfall und Stimme ändern, und ich werde zwar dasein, doch nur an der Peripherie, als jemand, bei dem man sich Trost holen kann, wenn das Spiel schlecht ausgeht.
»Erzähl du«, sage ich, wie um sie vom Telefon abzubringen, von den Einladungen, den Männern, die sie anrufen, den alten Freunden oder den momentanen. »Erzähl«, sage ich und weiß, daß ich alles noch einmal hören werde, aber das ist egal, wenn sie nur nicht geht. Nicht ausgeht.
»Meine Eltern«, beginnt sie träumerisch, »meine Kindheit. Du weißt, es war die beste, die du dir vorstellen kannst.«
Ich nicke.
»Die beste. Meine Mutter stammt aus einer der vornehmsten Familien Schwedens, und die Vorfahren meines Vaters waren mit dem Zar von Rußland befreundet. Mein Vater war Unternehmer. Meine Eltern haben mir alles gegeben, mir hat es an nichts gefehlt.«
»Ich weiß. Erzähl von Eleonora und Gustav, Desirée.«
»Mutter ist in verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen aktiv, hier in Schweden, aber auch international. Sie ist geschickt im fund raising, im Aufbringen von Geld, das für Bedürftige gebraucht wird. Vater ist jetzt pensioniert, aber er ist noch immer Aufsichtsratsvorsitzender bei einigen bedeutenden internationalen Firmen.«
Sie spricht mechanisch, fast manisch, als gebe sie etwas auswendig Gelerntes wieder, das rasch heruntergebetet werden muß, bevor sie es vergißt.
»Kaffee«, sagt sie, »mit Kaffee hat Vater uns ein Vermögen verdient, natürlich neben dem Geld, das wir geerbt hatten. Das war in Kenia, wohin mein Vater und meine Mutter Anfang der vierziger Jahre gingen. Sie waren richtige Pioniere, haben Afrika dem multinationalen Handel geöffnet.«
»Wie die Afrikaner selbst vielleicht?«
»Ja, die auch, die auch. Das ist klar. Wenn ich die Augen zumache, sehe ich unsere große Villa auf dem Hochplateau, ein Stück außerhalb von Nairobi, überall umgeben von Kaffeepflanzungen. Unsere Diener nannten Mama bibi, und Papa war bwana Cronenfelt. Er hat das sehr gemocht, er war bei den Leuten dort mächtig beliebt. Anscheinend habe ich die Sprache damals gekonnt, jetzt erinnere ich mich nicht mehr daran. Ich habe ja nicht immer dort gewohnt, während der Schulzeit war ich in Internaten in der Schweiz, in England und in Frankreich. Aber Kenia war mein Zuhause, dort bin ich 1951 geboren. Eine wirklich faszinierende Welt, die jetzt längst verschwunden ist. Jammerschade. Dann sind sie Anfang der Siebziger hergezogen und ich mit ihnen. Ich meine, hier war ich ja trotz allem zu Hause. Ich habe alles bekommen, was ich haben wollte. Ich sage es immer wieder. Meine Eltern haben mich ermuntert, mich unterstützt, haben gesagt, ich kann alles werden, was ich nur will, sie haben mich ermutigt, eine wirklich freie Frau zu werden, die selbst nachdenkt.«
»Und Liebe?«
»All das und noch ein bißchen mehr«, sagt sie und wendet den Blick zum Fenster.
Sie sieht mich nicht an beim Erzählen, steht da, als sei sie in ihrer eigenen Welt – die Küchenlampe ist wie ein Scheinwerfer auf ihren Scheitel gerichtet –, und rasselt das Ganze herunter. Derweil ich mich an den Abwasch mache, bleibt sie mit geschlossenen Augen stehen.
»Ich will dir erklären, was Stil ist«, sagt sie plötzlich und schaut mich an. »Der ist wichtig, auch wenn du es nicht glaubst, doch in meinen Kreisen ist er wichtig. Damit bin ich aufgewachsen. Stil ist nicht angeboren, der wird erlernt. Ein Gefühl dafür, was richtig ist, was sich gehört. Ein ungeheures soziales Selbstvertrauen, verstehst du? Wenn man weiß, daß man immer auf das vorbereitet ist, was kommen wird, kann man nie enttäuscht werden. Damit bin ich aufgewachsen, das haben sie uns in den Internaten überall in Europa beigebracht: wie man Menschen auseinanderhält. Das ist alles, was ich wissen muß, so daß ich Leute meiner Sorte wiedererkenne.
»Und ich? Was ist mit mir, Desirée?« flüstere ich.
Sie lacht und zieht meine Hand aus dem Wasser, dreht die Innenseite zu ihren Lippen und küßt sie.
»Du weißt doch, das alles ist längst überholt! Es ist lange her, daß wir so gewesen sind. Ich erzähle es nur, damit du verstehst, wo ich herkomme.«
Sie stellt ihr Glas ab und geht ins Schlafzimmer, um sich umzuziehen. Der Schaum des Spülwassers reicht mir bis zu den Ellenbogen, ich puste ihn weg, und ein paar Seifenblasen treiben ins Zimmer. Das Telefon klingelt. Ich höre, daß sie mit jemandem spricht, ich weiß, jetzt fängt es an, fängt es wieder an. Sie ist geschminkt, hat sich Lidstriche gezogen und ihren Körper in etwas Hauchdünnes und tief Ausgeschnittenes gehüllt, die Stiefel reichen ihr bis zu den Schenkeln. Das ist nicht mehr die Desirée, die ich kenne, nicht die Desirée, die ihre Eltern kennen, auch nicht die Desirée, die ihre stilvollen Freunde treffen. Sie sieht aus wie ein kleines Mädchen, das sich verirrt hat, sich aber weigert, das zuzugeben.
»Willst du mit?« fragt sie und zündet sich eine Zigarette an.
Ich schüttele den Kopf.
»Du mußt mit«, sagt sie.
Ich nicke.
Wir sind unterwegs. Es ist eine merkwürdige Welt, Menschen derselben Art finden sofort zueinander. Es ist, als würde jemand eine Glocke läuten, worauf alle mit denselben Bedürfnissen zur Wasserstelle eilen, wo sie den Meistbietenden Waren offerieren. Desirée ist teuer, das wissen alle, man konkurriert um sie. Wenn wir ausgehen, weiß ich nicht mehr, wer sie ist. Ich meine, ich sehe es zwar, doch wünschte ich, es nicht begreifen zu müssen. Sie bietet sich all denen feil, die ihren Weg kreuzen. Sie sagt, sie sei wie ein Mann, nehme sich, ohne die geringsten Bedenken, was sie gerade haben wolle, und gehe dann einfach weiter. Sie sagt, so möchte sie leben, das sei für eine Frau die ultimative Freiheit, ich solle dieses Leben ausprobieren, ohne jede Bindung, ohne Kindergebären, Treue und Versprechungen. Ich sage, daß ich es nicht kann. Das einzige, was ich tue, ist, ihr zuzuschauen. Es ist, als würde mir jemand eine Pistole an den Kopf halten, so daß ich völlig paralysiert bin. In diesen Nächten sind es immer Männer, die uns einladen, und sie sagt laut, dazu wären sie schließlich da. Ich drehe mich weg, wenn sie so redet, doch ich bleibe sitzen. Für sie krempele ich mich völlig um.
Es wird immer später. Ich weiß nicht, wen sie diesmal erwählt hat. Sie sucht sich selten junge Männer aus, die sie anhimmeln und gern mehr als eine Nacht von ihr hätten, Männer, die sie wirklich lieben könnten. Sie sind es nie. Es sind die älteren, meist schon vergebenen Männer, für die sie sich entscheidet, Männer, die sich Desirées Gewohnheiten leisten können und nicht nur Versprechungen zu bieten haben. Es ist vorgekommen, daß plötzlich deren Frauen neben ihr standen und ihr ins Gesicht schlugen, doch hinterher sagt sie, die seien selbst schuld, warum hätten sie sich auch so einen Mann genommen. Sie habe ihnen nur die Augen geöffnet. Mir gefällt das nicht. Aber ich sitze dort. Das macht mich vermutlich zur Mitschuldigen. Ich stehe auf, um nach Hause zu gehen, wie immer allein. Wenn ich nur wüßte, wie ich Desirée endgültig von hier wegholen könnte. Sie kommt hin zu mir, direkt hinter ihr steht der Mann, der den Abend bestritten hat. Ich mag seinen Blick nicht. Sie beugt sich vor und legt ihre Stirn an die meine. Kein Weg aus der Sache heraus. Die Lippen an meiner Wange. Was tut sie mit mir. Sie sieht, was ich denke.
»Verstehst du nicht?« flüstert sie. »Ich binde mich nicht. Ich warte auf dich. Eines Tages werden wir all das hinter uns lassen und irgendwo von großem Nutzen sein. Genau das steht uns bevor.«
Später in der Nacht, viel später, wenn sie an meiner Tür klingelt und ich ihr die Sachen ausziehe und ihr Haar entwirre, flüstert sie: »Kümmere dich um mich, Klara. Bitte, kümmere dich um mich. Ich weiß nicht immer, was ich tue.«
Ich sehe, was ich schon sah, als wir noch Kinder waren, was ich die ganze Zeit geahnt habe: Sie ist irgendwie verloren, sie hat keine Chance. Ich nehme ihren Kopf zwischen meine Hände. Was soll ich sonst tun.
»Komm rein zu mir«, sage ich. »Komm nach Hause.«
Versteh mich, Saskia. Verurteile mich nicht. Nicht, wie ich es getan habe. Versteh mich. Ich kann es nicht.
Klara