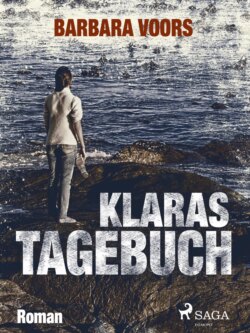Читать книгу Klaras Tagebuch - Barbara Voors - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеStockholm, Oktober 1980
Liebe Saskia,
es ist schwer zu sagen, wo ich anfangen soll. Es ist so lange her, daß ich gewußt habe, wie ich zu dir vorzudringen vermochte. Ich glaube, das hier könnte eine Möglichkeit sein, das Schreiben, meine ich. Ich bin mir völlig im klaren, daß ich diese Zeilen nicht abschicken kann, aber vielleicht kann ich die Dinge gerade deshalb genau so aufschreiben, wie sie geschehen sind, ohne erst darüber nachdenken und all das weglassen zu müssen, was dich beunruhigen könnte. Wenn mich jemand fragen würde, worin der große Unterschied zwischen Klara und Saskia besteht, dann würde ich sagen, er hat mit Verantwortung zu tun. Du übernimmst Verantwortung, ich drücke mich am liebsten. Du stehst für deine Handlungen ein, du bist konsequent, du liebst in Maßen, du verärgerst niemanden, und du würdest es niemals zulassen, daß ein Mann – oder eine Frau – dich beherrschen. Ich würde sagen, du bist eine Frau, die alle anderen Frauen als ein Ideal betrachten könnten. Du würdest natürlich lachen, wenn du mich hörtest.
Und ich? Du kennst mich. Besser als jeder andere. Meine beste Eigenschaft ist vielleicht, daß ich so leidenschaftlich bin. Ich glaube wirklich, daß ich Menschen helfen kann, denen Veränderungen schwerfallen. Ich glaube an die heilende Kraft des Menschen, daran, daß ich meine Hand ausstrecken kann, um andere zu berühren und vor dem Untergang zu bewahren. Lach nicht, Saskia. Ich glaube daran. Im übrigen, denke ich, daß man mich für nicht wirklich seriös hält, für irgendwie sprunghaft, und das ist wohl genau der Punkt, wo meine mangelnde Reife und die fehlende Bereitschaft zur Verantwortung ins Spiel kommen. Ich flattere ein bißchen wie ein Blatt im Wind, lasse mich manchmal in jede Richtung lenken, vor allem von Menschen, in die ich vernarrt bin. Die Wahrheit ist, daß ich mich ziemlich schnell oder besser sehr schnell in jemanden vergucke. Ich denke: Ich habe sechsundzwanzig Jahre gelebt, und was habe ich mit meinem Leben angefangen? Habe geliebt und das Leben von Menschen retten wollen. Ich glaube, manchmal ist es mir tatsächlich gelungen.
Ich habe mich politisch ziemlich engagiert. Du würdest stolz auf mich sein, ich weiß, du würdest mich weiter anspornen. Was in Südafrika geschieht, hat mir und so vielen anderen die Augen geöffnet, ich gehe zu allen möglichen Demonstrationen und sammle Unterschriften für Boykotte. Ich arbeite auch für die Unterstützung der afrikanischen Befreiungsbewegungen. Das ist eine Sache, für die ich mich zuständig fühle.
Aber in meinem eigenen Leben sehe ich keine Richtung. Ich wünschte, ich müßte das hier nicht so formulieren, doch ich kann mich nicht davor drücken. Manchmal denke ich: Wenn es nur jemanden gäbe, der mein Leben lenken könnte. Das ist unverzeihlich, ich weiß. Wenn ich Menschen begegne, die wissen, was sie wollen, packt mich heftiger Neid. Woher nehmen sie die Gewißheit, daß sie für eine Sache bestimmt sind? Seit unsere Familie zerbrochen ist – Papa und du in Holland, Mama und ich hier in Schweden –, habe ich mit der Richtung in meinem Leben Probleme. Natürlich war es für Mutter schwer, die Untreue und all das drum herum, aber dennoch wünschte ich, daß diese Sache, die ich für einen furchtbaren Fehler halte, nie geschehen wäre. Wie sollen Mutter und Vater jemals wieder mit einem anderen zu diesem Familiengefühl finden, das bei uns ohne jede Anstrengung vorhanden war? Wie sollen sie, wie sollen wir neu anfangen können? Mitunter frage ich mich: Weshalb glauben die Menschen immer, daß es anderswo besser wird?
Ich weiß nur zu gut, wer an all dem schuld ist, auch daran. Wenn ich nur ein bißchen zu mir gefunden hätte – »Konzentrier dich auf das Wesentliche, Klara«, würdest du sagen –, dann hätten wir uns vielleicht nie zu trennen brauchen. Ihr fehlt mir so sehr, Saskia, vor allem du. Trotzdem weiß ich, daß ich jetzt erwachsen bin, daß ich mir ein eigenes Leben aufbauen muß mit Mann und Kindern, Beruf und Karriere, mit Freundinnen, Hobbys, Schnittblumen auf dem Sofatisch und politischen Ansichten, die mit ideenreichen Partys in meinem Haus in Einklang zu bringen sind. Wie soll ich das alles hinkriegen? Ich denke oft, daß ich wie du werden möchte: eine unabhängige Frau mit klaren Lebenszielen. Aber wie geht das mit dem Bild der Kleinfamilie zusammen? Wie soll ich die Unabhängigkeit behalten mit einem Kind, das zuerst meinen Körper okkupiert, ihn bis zur Unkenntlichkeit anschwellen läßt und mir danach viele Jahre lang den größten Teil meines Engagements abverlangt? Und gleichzeitig erwartet man von mir, ich soll fit und an neuen Dingen interessiert auf meinem Job erscheinen und mich zu einem guten Lohn und möglichst einer Chefposition hocharbeiten, all das neben einem gut funktionierenden Familienleben mit jenem Mann, der mir im richtigen Alter über den Weg gelaufen ist. Erzähl mir, Saskia, wie das gehen soll? Nein, du brauchst es nicht zu tun, ich weiß es längst: Natürlich geht es, Klara, mein Gott, reiß dich zusammen. Ich will nicht negativ erscheinen, fürchte aber, ich bin viel zu verwirrt, um mein Leben so in den Griff zu bekommen, wie du es kannst. Zusammen mit dir und Mama und Papa war ich intakt, wußte instinktiv, daß ihr mich immer auffangt, wenn ich falle. Ihr hattet Worte für das Unbegreifliche da draußen, hattet Liebe als Kompensation für das, was ihr nicht erklären konntet. Ihr habt meinen Kopf in eure Hände genommen, wenn er vor Hitze zerspringen wollte, ihr habt Handtücher um meinen Körper gelegt, wenn ich blaugefroren war. Wo finde ich den Mann, der jetzt dasselbe für mich tut?
Meine Gedanken wirbeln wie immer in alle Richtungen, doch kehren sie langsam wieder zum Kern der Sache zurück: Was kann ich tun, um den Irrtum ungeschehen zu machen? Nichts. Es ist nun einmal, wie es ist, und vielleicht ist es ohnehin zu spät, doch irgendwie glaube ich, wenn ich andere vor dem Untergang bewahren kann, dann gibt es auch eine Möglichkeit der Rettung für uns. In dieser Gewißheit muß ich leben. Ich muß das akzeptieren und die Menschen lieben, sie stärker und intensiver lieben, als es andere vermögen. Das soll meine Richtung sein, mein Ziel, mein Versuch, Versöhnung zu erlangen.
Liebe ist ansonsten nicht das, woran man hier draußen an der Universität zuerst denkt. Wie Schafe werden wir von den Vorlesungssälen zur Bibliothek, in die Prüfungsräume und wieder zurück getrieben. Ein ewiger Kreislauf. Ich habe meine Benutzerkarte und meinen Studentenausweis erhalten, ich bin ein Teil des Systems, doch kann ich nicht gerade behaupten, daß ich begeistert bin. Das liegt ein bißchen an der Sprache. Unser Literaturprofessor spricht auf eine Weise, die für mich fast unverständlich ist. Ich schäme mich wirklich, das so ausdrücken zu müssen. Glaub mir, ich tu mein Bestes! In der ersten Vorlesung habe ich versucht, die sich ständig wiederholenden Begriffe im Wörterbuch nachzuschlagen, doch mußte ich es aufgeben. Ich dachte: Ist es das, wovon ich so besessen war, wonach ich mich gesehnt habe? Irgendwie scheint man hier die Absicht zu haben, unsere Begeisterung für den Gegenstand zu ersticken und durch einen Kode zu ersetzen. Und die Schönheit der Texte verschwindet und die Lust ebenso. Auch ich habe diesen Kode bereits erlernt – wie soll ich die Sache sonst durchstehen –, und manchmal schäme ich mich, wenn ich Abstraktionen herunterbete und der Professor zustimmend nickt. Ich denke: Jetzt bin ich schon genau so wie er. Auch ich habe mich verändert, um nach mehr zu klingen. Merkwürdigerweise sagen meine Studienkollegen, ich sei naiv, wenn ich das Thema anschneide.
»Willkommen in der Wirklichkeit«, sagen einige der älteren und lachen. »So muß es klingen, so redet man, wenn man etwas erreichen will.«
Und ich begreife, daß ich meine Ansichten verschweigen muß, um mich nicht unbeliebt zu machen. Vielleicht gewöhne ich mich ja auch daran. Manchmal fällt es mir einfach schwer, mich mit den Zeugnissen in der Hand nach dem Studium die Universität verlassen zu sehen. Bin ich dann noch derselbe Mensch?
Laß dir jetzt von dem Tollsten erzählen, was mir in diesem Herbst passiert ist. Ich bin total verhext und besessen, werde bewundert und vor allem gebraucht. Es ist schwer, diese Beziehung nur Freundschaft zu nennen, denn es ist viel mehr. Du weißt, wie es sein kann, wenn zwei Frauen – ich glaube, es müssen Frauen sein – sich so nahe kommen, daß sie nicht einmal mehr den Mund aufmachen können, ohne daß beide zu lachen oder zu weinen anfangen, dieselben Worte sagen oder auf dieselbe Idee kommen. Es ist, als hätten wir uns immer gekannt, was irgendwie ja tatsächlich der Fall ist. In dem Sommer, als ich zehn Jahre alt war, hatte Desirées Familie die riesige gelbe Villa auf der anderen Seite der Insel gemietet. Ich weiß noch, ich dachte schon damals, daß ich bisher nie jemanden wie sie getroffen hatte. Jemanden, der so sehr hier ist, so intensiv, dessen Blick dir sagt, daß er schon alles über dich weiß. Es ist fast so, als könnten wir beide nicht ohne den anderen sein. Das hört sich unbegreiflich an: Wir können nicht ohne den anderen sein. Nun kommt dieses »ohne den anderen« nicht sehr häufig vor, weil wir im gleichen Kurs sind. Aber dennoch, irgendwie hat das Ganze etwas Magisches. Ich sehe mich als jemanden, der beschenkt worden ist und obendrein unglaubliches Glück gehabt hat. Weißt du, Saskia, es ist, als hätte ich dich zurückbekommen, eine Zwillingsschwester. Einen Menschen, vor dem ich bald keine Geheimnisse mehr habe, und das ist wirklich eine Erleichterung. Ich finde, die Männer sollten uns darum beneiden, um diese Intimität, mit der Frauen sich einander nähern können. Wir brauchen keine Umwege zu machen über Tennisspielen und stundenlanges Sitzen in der Kneipe, um nach einer Unmenge von Bier vorsichtig ein paar vertrauliche Mitteilungen auszutauschen. Am selben Abend, als Desirée und ich uns wiederbegegnet sind, habe ich bei ihr übernachtet. Ich glaube, wir haben vierundzwanzig Stunden hintereinander geredet. Sie besitzt diese Fähigkeit. Ich war schweißnaß, als ich nach Hause kam, war heiser und fiebrig und mußte mich zwei Tage lang erholen. Jetzt teilen wir alles miteinander. Wir teilen unsere Zeit, unser Geld, Kleider, Schminke, Handtaschen, Freunde, Kaffeetassen, Zigaretten, Träume, Reisen und Scherze. Manchmal ist mir, als brauchte ich Luft, müsse selbst atmen, um zu wissen, wo ich anfange und sie endet. Doch wenn ich das auch nur andeute, sieht sie unglaublich enttäuscht aus und macht eine Szene, worauf ich die Idee sofort fallenlasse. Wenn sie deshalb traurig wird, ist es die Sache nicht wert. Zeit für mich selbst haben, wiegt unser Zusammensein nicht auf.
Neulich hat sie mich an etwas erinnert.
»Weißt du noch, Klara, was wir als Kinder immer gesagt haben, wenn wir uns im Sommer damals auf der Insel trennen mußten?«
»Nein.«
»Wir haben uns bei den Händen gefaßt, und ich habe dich gefragt, es war wie ein Ritual, von dem ich irgendwo gelesen hatte: Werden wir uns immer lieben?«
»Und was habe ich geantwortet?«
»Du hast gesagt: Immer. Genau das hast du gesagt.«
Ich fühle mich mehr zu ihr hingezogen als zu irgendeinem anderen Menschen. Es ist ihre Ausstrahlung, ihr Blick. Schwer zu erklären, mit Worten allein läßt sich das nicht recht beschreiben. Ich kann nur sagen, daß sie einzigartig, amüsant, großzügig und ungewöhnlich talentiert ist und daß wir einfach alles miteinander besprechen. Vor allem, wie wir zwei freie, unabhängige Frauen werden können. Sie ist Feministin. Sie betont es sehr oft, erinnert mich daran, daß sie in erster Linie genau das ist. Wir haben beschlossen, uns gegenseitig zu unterstützen. Weil wir uns in eine Gesellschaft begeben müssen, die in ihrer ganzen Geschichte durch Männer definiert und von ihnen gelenkt worden ist – und wo Frauen ja eigentlich erst im letzten Jahrhundert Zutritt erhalten haben –, müssen wir uns unserer Rolle bewußt und auf der Hut sein. Vor allem müssen wir Frauen zusammenhalten, betont sie. Du findest das vielleicht selbstverständlich, doch ich hatte das nicht so begriffen wie du. Auch Desirée nicht, und das hat mich vielleicht ein bißchen gewundert, bei der Selbstsicherheit, die sie ausstrahlt. Sie hält sich in einer Weise an mich, die mich ebenfalls verwundert. Es ist erstaunlich, daß sie bei all ihren großartigen Gedanken so winzig und verwirrt ist. Manchmal ist sie geradezu niemand mehr. Sie sagt, sie hätte noch nie jemanden so dicht an sich herangelassen wie mich. Das geht mir nahe. Wir haben uns ewige Treue gelobt: Was auch geschehen mag, wir werden einander nicht im Stich lassen.
Zu Männern verhält sie sich anders. Sie findet, man muß sie ausnutzen, zum Objekt machen (ja, so redet sie), genauso, wie man es immer mit uns gemacht hat; ich dagegen finde, wir sollten uns statt dessen als gleichberechtigt sehen, daß die freie Frau auch die Voraussetzung für den freien Mann ist. Das war mir immer selbstverständlich erschienen. Aber Desirée teilt meine Meinung nicht. Es beunruhigt mich ein wenig, wenn ich sehe, wie sie die Männer systematisch ausnutzt. Verstehst du, es gibt keine Möglichkeit, ihrer Schönheit zu entkommen.
In all den Nächten liegen wir auf ihrem Sofa und reden und reden, und am Ende ist mein Mund so trocken, daß wir noch eine Kanne Tee aufsetzen, nur um Luft holen zu können und um die Lippen ein bißchen anzufeuchten. Das ist wahnsinnig anstrengend, aber phantastisch. Sie sieht mich an, und ich weiß, in ihren Augen steht die Wahrheit über mich, und daß ich alles tun werde, worum sie mich bittet. Willst du, daß ich es dir erkläre? Ich glaube nicht, daß ich es kann. Nachts liegt ihr Kopf auf meinem Schoß, und derweil ich ihr Haar streichle, flüstere ich: »Beschreib dich selbst mit einem Satz.«
Sie antwortet, und das beunruhigt mich; denn weißt du, was sie antwortet: »Ich bin ein kleines Mädchen mit sehr großen Ansprüchen.«
Ich hätte so etwas wahrscheinlich nicht gesagt. Es ist auch nicht das, was du geantwortet hättest. Aber du verstehst nicht. Wenn ich nicht für sie da wäre, dann weiß ich nicht ... Mir ist klar, wie verworren das alles klingen muß. Ich liebe sie so.
Deine Klara